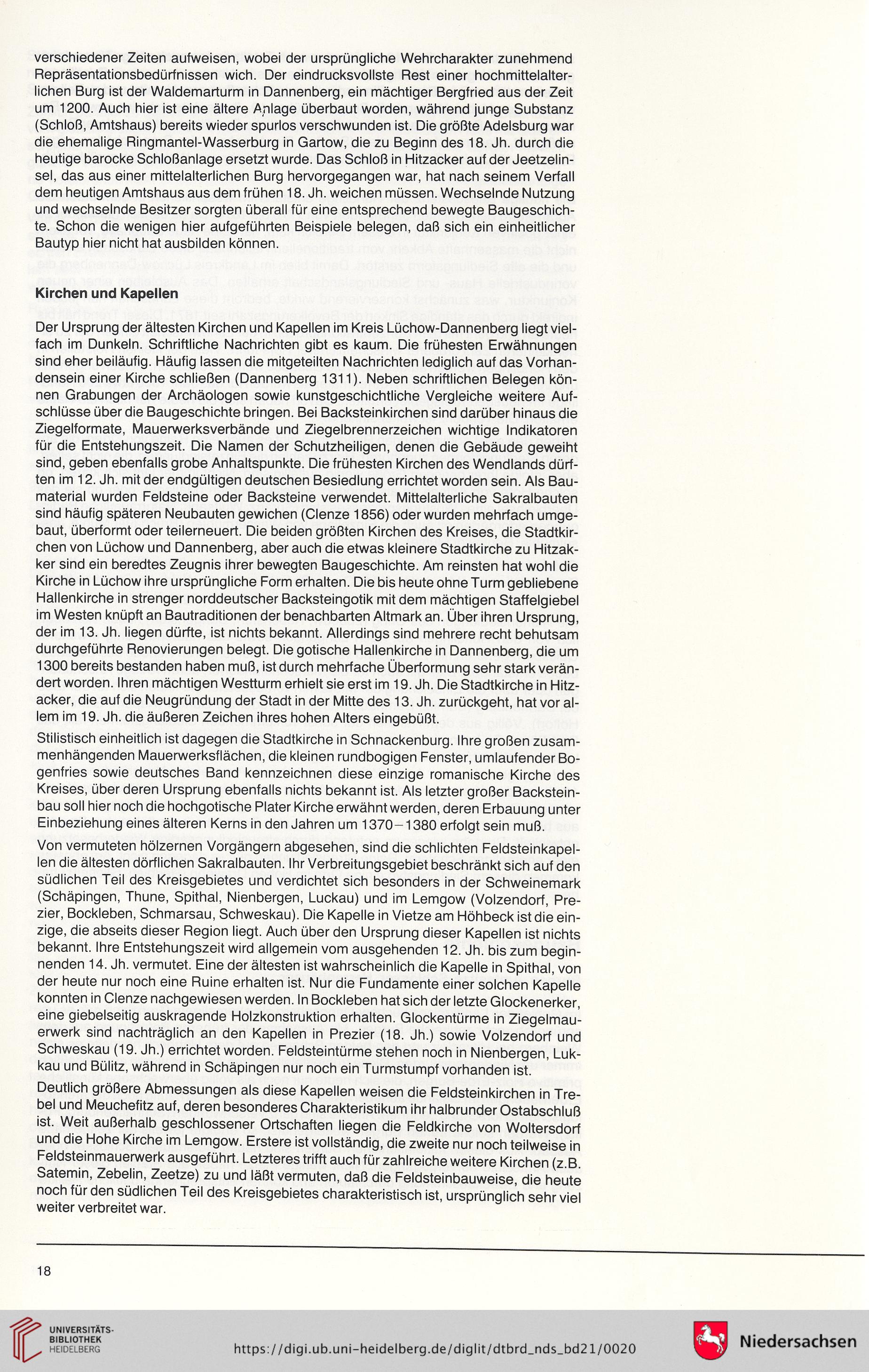verschiedener Zeiten aufweisen, wobei der ursprüngliche Wehrcharakter zunehmend
Repräsentationsbedürfnissen wich. Der eindrucksvollste Rest einer hochmittelalter-
lichen Burg ist der Waldemarturm in Dannenberg, ein mächtiger Bergfried aus der Zeit
um 1200. Auch hier ist eine ältere Anlage überbaut worden, während junge Substanz
(Schloß, Amtshaus) bereits wieder spurlos verschwunden ist. Die größte Adelsburg war
die ehemalige Ringmantel-Wasserburg in Gartow, die zu Beginn des 18. Jh. durch die
heutige barocke Schloßanlage ersetzt wurde. Das Schloß in Hitzacker auf der Jeetzelin-
sel, das aus einer mittelalterlichen Burg hervorgegangen war, hat nach seinem Verfall
dem heutigen Amtshaus aus dem frühen 18. Jh. weichen müssen. Wechselnde Nutzung
und wechselnde Besitzer sorgten überall für eine entsprechend bewegte Baugeschich-
te. Schon die wenigen hier aufgeführten Beispiele belegen, daß sich ein einheitlicher
Bautyp hier nicht hat ausbilden können.
Kirchen und Kapellen
Der Ursprung der ältesten Kirchen und Kapellen im Kreis Lüchow-Dannenberg liegt viel-
fach im Dunkeln. Schriftliche Nachrichten gibt es kaum. Die frühesten Erwähnungen
sind eher beiläufig. Häufig lassen die mitgeteilten Nachrichten lediglich auf das Vorhan-
densein einer Kirche schließen (Dannenberg 1311). Neben schriftlichen Belegen kön-
nen Grabungen der Archäologen sowie kunstgeschichtliche Vergleiche weitere Auf-
schlüsse über die Baugeschichte bringen. Bei Backsteinkirchen sind darüber hinaus die
Ziegelformate, Mauerwerksverbände und Ziegelbrennerzeichen wichtige Indikatoren
für die Entstehungszeit. Die Namen der Schutzheiligen, denen die Gebäude geweiht
sind, geben ebenfalls grobe Anhaltspunkte. Die frühesten Kirchen des Wendlands dürf-
ten im 12. Jh. mit der endgültigen deutschen Besiedlung errichtet worden sein. Als Bau-
material wurden Feldsteine oder Backsteine verwendet. Mittelalterliche Sakralbauten
sind häufig späteren Neubauten gewichen (Clenze 1856) oder wurden mehrfach umge-
baut, überformt oder teilerneuert. Die beiden größten Kirchen des Kreises, die Stadtkir-
chen von Lüchow und Dannenberg, aber auch die etwas kleinere Stadtkirche zu Hitzak-
ker sind ein beredtes Zeugnis ihrer bewegten Baugeschichte. Am reinsten hat wohl die
Kirche in Lüchow ihre ursprüngliche Form erhalten. Die bis heute ohne Turm gebliebene
Hallenkirche in strenger norddeutscher Backsteingotik mit dem mächtigen Staffelgiebel
im Westen knüpft an Bautraditionen der benachbarten Altmark an. Über ihren Ursprung,
der im 13. Jh. liegen dürfte, ist nichts bekannt. Allerdings sind mehrere recht behutsam
durchgeführte Renovierungen belegt. Die gotische Hallenkirche in Dannenberg, die um
1300 bereits bestanden haben muß, ist durch mehrfache Überformung sehr stark verän-
dert worden. Ihren mächtigen Westturm erhielt sie erst im 19. Jh. Die Stadtkirche in Hitz-
acker, die auf die Neugründung der Stadt in der Mitte des 13. Jh. zurückgeht, hat vor al-
lem im 19. Jh. die äußeren Zeichen ihres hohen Alters eingebüßt.
Stilistisch einheitlich ist dagegen die Stadtkirche in Schnackenburg. Ihre großen zusam-
menhängenden Mauerwerksflächen, die kleinen rundbogigen Fenster, umlaufender Bo-
genfries sowie deutsches Band kennzeichnen diese einzige romanische Kirche des
Kreises, über deren Ursprung ebenfalls nichts bekannt ist. Als letzter großer Backstein-
bau soll hier noch die hochgotische Plater Kirche erwähnt werden, deren Erbauung unter
Einbeziehung eines älteren Kerns in den Jahren um 1370-1380 erfolgt sein muß.
Von vermuteten hölzernen Vorgängern abgesehen, sind die schlichten Feldsteinkapel-
len die ältesten dörflichen Sakralbauten. Ihr Verbreitungsgebiet beschränkt sich auf den
südlichen Teil des Kreisgebietes und verdichtet sich besonders in der Schweinemark
(Schäpingen, Thune, Spithal, Nienbergen, Luckau) und im Lemgow (Volzendorf, Pre-
zier, Bockleben, Schmarsau, Schweskau). Die Kapelle in Vietze am Höhbeck ist die ein-
zige, die abseits dieser Region liegt. Auch über den Ursprung dieser Kapellen ist nichts
bekannt. Ihre Entstehungszeit wird allgemein vom ausgehenden 12. Jh. bis zum begin-
nenden 14. Jh. vermutet. Eine der ältesten ist wahrscheinlich die Kapelle in Spithal, von
der heute nur noch eine Ruine erhalten ist. Nur die Fundamente einer solchen Kapelle
konnten in Clenze nachgewiesen werden. In Bockleben hat sich der letzte Glockenerker,
eine giebelseitig auskragende Holzkonstruktion erhalten. Glockentürme in Ziegelmau-
erwerk sind nachträglich an den Kapellen in Prezier (18. Jh.) sowie Volzendorf und
Schweskau (19. Jh.) errichtet worden. Feldsteintürme stehen noch in Nienbergen, Luk-
kau und Bülitz, während in Schäpingen nur noch ein Turmstumpf vorhanden ist.
Deutlich größere Abmessungen als diese Kapellen weisen die Feldsteinkirchen in Tre-
bel und Meuchefitz auf, deren besonderes Charakteristikum ihr halbrunder Ostabschluß
ist. Weit außerhalb geschlossener Ortschaften liegen die Feldkirche von Wolfersdorf
und die Hohe Kirche im Lemgow. Erstere ist vollständig, die zweite nur noch teilweise in
Feldsteinmauerwerk ausgeführt. Letzteres trifft auch für zahlreiche weitere Kirchen (z.B.
Satemin, Zebelin, Zeetze) zu und läßt vermuten, daß die Feldsteinbauweise, die heute
noch für den südlichen Teil des Kreisgebietes charakteristisch ist, ursprünglich sehr viel
weiter verbreitet war.
18
Repräsentationsbedürfnissen wich. Der eindrucksvollste Rest einer hochmittelalter-
lichen Burg ist der Waldemarturm in Dannenberg, ein mächtiger Bergfried aus der Zeit
um 1200. Auch hier ist eine ältere Anlage überbaut worden, während junge Substanz
(Schloß, Amtshaus) bereits wieder spurlos verschwunden ist. Die größte Adelsburg war
die ehemalige Ringmantel-Wasserburg in Gartow, die zu Beginn des 18. Jh. durch die
heutige barocke Schloßanlage ersetzt wurde. Das Schloß in Hitzacker auf der Jeetzelin-
sel, das aus einer mittelalterlichen Burg hervorgegangen war, hat nach seinem Verfall
dem heutigen Amtshaus aus dem frühen 18. Jh. weichen müssen. Wechselnde Nutzung
und wechselnde Besitzer sorgten überall für eine entsprechend bewegte Baugeschich-
te. Schon die wenigen hier aufgeführten Beispiele belegen, daß sich ein einheitlicher
Bautyp hier nicht hat ausbilden können.
Kirchen und Kapellen
Der Ursprung der ältesten Kirchen und Kapellen im Kreis Lüchow-Dannenberg liegt viel-
fach im Dunkeln. Schriftliche Nachrichten gibt es kaum. Die frühesten Erwähnungen
sind eher beiläufig. Häufig lassen die mitgeteilten Nachrichten lediglich auf das Vorhan-
densein einer Kirche schließen (Dannenberg 1311). Neben schriftlichen Belegen kön-
nen Grabungen der Archäologen sowie kunstgeschichtliche Vergleiche weitere Auf-
schlüsse über die Baugeschichte bringen. Bei Backsteinkirchen sind darüber hinaus die
Ziegelformate, Mauerwerksverbände und Ziegelbrennerzeichen wichtige Indikatoren
für die Entstehungszeit. Die Namen der Schutzheiligen, denen die Gebäude geweiht
sind, geben ebenfalls grobe Anhaltspunkte. Die frühesten Kirchen des Wendlands dürf-
ten im 12. Jh. mit der endgültigen deutschen Besiedlung errichtet worden sein. Als Bau-
material wurden Feldsteine oder Backsteine verwendet. Mittelalterliche Sakralbauten
sind häufig späteren Neubauten gewichen (Clenze 1856) oder wurden mehrfach umge-
baut, überformt oder teilerneuert. Die beiden größten Kirchen des Kreises, die Stadtkir-
chen von Lüchow und Dannenberg, aber auch die etwas kleinere Stadtkirche zu Hitzak-
ker sind ein beredtes Zeugnis ihrer bewegten Baugeschichte. Am reinsten hat wohl die
Kirche in Lüchow ihre ursprüngliche Form erhalten. Die bis heute ohne Turm gebliebene
Hallenkirche in strenger norddeutscher Backsteingotik mit dem mächtigen Staffelgiebel
im Westen knüpft an Bautraditionen der benachbarten Altmark an. Über ihren Ursprung,
der im 13. Jh. liegen dürfte, ist nichts bekannt. Allerdings sind mehrere recht behutsam
durchgeführte Renovierungen belegt. Die gotische Hallenkirche in Dannenberg, die um
1300 bereits bestanden haben muß, ist durch mehrfache Überformung sehr stark verän-
dert worden. Ihren mächtigen Westturm erhielt sie erst im 19. Jh. Die Stadtkirche in Hitz-
acker, die auf die Neugründung der Stadt in der Mitte des 13. Jh. zurückgeht, hat vor al-
lem im 19. Jh. die äußeren Zeichen ihres hohen Alters eingebüßt.
Stilistisch einheitlich ist dagegen die Stadtkirche in Schnackenburg. Ihre großen zusam-
menhängenden Mauerwerksflächen, die kleinen rundbogigen Fenster, umlaufender Bo-
genfries sowie deutsches Band kennzeichnen diese einzige romanische Kirche des
Kreises, über deren Ursprung ebenfalls nichts bekannt ist. Als letzter großer Backstein-
bau soll hier noch die hochgotische Plater Kirche erwähnt werden, deren Erbauung unter
Einbeziehung eines älteren Kerns in den Jahren um 1370-1380 erfolgt sein muß.
Von vermuteten hölzernen Vorgängern abgesehen, sind die schlichten Feldsteinkapel-
len die ältesten dörflichen Sakralbauten. Ihr Verbreitungsgebiet beschränkt sich auf den
südlichen Teil des Kreisgebietes und verdichtet sich besonders in der Schweinemark
(Schäpingen, Thune, Spithal, Nienbergen, Luckau) und im Lemgow (Volzendorf, Pre-
zier, Bockleben, Schmarsau, Schweskau). Die Kapelle in Vietze am Höhbeck ist die ein-
zige, die abseits dieser Region liegt. Auch über den Ursprung dieser Kapellen ist nichts
bekannt. Ihre Entstehungszeit wird allgemein vom ausgehenden 12. Jh. bis zum begin-
nenden 14. Jh. vermutet. Eine der ältesten ist wahrscheinlich die Kapelle in Spithal, von
der heute nur noch eine Ruine erhalten ist. Nur die Fundamente einer solchen Kapelle
konnten in Clenze nachgewiesen werden. In Bockleben hat sich der letzte Glockenerker,
eine giebelseitig auskragende Holzkonstruktion erhalten. Glockentürme in Ziegelmau-
erwerk sind nachträglich an den Kapellen in Prezier (18. Jh.) sowie Volzendorf und
Schweskau (19. Jh.) errichtet worden. Feldsteintürme stehen noch in Nienbergen, Luk-
kau und Bülitz, während in Schäpingen nur noch ein Turmstumpf vorhanden ist.
Deutlich größere Abmessungen als diese Kapellen weisen die Feldsteinkirchen in Tre-
bel und Meuchefitz auf, deren besonderes Charakteristikum ihr halbrunder Ostabschluß
ist. Weit außerhalb geschlossener Ortschaften liegen die Feldkirche von Wolfersdorf
und die Hohe Kirche im Lemgow. Erstere ist vollständig, die zweite nur noch teilweise in
Feldsteinmauerwerk ausgeführt. Letzteres trifft auch für zahlreiche weitere Kirchen (z.B.
Satemin, Zebelin, Zeetze) zu und läßt vermuten, daß die Feldsteinbauweise, die heute
noch für den südlichen Teil des Kreisgebietes charakteristisch ist, ursprünglich sehr viel
weiter verbreitet war.
18