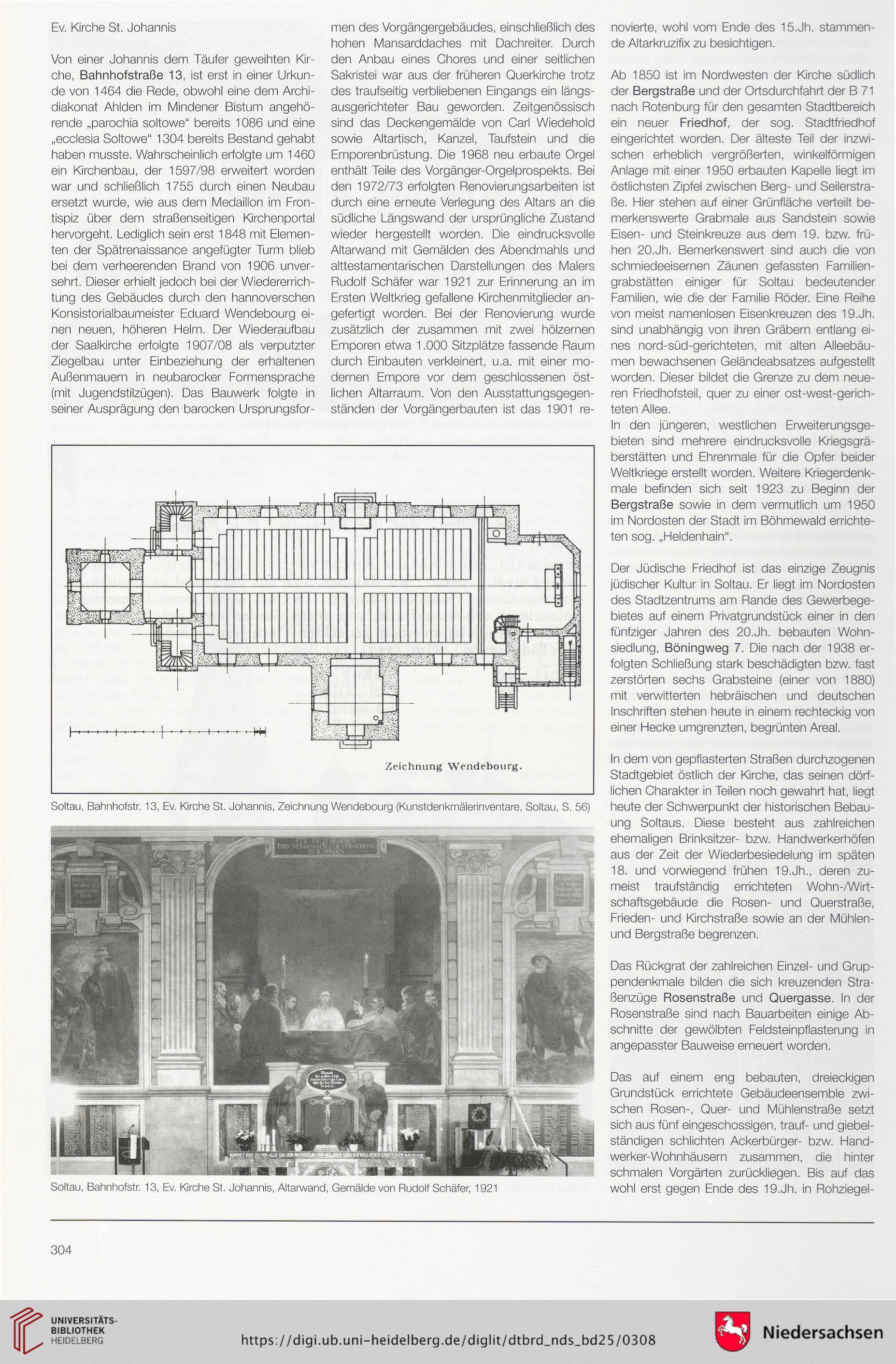Ev. Kirche St. Johannis
Von einer Johannis dem Täufer geweihten Kir-
che, Bahnhofstraße 13, ist erst in einer Urkun-
de von 1464 die Rede, obwohl eine dem Archi-
diakonat Ahlden im Mindener Bistum angehö-
rende „parochia soltowe“ bereits 1086 und eine
„ecclesia Soltowe“ 1304 bereits Bestand gehabt
haben musste. Wahrscheinlich erfolgte um 1460
ein Kirchenbau, der 1597/98 erweitert worden
war und schließlich 1755 durch einen Neubau
ersetzt wurde, wie aus dem Medaillon im Fron-
tispiz über dem straßenseitigen Kirchenportal
hervorgeht. Lediglich sein erst 1848 mit Elemen-
ten der Spätrenaissance angefügter Turm blieb
bei dem verheerenden Brand von 1906 unver-
sehrt. Dieser erhielt jedoch bei der Wiedererrich-
tung des Gebäudes durch den hannoverschen
Konsistorialbaumeister Eduard Wendebourg ei-
nen neuen, höheren Helm. Der Wiederaufbau
der Saalkirche erfolgte 1907/08 als verputzter
Ziegelbau unter Einbeziehung der erhaltenen
Außenmauern in neubarocker Formensprache
(mit Jugendstilzügen). Das Bauwerk folgte in
seiner Ausprägung den barocken Ursprungsfor-
men des Vorgängergebäudes, einschließlich des
hohen Mansarddaches mit Dachreiter. Durch
den Anbau eines Chores und einer seitlichen
Sakristei war aus der früheren Querkirche trotz
des traufseitig verbliebenen Eingangs ein längs-
ausgerichteter Bau geworden. Zeitgenössisch
sind das Deckengemälde von Carl Wiedehold
sowie Altartisch, Kanzel, Taufstein und die
Emporenbrüstung. Die 1968 neu erbaute Orgel
enthält Teile des Vorgänger-Orgelprospekts. Bei
den 1972/73 erfolgten Renovierungsarbeiten ist
durch eine erneute Verlegung des Altars an die
südliche Längswand der ursprüngliche Zustand
wieder hergestellt worden. Die eindrucksvolle
Altarwand mit Gemälden des Abendmahls und
alttestamentarischen Darstellungen des Malers
Rudolf Schäfer war 1921 zur Erinnerung an im
Ersten Weltkrieg gefallene Kirchenmitglieder an-
gefertigt worden. Bei der Renovierung wurde
zusätzlich der zusammen mit zwei hölzernen
Emporen etwa 1.000 Sitzplätze fassende Raum
durch Einbauten verkleinert, u.a. mit einer mo-
dernen Empore vor dem geschlossenen öst-
lichen Altarraum. Von den Ausstattungsgegen-
ständen der Vorgängerbauten ist das 1901 re-
Soltau, Bahnhofstr. 13, Ev. Kirche St. Johannis, Zeichnung Wendebourg (Kunstdenkmälerinventare, Soltau, S. 56)
novierte, wohl vom Ende des 15.Jh. stammen-
de Altarkruzifix zu besichtigen.
Ab 1850 ist im Nordwesten der Kirche südlich
der Bergstraße und der Ortsdurchfahrt der B 71
nach Rotenburg für den gesamten Stadtbereich
ein neuer Friedhof, der sog. Stadtfriedhof
eingerichtet worden. Der älteste Teil der inzwi-
schen erheblich vergrößerten, winkelförmigen
Anlage mit einer 1950 erbauten Kapelle liegt im
östlichsten Zipfel zwischen Berg- und Seilerstra-
ße. Hier stehen auf einer Grünfläche verteilt be-
merkenswerte Grabmale aus Sandstein sowie
Eisen- und Steinkreuze aus dem 19. bzw. frü-
hen 20.Jh. Bemerkenswert sind auch die von
schmiedeeisernen Zäunen gefassten Familien-
grabstätten einiger für Soltau bedeutender
Familien, wie die der Familie Röder. Eine Reihe
von meist namenlosen Eisenkreuzen des 19.Jh.
sind unabhängig von ihren Gräbern entlang ei-
nes nord-süd-gerichteten, mit alten Alleebäu-
men bewachsenen Geländeabsatzes aufgestellt
worden. Dieser bildet die Grenze zu dem neue-
ren Friedhofsteil, quer zu einer ost-west-gerich-
teten Allee.
In den jüngeren, westlichen Erweiterungsge-
bieten sind mehrere eindrucksvolle Kriegsgrä-
berstätten und Ehrenmale für die Opfer beider
Weltkriege erstellt worden. Weitere Kriegerdenk-
male befinden sich seit 1923 zu Beginn der
Bergstraße sowie in dem vermutlich um 1950
im Nordosten der Stadt im Böhmewald errichte-
ten sog. „Heldenhain“.
Der Jüdische Friedhof ist das einzige Zeugnis
jüdischer Kultur in Soltau. Er liegt im Nordosten
des Stadtzentrums am Rande des Gewerbege-
bietes auf einem Privatgrundstück einer in den
fünfziger Jahren des 20.Jh. bebauten Wohn-
siedlung, Böningweg 7. Die nach der 1938 er-
folgten Schließung stark beschädigten bzw. fast
zerstörten sechs Grabsteine (einer von 1880)
mit verwitterten hebräischen und deutschen
Inschriften stehen heute in einem rechteckig von
einer Hecke umgrenzten, begrünten Areal.
In dem von gepflasterten Straßen durchzogenen
Stadtgebiet östlich der Kirche, das seinen dörf-
lichen Charakter in Teilen noch gewahrt hat, liegt
heute der Schwerpunkt der historischen Bebau-
ung Soltaus. Diese besteht aus zahlreichen
ehemaligen Brinksitzer- bzw. Handwerkerhöfen
aus der Zeit der Wiederbesiedelung im späten
18. und vorwiegend frühen 19.Jh., deren zu-
meist traufständig errichteten Wohn-/Wirt-
schaftsgebäude die Rosen- und Querstraße,
Frieden- und Kirchstraße sowie an der Mühlen-
und Bergstraße begrenzen.
Das Rückgrat der zahlreichen Einzel- und Grup-
pendenkmale bilden die sich kreuzenden Stra-
ßenzüge Rosenstraße und Quergasse. In der
Rosenstraße sind nach Bauarbeiten einige Ab-
schnitte der gewölbten Feldsteinpflasterung in
angepasster Bauweise erneuert worden.
Das auf einem eng bebauten, dreieckigen
Grundstück errichtete Gebäudeensemble zwi-
schen Rosen-, Quer- und Mühlenstraße setzt
sich aus fünf eingeschossigen, traut- und giebel-
ständigen schlichten Ackerbürger- bzw. Hand-
werker-Wohnhäusern zusammen, die hinter
schmalen Vorgärten zurückliegen. Bis auf das
wohl erst gegen Ende des 19.Jh. in Rohziegel-
304
Von einer Johannis dem Täufer geweihten Kir-
che, Bahnhofstraße 13, ist erst in einer Urkun-
de von 1464 die Rede, obwohl eine dem Archi-
diakonat Ahlden im Mindener Bistum angehö-
rende „parochia soltowe“ bereits 1086 und eine
„ecclesia Soltowe“ 1304 bereits Bestand gehabt
haben musste. Wahrscheinlich erfolgte um 1460
ein Kirchenbau, der 1597/98 erweitert worden
war und schließlich 1755 durch einen Neubau
ersetzt wurde, wie aus dem Medaillon im Fron-
tispiz über dem straßenseitigen Kirchenportal
hervorgeht. Lediglich sein erst 1848 mit Elemen-
ten der Spätrenaissance angefügter Turm blieb
bei dem verheerenden Brand von 1906 unver-
sehrt. Dieser erhielt jedoch bei der Wiedererrich-
tung des Gebäudes durch den hannoverschen
Konsistorialbaumeister Eduard Wendebourg ei-
nen neuen, höheren Helm. Der Wiederaufbau
der Saalkirche erfolgte 1907/08 als verputzter
Ziegelbau unter Einbeziehung der erhaltenen
Außenmauern in neubarocker Formensprache
(mit Jugendstilzügen). Das Bauwerk folgte in
seiner Ausprägung den barocken Ursprungsfor-
men des Vorgängergebäudes, einschließlich des
hohen Mansarddaches mit Dachreiter. Durch
den Anbau eines Chores und einer seitlichen
Sakristei war aus der früheren Querkirche trotz
des traufseitig verbliebenen Eingangs ein längs-
ausgerichteter Bau geworden. Zeitgenössisch
sind das Deckengemälde von Carl Wiedehold
sowie Altartisch, Kanzel, Taufstein und die
Emporenbrüstung. Die 1968 neu erbaute Orgel
enthält Teile des Vorgänger-Orgelprospekts. Bei
den 1972/73 erfolgten Renovierungsarbeiten ist
durch eine erneute Verlegung des Altars an die
südliche Längswand der ursprüngliche Zustand
wieder hergestellt worden. Die eindrucksvolle
Altarwand mit Gemälden des Abendmahls und
alttestamentarischen Darstellungen des Malers
Rudolf Schäfer war 1921 zur Erinnerung an im
Ersten Weltkrieg gefallene Kirchenmitglieder an-
gefertigt worden. Bei der Renovierung wurde
zusätzlich der zusammen mit zwei hölzernen
Emporen etwa 1.000 Sitzplätze fassende Raum
durch Einbauten verkleinert, u.a. mit einer mo-
dernen Empore vor dem geschlossenen öst-
lichen Altarraum. Von den Ausstattungsgegen-
ständen der Vorgängerbauten ist das 1901 re-
Soltau, Bahnhofstr. 13, Ev. Kirche St. Johannis, Zeichnung Wendebourg (Kunstdenkmälerinventare, Soltau, S. 56)
novierte, wohl vom Ende des 15.Jh. stammen-
de Altarkruzifix zu besichtigen.
Ab 1850 ist im Nordwesten der Kirche südlich
der Bergstraße und der Ortsdurchfahrt der B 71
nach Rotenburg für den gesamten Stadtbereich
ein neuer Friedhof, der sog. Stadtfriedhof
eingerichtet worden. Der älteste Teil der inzwi-
schen erheblich vergrößerten, winkelförmigen
Anlage mit einer 1950 erbauten Kapelle liegt im
östlichsten Zipfel zwischen Berg- und Seilerstra-
ße. Hier stehen auf einer Grünfläche verteilt be-
merkenswerte Grabmale aus Sandstein sowie
Eisen- und Steinkreuze aus dem 19. bzw. frü-
hen 20.Jh. Bemerkenswert sind auch die von
schmiedeeisernen Zäunen gefassten Familien-
grabstätten einiger für Soltau bedeutender
Familien, wie die der Familie Röder. Eine Reihe
von meist namenlosen Eisenkreuzen des 19.Jh.
sind unabhängig von ihren Gräbern entlang ei-
nes nord-süd-gerichteten, mit alten Alleebäu-
men bewachsenen Geländeabsatzes aufgestellt
worden. Dieser bildet die Grenze zu dem neue-
ren Friedhofsteil, quer zu einer ost-west-gerich-
teten Allee.
In den jüngeren, westlichen Erweiterungsge-
bieten sind mehrere eindrucksvolle Kriegsgrä-
berstätten und Ehrenmale für die Opfer beider
Weltkriege erstellt worden. Weitere Kriegerdenk-
male befinden sich seit 1923 zu Beginn der
Bergstraße sowie in dem vermutlich um 1950
im Nordosten der Stadt im Böhmewald errichte-
ten sog. „Heldenhain“.
Der Jüdische Friedhof ist das einzige Zeugnis
jüdischer Kultur in Soltau. Er liegt im Nordosten
des Stadtzentrums am Rande des Gewerbege-
bietes auf einem Privatgrundstück einer in den
fünfziger Jahren des 20.Jh. bebauten Wohn-
siedlung, Böningweg 7. Die nach der 1938 er-
folgten Schließung stark beschädigten bzw. fast
zerstörten sechs Grabsteine (einer von 1880)
mit verwitterten hebräischen und deutschen
Inschriften stehen heute in einem rechteckig von
einer Hecke umgrenzten, begrünten Areal.
In dem von gepflasterten Straßen durchzogenen
Stadtgebiet östlich der Kirche, das seinen dörf-
lichen Charakter in Teilen noch gewahrt hat, liegt
heute der Schwerpunkt der historischen Bebau-
ung Soltaus. Diese besteht aus zahlreichen
ehemaligen Brinksitzer- bzw. Handwerkerhöfen
aus der Zeit der Wiederbesiedelung im späten
18. und vorwiegend frühen 19.Jh., deren zu-
meist traufständig errichteten Wohn-/Wirt-
schaftsgebäude die Rosen- und Querstraße,
Frieden- und Kirchstraße sowie an der Mühlen-
und Bergstraße begrenzen.
Das Rückgrat der zahlreichen Einzel- und Grup-
pendenkmale bilden die sich kreuzenden Stra-
ßenzüge Rosenstraße und Quergasse. In der
Rosenstraße sind nach Bauarbeiten einige Ab-
schnitte der gewölbten Feldsteinpflasterung in
angepasster Bauweise erneuert worden.
Das auf einem eng bebauten, dreieckigen
Grundstück errichtete Gebäudeensemble zwi-
schen Rosen-, Quer- und Mühlenstraße setzt
sich aus fünf eingeschossigen, traut- und giebel-
ständigen schlichten Ackerbürger- bzw. Hand-
werker-Wohnhäusern zusammen, die hinter
schmalen Vorgärten zurückliegen. Bis auf das
wohl erst gegen Ende des 19.Jh. in Rohziegel-
304