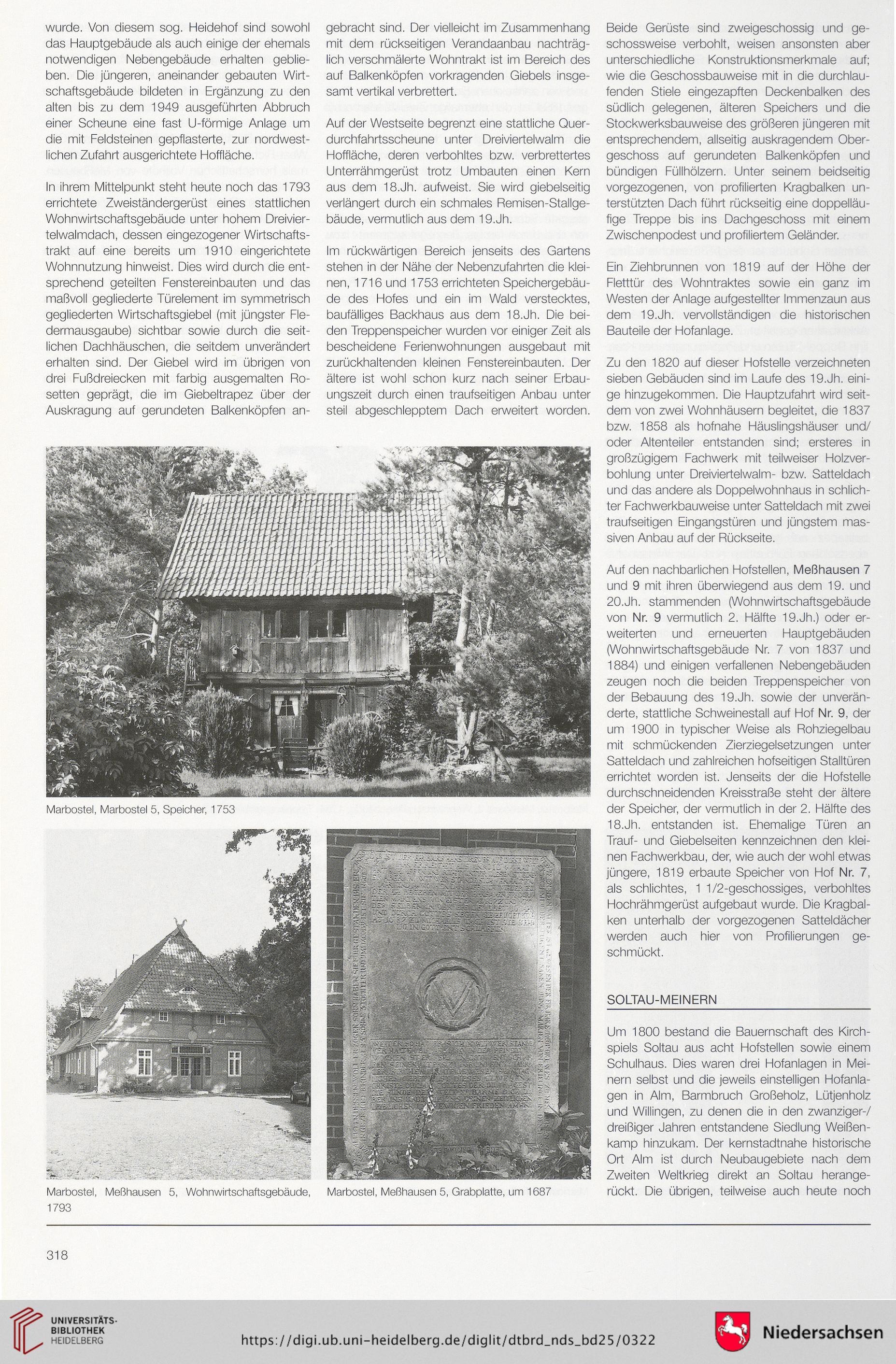wurde. Von diesem sog. Heidehof sind sowohl
das Hauptgebäude als auch einige der ehemals
notwendigen Nebengebäude erhalten geblie-
ben. Die jüngeren, aneinander gebauten Wirt-
schaftsgebäude bildeten in Ergänzung zu den
alten bis zu dem 1949 ausgeführten Abbruch
einer Scheune eine fast U-förmige Anlage um
die mit Feldsteinen gepflasterte, zur nordwest-
lichen Zufahrt ausgerichtete Hoffläche.
In ihrem Mittelpunkt steht heute noch das 1793
errichtete Zweiständergerüst eines stattlichen
Wohnwirtschaftsgebäude unter hohem Dreivier-
telwalmdach, dessen eingezogener Wirtschafts-
trakt auf eine bereits um 1910 eingerichtete
Wohnnutzung hinweist. Dies wird durch die ent-
sprechend geteilten Fenstereinbauten und das
maßvoll gegliederte Türelement im symmetrisch
gegliederten Wirtschaftsgiebel (mit jüngster Fle-
dermausgaube) sichtbar sowie durch die seit-
lichen Dachhäuschen, die seitdem unverändert
erhalten sind. Der Giebel wird im übrigen von
drei Fußdreiecken mit farbig ausgemalten Ro-
setten geprägt, die im Giebeltrapez über der
Auskragung auf gerundeten Balkenköpfen an-
gebracht sind. Der vielleicht im Zusammenhang
mit dem rückseitigen Verandaanbau nachträg-
lich verschmälerte Wohntrakt ist im Bereich des
auf Balkenköpfen vorkragenden Giebels insge-
samt vertikal verbreitert.
Auf der Westseite begrenzt eine stattliche Quer-
durchfahrtsscheune unter Dreiviertelwalm die
Hoffläche, deren verbohltes bzw. verbreitertes
Unterrähmgerüst trotz Umbauten einen Kern
aus dem 18.Jh. aufweist. Sie wird giebelseitig
verlängert durch ein schmales Remisen-Stallge-
bäude, vermutlich aus dem 19.Jh.
Im rückwärtigen Bereich jenseits des Gartens
stehen in der Nähe der Nebenzufahrten die klei-
nen, 1716 und 1753 errichteten Speichergebäu-
de des Hofes und ein im Wald verstecktes,
baufälliges Backhaus aus dem 18.Jh. Die bei-
den Treppenspeicher wurden vor einiger Zeit als
bescheidene Ferienwohnungen ausgebaut mit
zurückhaltenden kleinen Fenstereinbauten. Der
ältere ist wohl schon kurz nach seiner Erbau-
ungszeit durch einen traufseitigen Anbau unter
steil abgeschlepptem Dach erweitert worden.
Marbostel, Marbostel 5, Speicher, 1753
Beide Gerüste sind zweigeschossig und ge-
schossweise verbohlt, weisen ansonsten aber
unterschiedliche Konstruktionsmerkmale auf;
wie die Geschossbauweise mit in die durchlau-
fenden Stiele eingezapften Deckenbalken des
südlich gelegenen, älteren Speichers und die
Stockwerksbauweise des größeren jüngeren mit
entsprechendem, allseitig auskragendem Ober-
geschoss auf gerundeten Balkenköpfen und
bündigen Füllhölzern. Unter seinem beidseitig
vorgezogenen, von profilierten Kragbalken un-
terstützten Dach führt rückseitig eine doppelläu-
fige Treppe bis ins Dachgeschoss mit einem
Zwischenpodest und profiliertem Geländer.
Ein Ziehbrunnen von 1819 auf der Höhe der
Fletttür des Wohntraktes sowie ein ganz im
Westen der Anlage aufgestellter Immenzaun aus
dem 19.Jh. vervollständigen die historischen
Bauteile der Hofanlage.
Zu den 1820 auf dieser Hofstelle verzeichneten
sieben Gebäuden sind im Laufe des 19.Jh. eini-
ge hinzugekommen. Die Hauptzufahrt wird seit-
dem von zwei Wohnhäusern begleitet, die 1837
bzw. 1858 als hofnahe Häuslingshäuser und/
oder Altenteiler entstanden sind; ersteres in
großzügigem Fachwerk mit teilweiser Holzver-
bohlung unter Dreiviertelwalm- bzw. Satteldach
und das andere als Doppelwohnhaus in schlich-
ter Fachwerkbauweise unter Satteldach mit zwei
traufseitigen Eingangstüren und jüngstem mas-
siven Anbau auf der Rückseite.
Auf den nachbarlichen Hofstellen, Meßhausen 7
und 9 mit ihren überwiegend aus dem 19. und
20.Jh. stammenden (Wohnwirtschaftsgebäude
von Nr. 9 vermutlich 2. Hälfte 19.Jh.) oder er-
weiterten und erneuerten Hauptgebäuden
(Wohnwirtschaftsgebäude Nr. 7 von 1837 und
1884) und einigen verfallenen Nebengebäuden
zeugen noch die beiden Treppenspeicher von
der Bebauung des 19.Jh. sowie der unverän-
derte, stattliche Schweinestall auf Hof Nr. 9, der
um 1900 in typischer Weise als Rohziegelbau
mit schmückenden Zierziegelsetzungen unter
Satteldach und zahlreichen hofseitigen Stalltüren
errichtet worden ist. Jenseits der die Hofstelle
durchschneidenden Kreisstraße steht der ältere
der Speicher, der vermutlich in der 2. Hälfte des
18.Jh. entstanden ist. Ehemalige Türen an
Trauf- und Giebelseiten kennzeichnen den klei-
nen Fachwerkbau, der, wie auch der wohl etwas
jüngere, 1819 erbaute Speicher von Hof Nr. 7,
als schlichtes, 1 1/2-geschossiges, verbohltes
Hochrähmgerüst aufgebaut wurde. Die Kragbal-
ken unterhalb der vorgezogenen Satteldächer
werden auch hier von Profilierungen ge-
schmückt.
SOLTAU-MEINERN
Um 1800 bestand die Bauernschaft des Kirch-
spiels Soltau aus acht Hofstellen sowie einem
Schulhaus. Dies waren drei Hofanlagen in Mei-
nem selbst und die jeweils einstelligen Hofanla-
gen in Alm, Barmbruch Großeholz, Lütjenholz
und Willingen, zu denen die in den zwanziger-/
dreißiger Jahren entstandene Siedlung Weißen-
kamp hinzukam. Der kernstadtnahe historische
Ort Alm ist durch Neubaugebiete nach dem
Zweiten Weltkrieg direkt an Soltau herange-
rückt. Die übrigen, teilweise auch heute noch
318
das Hauptgebäude als auch einige der ehemals
notwendigen Nebengebäude erhalten geblie-
ben. Die jüngeren, aneinander gebauten Wirt-
schaftsgebäude bildeten in Ergänzung zu den
alten bis zu dem 1949 ausgeführten Abbruch
einer Scheune eine fast U-förmige Anlage um
die mit Feldsteinen gepflasterte, zur nordwest-
lichen Zufahrt ausgerichtete Hoffläche.
In ihrem Mittelpunkt steht heute noch das 1793
errichtete Zweiständergerüst eines stattlichen
Wohnwirtschaftsgebäude unter hohem Dreivier-
telwalmdach, dessen eingezogener Wirtschafts-
trakt auf eine bereits um 1910 eingerichtete
Wohnnutzung hinweist. Dies wird durch die ent-
sprechend geteilten Fenstereinbauten und das
maßvoll gegliederte Türelement im symmetrisch
gegliederten Wirtschaftsgiebel (mit jüngster Fle-
dermausgaube) sichtbar sowie durch die seit-
lichen Dachhäuschen, die seitdem unverändert
erhalten sind. Der Giebel wird im übrigen von
drei Fußdreiecken mit farbig ausgemalten Ro-
setten geprägt, die im Giebeltrapez über der
Auskragung auf gerundeten Balkenköpfen an-
gebracht sind. Der vielleicht im Zusammenhang
mit dem rückseitigen Verandaanbau nachträg-
lich verschmälerte Wohntrakt ist im Bereich des
auf Balkenköpfen vorkragenden Giebels insge-
samt vertikal verbreitert.
Auf der Westseite begrenzt eine stattliche Quer-
durchfahrtsscheune unter Dreiviertelwalm die
Hoffläche, deren verbohltes bzw. verbreitertes
Unterrähmgerüst trotz Umbauten einen Kern
aus dem 18.Jh. aufweist. Sie wird giebelseitig
verlängert durch ein schmales Remisen-Stallge-
bäude, vermutlich aus dem 19.Jh.
Im rückwärtigen Bereich jenseits des Gartens
stehen in der Nähe der Nebenzufahrten die klei-
nen, 1716 und 1753 errichteten Speichergebäu-
de des Hofes und ein im Wald verstecktes,
baufälliges Backhaus aus dem 18.Jh. Die bei-
den Treppenspeicher wurden vor einiger Zeit als
bescheidene Ferienwohnungen ausgebaut mit
zurückhaltenden kleinen Fenstereinbauten. Der
ältere ist wohl schon kurz nach seiner Erbau-
ungszeit durch einen traufseitigen Anbau unter
steil abgeschlepptem Dach erweitert worden.
Marbostel, Marbostel 5, Speicher, 1753
Beide Gerüste sind zweigeschossig und ge-
schossweise verbohlt, weisen ansonsten aber
unterschiedliche Konstruktionsmerkmale auf;
wie die Geschossbauweise mit in die durchlau-
fenden Stiele eingezapften Deckenbalken des
südlich gelegenen, älteren Speichers und die
Stockwerksbauweise des größeren jüngeren mit
entsprechendem, allseitig auskragendem Ober-
geschoss auf gerundeten Balkenköpfen und
bündigen Füllhölzern. Unter seinem beidseitig
vorgezogenen, von profilierten Kragbalken un-
terstützten Dach führt rückseitig eine doppelläu-
fige Treppe bis ins Dachgeschoss mit einem
Zwischenpodest und profiliertem Geländer.
Ein Ziehbrunnen von 1819 auf der Höhe der
Fletttür des Wohntraktes sowie ein ganz im
Westen der Anlage aufgestellter Immenzaun aus
dem 19.Jh. vervollständigen die historischen
Bauteile der Hofanlage.
Zu den 1820 auf dieser Hofstelle verzeichneten
sieben Gebäuden sind im Laufe des 19.Jh. eini-
ge hinzugekommen. Die Hauptzufahrt wird seit-
dem von zwei Wohnhäusern begleitet, die 1837
bzw. 1858 als hofnahe Häuslingshäuser und/
oder Altenteiler entstanden sind; ersteres in
großzügigem Fachwerk mit teilweiser Holzver-
bohlung unter Dreiviertelwalm- bzw. Satteldach
und das andere als Doppelwohnhaus in schlich-
ter Fachwerkbauweise unter Satteldach mit zwei
traufseitigen Eingangstüren und jüngstem mas-
siven Anbau auf der Rückseite.
Auf den nachbarlichen Hofstellen, Meßhausen 7
und 9 mit ihren überwiegend aus dem 19. und
20.Jh. stammenden (Wohnwirtschaftsgebäude
von Nr. 9 vermutlich 2. Hälfte 19.Jh.) oder er-
weiterten und erneuerten Hauptgebäuden
(Wohnwirtschaftsgebäude Nr. 7 von 1837 und
1884) und einigen verfallenen Nebengebäuden
zeugen noch die beiden Treppenspeicher von
der Bebauung des 19.Jh. sowie der unverän-
derte, stattliche Schweinestall auf Hof Nr. 9, der
um 1900 in typischer Weise als Rohziegelbau
mit schmückenden Zierziegelsetzungen unter
Satteldach und zahlreichen hofseitigen Stalltüren
errichtet worden ist. Jenseits der die Hofstelle
durchschneidenden Kreisstraße steht der ältere
der Speicher, der vermutlich in der 2. Hälfte des
18.Jh. entstanden ist. Ehemalige Türen an
Trauf- und Giebelseiten kennzeichnen den klei-
nen Fachwerkbau, der, wie auch der wohl etwas
jüngere, 1819 erbaute Speicher von Hof Nr. 7,
als schlichtes, 1 1/2-geschossiges, verbohltes
Hochrähmgerüst aufgebaut wurde. Die Kragbal-
ken unterhalb der vorgezogenen Satteldächer
werden auch hier von Profilierungen ge-
schmückt.
SOLTAU-MEINERN
Um 1800 bestand die Bauernschaft des Kirch-
spiels Soltau aus acht Hofstellen sowie einem
Schulhaus. Dies waren drei Hofanlagen in Mei-
nem selbst und die jeweils einstelligen Hofanla-
gen in Alm, Barmbruch Großeholz, Lütjenholz
und Willingen, zu denen die in den zwanziger-/
dreißiger Jahren entstandene Siedlung Weißen-
kamp hinzukam. Der kernstadtnahe historische
Ort Alm ist durch Neubaugebiete nach dem
Zweiten Weltkrieg direkt an Soltau herange-
rückt. Die übrigen, teilweise auch heute noch
318