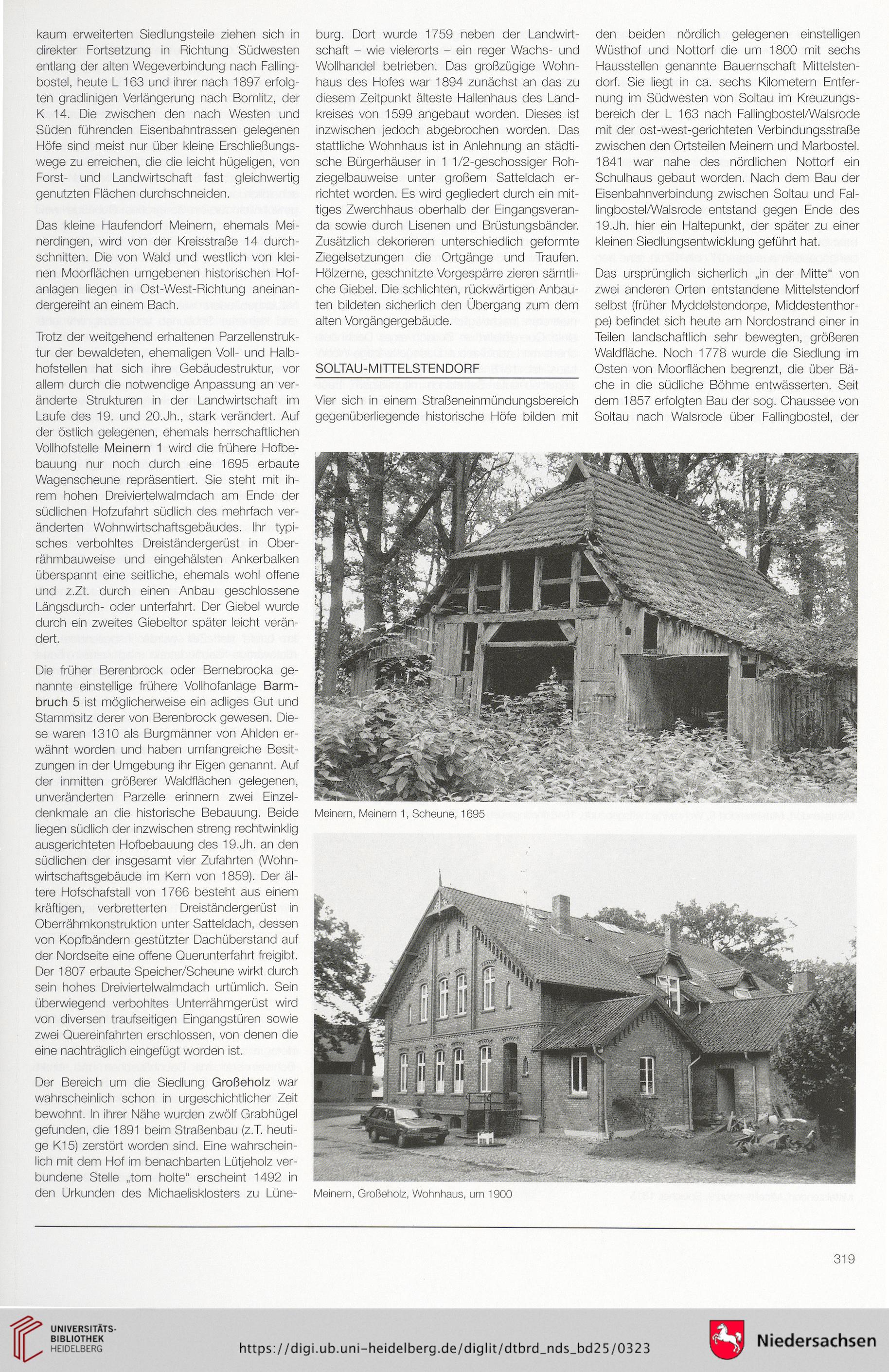kaum erweiterten Siedlungsteile ziehen sich in
direkter Fortsetzung in Richtung Südwesten
entlang der alten Wegeverbindung nach Falling-
bostel, heute L 163 und ihrer nach 1897 erfolg-
ten gradlinigen Verlängerung nach Bomlitz, der
K 14. Die zwischen den nach Westen und
Süden führenden Eisenbahntrassen gelegenen
Höfe sind meist nur über kleine Erschließungs-
wege zu erreichen, die die leicht hügeligen, von
Forst- und Landwirtschaft fast gleichwertig
genutzten Flächen durchschneiden.
Das kleine Haufendorf Meinem, ehemals Mei-
nerdingen, wird von der Kreisstraße 14 durch-
schnitten. Die von Wald und westlich von klei-
nen Moorflächen umgebenen historischen Hof-
anlagen liegen in Ost-West-Richtung aneinan-
dergereiht an einem Bach.
Trotz der weitgehend erhaltenen Parzellenstruk-
tur der bewaldeten, ehemaligen Voll- und Halb-
hofstellen hat sich ihre Gebäudestruktur, vor
allem durch die notwendige Anpassung an ver-
änderte Strukturen in der Landwirtschaft im
Laufe des 19. und 20.Jh., stark verändert. Auf
der östlich gelegenen, ehemals herrschaftlichen
Vollhofstelle Meinem 1 wird die frühere Hofbe-
bauung nur noch durch eine 1695 erbaute
Wagenscheune repräsentiert. Sie steht mit ih-
rem hohen Dreiviertelwalmdach am Ende der
südlichen Hofzufahrt südlich des mehrfach ver-
änderten Wohnwirtschaftsgebäudes. Ihr typi-
sches verbohltes Dreiständergerüst in Ober-
rähmbauweise und eingehälsten Ankerbalken
überspannt eine seitliche, ehemals wohl offene
und z.Zt. durch einen Anbau geschlossene
Längsdurch- oder unterfahrt. Der Giebel wurde
durch ein zweites Giebeltor später leicht verän-
dert.
Die früher Berenbrock oder Bernebrocka ge-
nannte einstellige frühere Vollhofanlage Barm-
bruch 5 ist möglicherweise ein adliges Gut und
Stammsitz derer von Berenbrock gewesen. Die-
se waren 1310 als Burgmänner von Ahlden er-
wähnt worden und haben umfangreiche Besit-
zungen in der Umgebung ihr Eigen genannt. Auf
der inmitten größerer Waldflächen gelegenen,
unveränderten Parzelle erinnern zwei Einzel-
denkmale an die historische Bebauung. Beide
liegen südlich der inzwischen streng rechtwinklig
ausgerichteten Hofbebauung des 19.Jh. an den
südlichen der insgesamt vier Zufahrten (Wohn-
wirtschaftsgebäude im Kern von 1859). Der äl-
tere Hofschafstall von 1766 besteht aus einem
kräftigen, verbreiterten Dreiständergerüst in
Oberrähmkonstruktion unter Satteldach, dessen
von Kopfbändern gestützter Dachüberstand auf
der Nordseite eine offene Querunterfahrt freigibt.
Der 1807 erbaute Speicher/Scheune wirkt durch
sein hohes Dreiviertelwalmdach urtümlich. Sein
überwiegend verbohltes Unterrähmgerüst wird
von diversen traufseitigen Eingangstüren sowie
zwei Quereinfahrten erschlossen, von denen die
eine nachträglich eingefügt worden ist.
Der Bereich um die Siedlung Großeholz war
wahrscheinlich schon in urgeschichtlicher Zeit
bewohnt. In ihrer Nähe wurden zwölf Grabhügel
gefunden, die 1891 beim Straßenbau (z.T. heuti-
ge Kl 5) zerstört worden sind. Eine wahrschein-
lich mit dem Hof im benachbarten Lütjeholz ver-
bundene Stelle „tom holte“ erscheint 1492 in
den Urkunden des Michaelisklosters zu Lüne-
burg. Dort wurde 1759 neben der Landwirt-
schaft - wie vielerorts - ein reger Wachs- und
Wollhandel betrieben. Das großzügige Wohn-
haus des Hofes war 1894 zunächst an das zu
diesem Zeitpunkt älteste Hallenhaus des Land-
kreises von 1599 angebaut worden. Dieses ist
inzwischen jedoch abgebrochen worden. Das
stattliche Wohnhaus ist in Anlehnung an städti-
sche Bürgerhäuser in 1 1/2-geschossiger Roh-
ziegelbauweise unter großem Satteldach er-
richtet worden. Es wird gegliedert durch ein mit-
tiges Zwerchhaus oberhalb der Eingangsveran-
da sowie durch Lisenen und Brüstungsbänder.
Zusätzlich dekorieren unterschiedlich geformte
Ziegelsetzungen die Ortgänge und Traufen.
Hölzerne, geschnitzte Vorgespärre zieren sämtli-
che Giebel. Die schlichten, rückwärtigen Anbau-
ten bildeten sicherlich den Übergang zum dem
alten Vorgängergebäude.
SOLTAU-MITTELSTENDORF
Vier sich in einem Straßeneinmündungsbereich
gegenüberliegende historische Höfe bilden mit
den beiden nördlich gelegenen einstelligen
Wüsthof und Nottorf die um 1800 mit sechs
Hausstellen genannte Bauernschaft Mittelsten-
dorf. Sie liegt in ca. sechs Kilometern Entfer-
nung im Südwesten von Soltau im Kreuzungs-
bereich der L 163 nach Fallingbostel/Walsrode
mit der ost-west-gerichteten Verbindungsstraße
zwischen den Ortsteilen Meinem und Marbostel.
1841 war nahe des nördlichen Nottorf ein
Schulhaus gebaut worden. Nach dem Bau der
Eisenbahnverbindung zwischen Soltau und Fal-
lingbostel/Walsrode entstand gegen Ende des
19.Jh. hier ein Haltepunkt, der später zu einer
kleinen Siedlungsentwicklung geführt hat.
Das ursprünglich sicherlich „in der Mitte“ von
zwei anderen Orten entstandene Mittelstendorf
selbst (früher Myddelstendorpe, Middestenthor-
pe) befindet sich heute am Nordostrand einer in
Teilen landschaftlich sehr bewegten, größeren
Waldfläche. Noch 1778 wurde die Siedlung im
Osten von Moorflächen begrenzt, die über Bä-
che in die südliche Böhme entwässerten. Seit
dem 1857 erfolgten Bau der sog. Chaussee von
Soltau nach Walsrode über Fallingbostel, der
Meinem, Meinem 1, Scheune, 1695
Meinem, Großeholz, Wohnhaus, um 1900
319
direkter Fortsetzung in Richtung Südwesten
entlang der alten Wegeverbindung nach Falling-
bostel, heute L 163 und ihrer nach 1897 erfolg-
ten gradlinigen Verlängerung nach Bomlitz, der
K 14. Die zwischen den nach Westen und
Süden führenden Eisenbahntrassen gelegenen
Höfe sind meist nur über kleine Erschließungs-
wege zu erreichen, die die leicht hügeligen, von
Forst- und Landwirtschaft fast gleichwertig
genutzten Flächen durchschneiden.
Das kleine Haufendorf Meinem, ehemals Mei-
nerdingen, wird von der Kreisstraße 14 durch-
schnitten. Die von Wald und westlich von klei-
nen Moorflächen umgebenen historischen Hof-
anlagen liegen in Ost-West-Richtung aneinan-
dergereiht an einem Bach.
Trotz der weitgehend erhaltenen Parzellenstruk-
tur der bewaldeten, ehemaligen Voll- und Halb-
hofstellen hat sich ihre Gebäudestruktur, vor
allem durch die notwendige Anpassung an ver-
änderte Strukturen in der Landwirtschaft im
Laufe des 19. und 20.Jh., stark verändert. Auf
der östlich gelegenen, ehemals herrschaftlichen
Vollhofstelle Meinem 1 wird die frühere Hofbe-
bauung nur noch durch eine 1695 erbaute
Wagenscheune repräsentiert. Sie steht mit ih-
rem hohen Dreiviertelwalmdach am Ende der
südlichen Hofzufahrt südlich des mehrfach ver-
änderten Wohnwirtschaftsgebäudes. Ihr typi-
sches verbohltes Dreiständergerüst in Ober-
rähmbauweise und eingehälsten Ankerbalken
überspannt eine seitliche, ehemals wohl offene
und z.Zt. durch einen Anbau geschlossene
Längsdurch- oder unterfahrt. Der Giebel wurde
durch ein zweites Giebeltor später leicht verän-
dert.
Die früher Berenbrock oder Bernebrocka ge-
nannte einstellige frühere Vollhofanlage Barm-
bruch 5 ist möglicherweise ein adliges Gut und
Stammsitz derer von Berenbrock gewesen. Die-
se waren 1310 als Burgmänner von Ahlden er-
wähnt worden und haben umfangreiche Besit-
zungen in der Umgebung ihr Eigen genannt. Auf
der inmitten größerer Waldflächen gelegenen,
unveränderten Parzelle erinnern zwei Einzel-
denkmale an die historische Bebauung. Beide
liegen südlich der inzwischen streng rechtwinklig
ausgerichteten Hofbebauung des 19.Jh. an den
südlichen der insgesamt vier Zufahrten (Wohn-
wirtschaftsgebäude im Kern von 1859). Der äl-
tere Hofschafstall von 1766 besteht aus einem
kräftigen, verbreiterten Dreiständergerüst in
Oberrähmkonstruktion unter Satteldach, dessen
von Kopfbändern gestützter Dachüberstand auf
der Nordseite eine offene Querunterfahrt freigibt.
Der 1807 erbaute Speicher/Scheune wirkt durch
sein hohes Dreiviertelwalmdach urtümlich. Sein
überwiegend verbohltes Unterrähmgerüst wird
von diversen traufseitigen Eingangstüren sowie
zwei Quereinfahrten erschlossen, von denen die
eine nachträglich eingefügt worden ist.
Der Bereich um die Siedlung Großeholz war
wahrscheinlich schon in urgeschichtlicher Zeit
bewohnt. In ihrer Nähe wurden zwölf Grabhügel
gefunden, die 1891 beim Straßenbau (z.T. heuti-
ge Kl 5) zerstört worden sind. Eine wahrschein-
lich mit dem Hof im benachbarten Lütjeholz ver-
bundene Stelle „tom holte“ erscheint 1492 in
den Urkunden des Michaelisklosters zu Lüne-
burg. Dort wurde 1759 neben der Landwirt-
schaft - wie vielerorts - ein reger Wachs- und
Wollhandel betrieben. Das großzügige Wohn-
haus des Hofes war 1894 zunächst an das zu
diesem Zeitpunkt älteste Hallenhaus des Land-
kreises von 1599 angebaut worden. Dieses ist
inzwischen jedoch abgebrochen worden. Das
stattliche Wohnhaus ist in Anlehnung an städti-
sche Bürgerhäuser in 1 1/2-geschossiger Roh-
ziegelbauweise unter großem Satteldach er-
richtet worden. Es wird gegliedert durch ein mit-
tiges Zwerchhaus oberhalb der Eingangsveran-
da sowie durch Lisenen und Brüstungsbänder.
Zusätzlich dekorieren unterschiedlich geformte
Ziegelsetzungen die Ortgänge und Traufen.
Hölzerne, geschnitzte Vorgespärre zieren sämtli-
che Giebel. Die schlichten, rückwärtigen Anbau-
ten bildeten sicherlich den Übergang zum dem
alten Vorgängergebäude.
SOLTAU-MITTELSTENDORF
Vier sich in einem Straßeneinmündungsbereich
gegenüberliegende historische Höfe bilden mit
den beiden nördlich gelegenen einstelligen
Wüsthof und Nottorf die um 1800 mit sechs
Hausstellen genannte Bauernschaft Mittelsten-
dorf. Sie liegt in ca. sechs Kilometern Entfer-
nung im Südwesten von Soltau im Kreuzungs-
bereich der L 163 nach Fallingbostel/Walsrode
mit der ost-west-gerichteten Verbindungsstraße
zwischen den Ortsteilen Meinem und Marbostel.
1841 war nahe des nördlichen Nottorf ein
Schulhaus gebaut worden. Nach dem Bau der
Eisenbahnverbindung zwischen Soltau und Fal-
lingbostel/Walsrode entstand gegen Ende des
19.Jh. hier ein Haltepunkt, der später zu einer
kleinen Siedlungsentwicklung geführt hat.
Das ursprünglich sicherlich „in der Mitte“ von
zwei anderen Orten entstandene Mittelstendorf
selbst (früher Myddelstendorpe, Middestenthor-
pe) befindet sich heute am Nordostrand einer in
Teilen landschaftlich sehr bewegten, größeren
Waldfläche. Noch 1778 wurde die Siedlung im
Osten von Moorflächen begrenzt, die über Bä-
che in die südliche Böhme entwässerten. Seit
dem 1857 erfolgten Bau der sog. Chaussee von
Soltau nach Walsrode über Fallingbostel, der
Meinem, Meinem 1, Scheune, 1695
Meinem, Großeholz, Wohnhaus, um 1900
319