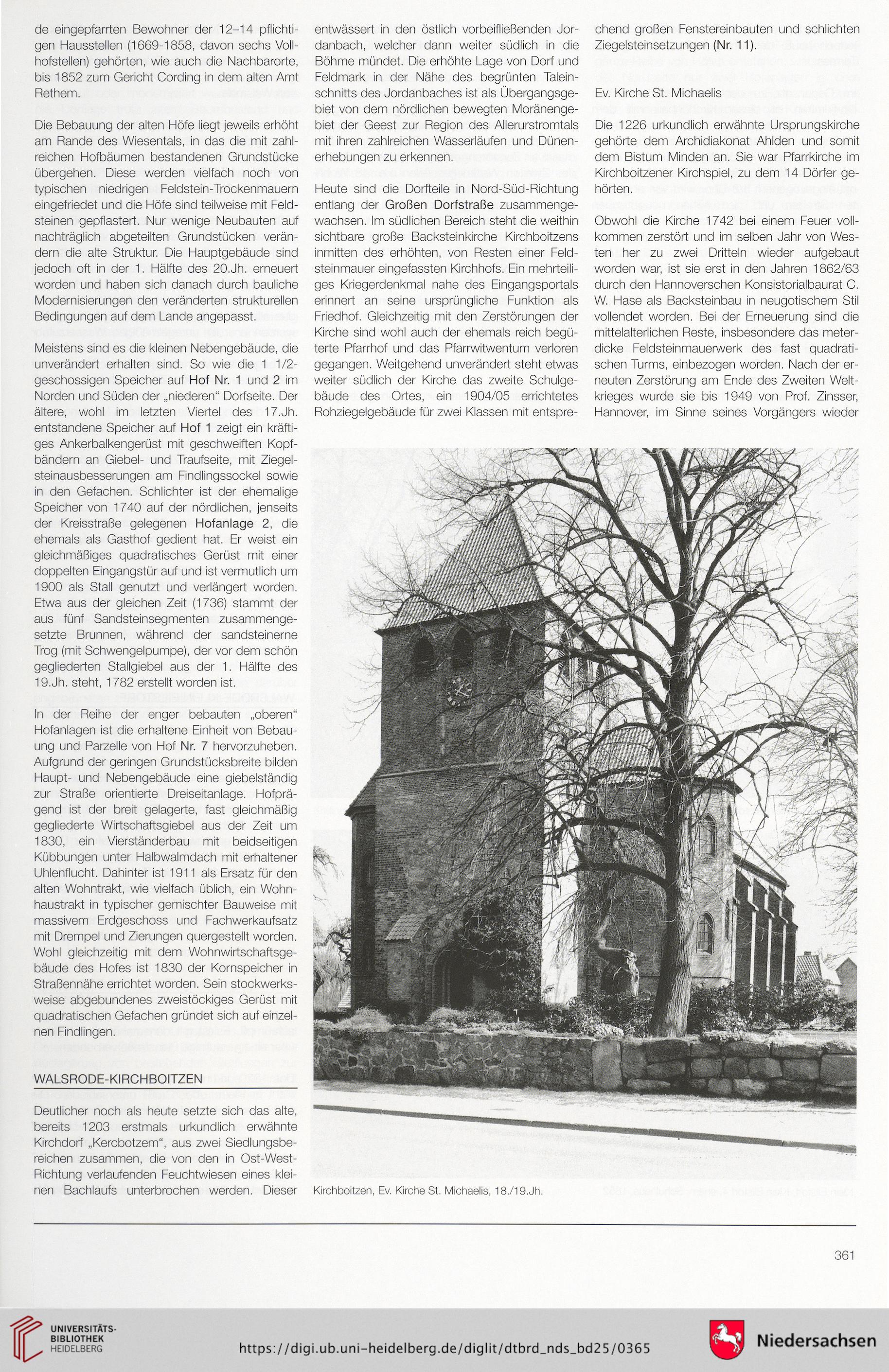de eingepfarrten Bewohner der 12-14 pflichti-
gen Hausstellen (1669-1858, davon sechs Voll-
hofstellen) gehörten, wie auch die Nachbarorte,
bis 1852 zum Gericht Cording in dem alten Amt
Rethem.
Die Bebauung der alten Höfe liegt jeweils erhöht
am Rande des Wiesentals, in das die mit zahl-
reichen Hofbäumen bestandenen Grundstücke
übergehen. Diese werden vielfach noch von
typischen niedrigen Feldstein-Trockenmauern
eingefriedet und die Höfe sind teilweise mit Feld-
steinen gepflastert. Nur wenige Neubauten auf
nachträglich abgeteilten Grundstücken verän-
dern die alte Struktur. Die Hauptgebäude sind
jedoch oft in der 1. Hälfte des 20.Jh. erneuert
worden und haben sich danach durch bauliche
Modernisierungen den veränderten strukturellen
Bedingungen auf dem Lande angepasst.
Meistens sind es die kleinen Nebengebäude, die
unverändert erhalten sind. So wie die 1 1/2-
geschossigen Speicher auf Hof Nr. 1 und 2 im
Norden und Süden der „niederen“ Dorfseite. Der
ältere, wohl im letzten Viertel des 17.Jh.
entstandene Speicher auf Hof 1 zeigt ein kräfti-
ges Ankerbalkengerüst mit geschweiften Kopf-
bändern an Giebel- und Traufseite, mit Ziegel-
steinausbesserungen am Findlingssockel sowie
in den Gefachen. Schlichter ist der ehemalige
Speicher von 1740 auf der nördlichen, jenseits
der Kreisstraße gelegenen Hofanlage 2, die
ehemals als Gasthof gedient hat. Er weist ein
gleichmäßiges quadratisches Gerüst mit einer
doppelten Eingangstür auf und ist vermutlich um
1900 als Stall genutzt und verlängert worden.
Etwa aus der gleichen Zeit (1736) stammt der
aus fünf Sandsteinsegmenten zusammenge-
setzte Brunnen, während der sandsteinerne
Trog (mit Schwengelpumpe), der vor dem schön
gegliederten Stallgiebel aus der 1. Hälfte des
19.Jh. steht, 1782 erstellt worden ist.
In der Reihe der enger bebauten „oberen“
Hofanlagen ist die erhaltene Einheit von Bebau-
ung und Parzelle von Hof Nr. 7 hervorzuheben.
Aufgrund der geringen Grundstücksbreite bilden
Haupt- und Nebengebäude eine giebelständig
zur Straße orientierte Dreiseitanlage. Hofprä-
gend ist der breit gelagerte, fast gleichmäßig
gegliederte Wirtschaftsgiebel aus der Zeit um
1830, ein Vierständerbau mit beidseitigen
Kübbungen unter Halbwalmdach mit erhaltener
Uhlenflucht. Dahinter ist 1911 als Ersatz für den
alten Wohntrakt, wie vielfach üblich, ein Wohn-
haustrakt in typischer gemischter Bauweise mit
massivem Erdgeschoss und Fachwerkaufsatz
mit Drempel und Zierungen quergestellt worden.
Wohl gleichzeitig mit dem Wohnwirtschaftsge-
bäude des Hofes ist 1830 der Kornspeicher in
Straßennähe errichtet worden. Sein stockwerks-
weise abgebundenes zweistöckiges Gerüst mit
quadratischen Gefachen gründet sich auf einzel-
nen Findlingen.
WALSRODE-KIRCHBOITZEN
Deutlicher noch als heute setzte sich das alte,
bereits 1203 erstmals urkundlich erwähnte
Kirchdorf „Kercbotzem“, aus zwei Siedlungsbe-
reichen zusammen, die von den in Ost-West-
Richtung verlaufenden Feuchtwiesen eines klei-
nen Bachlaufs unterbrochen werden. Dieser
entwässert in den östlich vorbeifließenden Jor-
danbach, welcher dann weiter südlich in die
Böhme mündet. Die erhöhte Lage von Dorf und
Feldmark in der Nähe des begrünten Talein-
schnitts des Jordanbaches ist als Übergangsge-
biet von dem nördlichen bewegten Moränenge-
biet der Geest zur Region des Allerurstromtals
mit ihren zahlreichen Wasserläufen und Dünen-
erhebungen zu erkennen.
Heute sind die Dorfteile in Nord-Süd-Richtung
entlang der Großen Dorfstraße zusammenge-
wachsen. Im südlichen Bereich steht die weithin
sichtbare große Backsteinkirche Kirchboitzens
inmitten des erhöhten, von Resten einer Feld-
steinmauer eingefassten Kirchhofs. Ein mehrteili-
ges Kriegerdenkmal nahe des Eingangsportals
erinnert an seine ursprüngliche Funktion als
Friedhof. Gleichzeitig mit den Zerstörungen der
Kirche sind wohl auch der ehemals reich begü-
terte Pfarrhof und das Pfarrwitwentum verloren
gegangen. Weitgehend unverändert steht etwas
weiter südlich der Kirche das zweite Schulge-
bäude des Ortes, ein 1904/05 errichtetes
Rohziegelgebäude für zwei Klassen mit entspre-
chend großen Fenstereinbauten und schlichten
Ziegelsteinsetzungen (Nr. 11).
Ev. Kirche St. Michaelis
Die 1226 urkundlich erwähnte Ursprungskirche
gehörte dem Archidiakonat Ahlden und somit
dem Bistum Minden an. Sie war Pfarrkirche im
Kirchboitzener Kirchspiel, zu dem 14 Dörfer ge-
hörten.
Obwohl die Kirche 1742 bei einem Feuer voll-
kommen zerstört und im selben Jahr von Wes-
ten her zu zwei Dritteln wieder aufgebaut
worden war, ist sie erst in den Jahren 1862/63
durch den Hannoverschen Konsistorialbaurat C.
W. Hase als Backsteinbau in neugotischem Stil
vollendet worden. Bei der Erneuerung sind die
mittelalterlichen Reste, insbesondere das meter-
dicke Feldsteinmauerwerk des fast quadrati-
schen Turms, einbezogen worden. Nach der er-
neuten Zerstörung am Ende des Zweiten Welt-
krieges wurde sie bis 1949 von Prof. Zinsser,
Hannover, im Sinne seines Vorgängers wieder
Kirchboitzen, Ev. Kirche St. Michaelis, 18./19.Jh.
361
gen Hausstellen (1669-1858, davon sechs Voll-
hofstellen) gehörten, wie auch die Nachbarorte,
bis 1852 zum Gericht Cording in dem alten Amt
Rethem.
Die Bebauung der alten Höfe liegt jeweils erhöht
am Rande des Wiesentals, in das die mit zahl-
reichen Hofbäumen bestandenen Grundstücke
übergehen. Diese werden vielfach noch von
typischen niedrigen Feldstein-Trockenmauern
eingefriedet und die Höfe sind teilweise mit Feld-
steinen gepflastert. Nur wenige Neubauten auf
nachträglich abgeteilten Grundstücken verän-
dern die alte Struktur. Die Hauptgebäude sind
jedoch oft in der 1. Hälfte des 20.Jh. erneuert
worden und haben sich danach durch bauliche
Modernisierungen den veränderten strukturellen
Bedingungen auf dem Lande angepasst.
Meistens sind es die kleinen Nebengebäude, die
unverändert erhalten sind. So wie die 1 1/2-
geschossigen Speicher auf Hof Nr. 1 und 2 im
Norden und Süden der „niederen“ Dorfseite. Der
ältere, wohl im letzten Viertel des 17.Jh.
entstandene Speicher auf Hof 1 zeigt ein kräfti-
ges Ankerbalkengerüst mit geschweiften Kopf-
bändern an Giebel- und Traufseite, mit Ziegel-
steinausbesserungen am Findlingssockel sowie
in den Gefachen. Schlichter ist der ehemalige
Speicher von 1740 auf der nördlichen, jenseits
der Kreisstraße gelegenen Hofanlage 2, die
ehemals als Gasthof gedient hat. Er weist ein
gleichmäßiges quadratisches Gerüst mit einer
doppelten Eingangstür auf und ist vermutlich um
1900 als Stall genutzt und verlängert worden.
Etwa aus der gleichen Zeit (1736) stammt der
aus fünf Sandsteinsegmenten zusammenge-
setzte Brunnen, während der sandsteinerne
Trog (mit Schwengelpumpe), der vor dem schön
gegliederten Stallgiebel aus der 1. Hälfte des
19.Jh. steht, 1782 erstellt worden ist.
In der Reihe der enger bebauten „oberen“
Hofanlagen ist die erhaltene Einheit von Bebau-
ung und Parzelle von Hof Nr. 7 hervorzuheben.
Aufgrund der geringen Grundstücksbreite bilden
Haupt- und Nebengebäude eine giebelständig
zur Straße orientierte Dreiseitanlage. Hofprä-
gend ist der breit gelagerte, fast gleichmäßig
gegliederte Wirtschaftsgiebel aus der Zeit um
1830, ein Vierständerbau mit beidseitigen
Kübbungen unter Halbwalmdach mit erhaltener
Uhlenflucht. Dahinter ist 1911 als Ersatz für den
alten Wohntrakt, wie vielfach üblich, ein Wohn-
haustrakt in typischer gemischter Bauweise mit
massivem Erdgeschoss und Fachwerkaufsatz
mit Drempel und Zierungen quergestellt worden.
Wohl gleichzeitig mit dem Wohnwirtschaftsge-
bäude des Hofes ist 1830 der Kornspeicher in
Straßennähe errichtet worden. Sein stockwerks-
weise abgebundenes zweistöckiges Gerüst mit
quadratischen Gefachen gründet sich auf einzel-
nen Findlingen.
WALSRODE-KIRCHBOITZEN
Deutlicher noch als heute setzte sich das alte,
bereits 1203 erstmals urkundlich erwähnte
Kirchdorf „Kercbotzem“, aus zwei Siedlungsbe-
reichen zusammen, die von den in Ost-West-
Richtung verlaufenden Feuchtwiesen eines klei-
nen Bachlaufs unterbrochen werden. Dieser
entwässert in den östlich vorbeifließenden Jor-
danbach, welcher dann weiter südlich in die
Böhme mündet. Die erhöhte Lage von Dorf und
Feldmark in der Nähe des begrünten Talein-
schnitts des Jordanbaches ist als Übergangsge-
biet von dem nördlichen bewegten Moränenge-
biet der Geest zur Region des Allerurstromtals
mit ihren zahlreichen Wasserläufen und Dünen-
erhebungen zu erkennen.
Heute sind die Dorfteile in Nord-Süd-Richtung
entlang der Großen Dorfstraße zusammenge-
wachsen. Im südlichen Bereich steht die weithin
sichtbare große Backsteinkirche Kirchboitzens
inmitten des erhöhten, von Resten einer Feld-
steinmauer eingefassten Kirchhofs. Ein mehrteili-
ges Kriegerdenkmal nahe des Eingangsportals
erinnert an seine ursprüngliche Funktion als
Friedhof. Gleichzeitig mit den Zerstörungen der
Kirche sind wohl auch der ehemals reich begü-
terte Pfarrhof und das Pfarrwitwentum verloren
gegangen. Weitgehend unverändert steht etwas
weiter südlich der Kirche das zweite Schulge-
bäude des Ortes, ein 1904/05 errichtetes
Rohziegelgebäude für zwei Klassen mit entspre-
chend großen Fenstereinbauten und schlichten
Ziegelsteinsetzungen (Nr. 11).
Ev. Kirche St. Michaelis
Die 1226 urkundlich erwähnte Ursprungskirche
gehörte dem Archidiakonat Ahlden und somit
dem Bistum Minden an. Sie war Pfarrkirche im
Kirchboitzener Kirchspiel, zu dem 14 Dörfer ge-
hörten.
Obwohl die Kirche 1742 bei einem Feuer voll-
kommen zerstört und im selben Jahr von Wes-
ten her zu zwei Dritteln wieder aufgebaut
worden war, ist sie erst in den Jahren 1862/63
durch den Hannoverschen Konsistorialbaurat C.
W. Hase als Backsteinbau in neugotischem Stil
vollendet worden. Bei der Erneuerung sind die
mittelalterlichen Reste, insbesondere das meter-
dicke Feldsteinmauerwerk des fast quadrati-
schen Turms, einbezogen worden. Nach der er-
neuten Zerstörung am Ende des Zweiten Welt-
krieges wurde sie bis 1949 von Prof. Zinsser,
Hannover, im Sinne seines Vorgängers wieder
Kirchboitzen, Ev. Kirche St. Michaelis, 18./19.Jh.
361