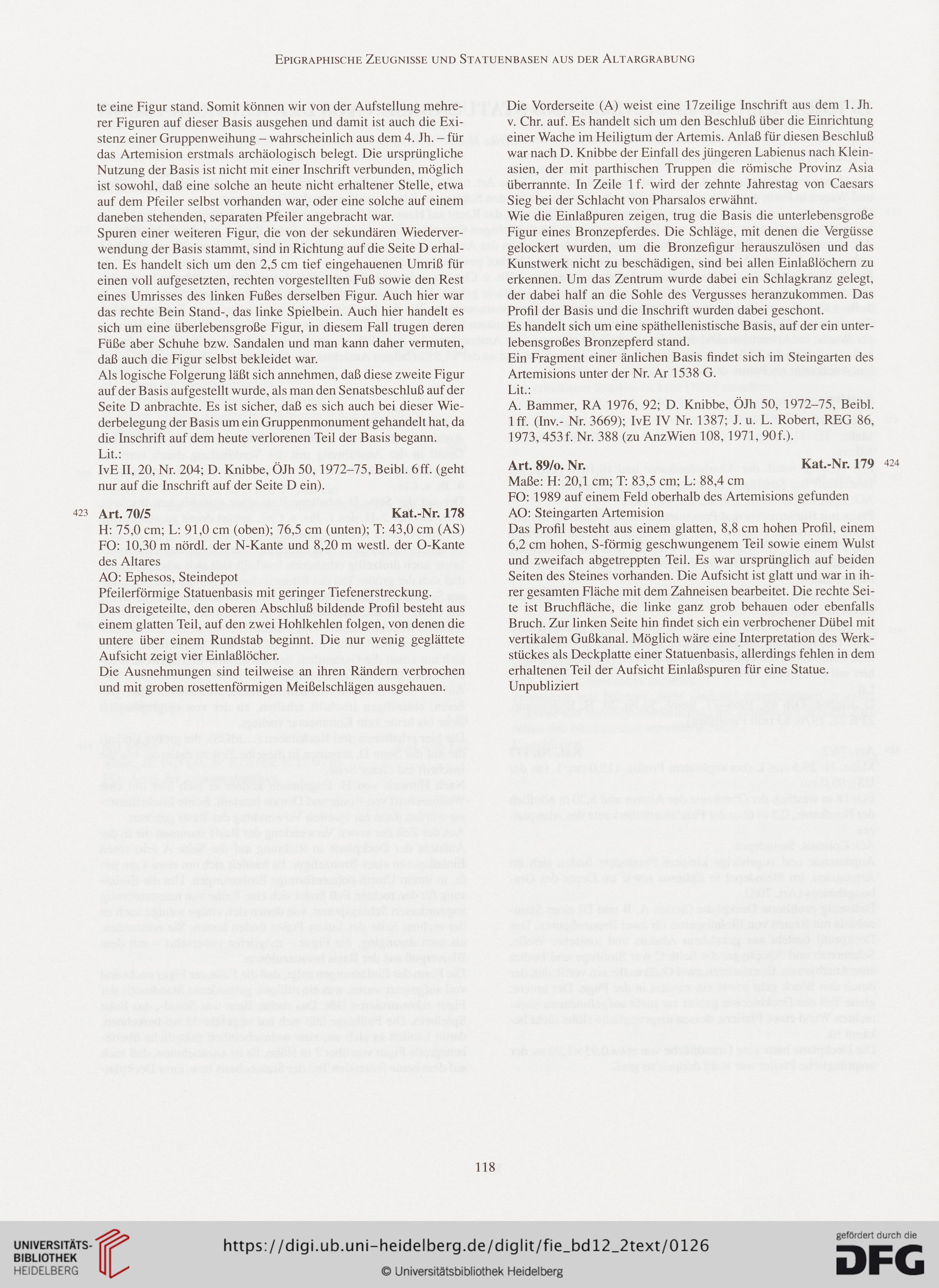Epigraphische Zeugnisse und Statuenbasen aus der Altargrabung
te eine Figur stand. Somit können wir von der Aufstellung mehre-
rer Figuren auf dieser Basis ausgehen und damit ist auch die Exi-
stenz einer Gruppenweihung - wahrscheinlich aus dem 4. Jh. - für
das Artemision erstmals archäologisch belegt. Die ursprüngliche
Nutzung der Basis ist nicht mit einer Inschrift verbunden, möglich
ist sowohl, daß eine solche an heute nicht erhaltener Stelle, etwa
auf dem Pfeiler selbst vorhanden war, oder eine solche auf einem
daneben stehenden, separaten Pfeiler angebracht war.
Spuren einer weiteren Figur, die von der sekundären Wiederver-
wendung der Basis stammt, sind in Richtung auf die Seite D erhal-
ten. Es handelt sich um den 2,5 cm tief eingehauenen Umriß für
einen voll aufgesetzten, rechten vorgestellten Fuß sowie den Rest
eines Umrisses des linken Fußes derselben Figur. Auch hier war
das rechte Bein Stand-, das linke Spielbein. Auch hier handelt es
sich um eine überlebensgroße Figur, in diesem Fall trugen deren
Füße aber Schuhe bzw. Sandalen und man kann daher vermuten,
daß auch die Figur selbst bekleidet war.
Als logische Folgerung läßt sich annehmen, daß diese zweite Figur
auf der Basis aufgestellt wurde, als man den Senatsbeschluß auf der
Seite D anbrachte. Es ist sicher, daß es sich auch bei dieser Wie-
derbelegung der Basis um ein Gruppenmonument gehandelt hat, da
die Inschrift auf dem heute verlorenen Teil der Basis begann.
Lit.:
IvE II, 20, Nr. 204; D. Knibbe, ÖJh 50,1972-75, Beibl. 6ff. (geht
nur auf die Inschrift auf der Seite D ein).
423 Art. 70/5 Kat.-Nr. 178
H: 75,0 cm; L: 91,0 cm (oben); 76,5 cm (unten); T: 43,0 cm (AS)
FO: 10,30 m nördl. der N-Kante und 8,20 m westl. der O-Kante
des Altares
AO: Ephesos, Steindepot
Pfeilerförmige Statuenbasis mit geringer Tiefenerstreckung.
Das dreigeteilte, den oberen Abschluß bildende Profil besteht aus
einem glatten Teil, auf den zwei Hohlkehlen folgen, von denen die
untere über einem Rundstab beginnt. Die nur wenig geglättete
Aufsicht zeigt vier Einlaßlöcher.
Die Ausnehmungen sind teilweise an ihren Rändern verbrochen
und mit groben rosettenförmigen Meißelschlägen ausgehauen.
Die Vorderseite (A) weist eine 17zeilige Inschrift aus dem 1. Jh.
v. Chr. auf. Es handelt sich um den Beschluß über die Einrichtung
einer Wache im Heiligtum der Artemis. Anlaß für diesen Beschluß
war nach D. Knibbe der Einfall des jüngeren Labienus nach Klein-
asien, der mit parthischen Truppen die römische Provinz Asia
überrannte. In Zeile If. wird der zehnte Jahrestag von Caesars
Sieg bei der Schlacht von Pharsalos erwähnt.
Wie die Einlaßpuren zeigen, trug die Basis die unterlebensgroße
Figur eines Bronzepferdes. Die Schläge, mit denen die Vergüsse
gelockert wurden, um die Bronzefigur herauszulösen und das
Kunstwerk nicht zu beschädigen, sind bei allen Einlaßlöchern zu
erkennen. Um das Zentrum wurde dabei ein Schlagkranz gelegt,
der dabei half an die Sohle des Vergusses heranzukommen. Das
Profil der Basis und die Inschrift wurden dabei geschont.
Es handelt sich um eine späthellenistische Basis, auf der ein unter-
lebensgroßes Bronzepferd stand.
Ein Fragment einer änlichen Basis findet sich im Steingarten des
Artemisions unter der Nr. Ar 1538 G.
Lit.:
A. Bammer, RA 1976, 92; D. Knibbe, ÖJh 50, 1972-75, Beibl.
1 ff. (Inv.- Nr. 3669); IvE IV Nr. 1387; J. u. L. Robert, REG 86,
1973, 453f. Nr. 388 (zu AnzWien 108,1971, 90f.).
Art. 89/o. Nr. Kat.-Nr. 179 424
Maße: H: 20,1 cm; T: 83,5 cm; L: 88,4 cm
FO: 1989 auf einem Feld oberhalb des Artemisions gefunden
AO: Steingarten Artemision
Das Profil besteht aus einem glatten, 8,8 cm hohen Profil, einem
6,2 cm hohen, S-förmig geschwungenem Teil sowie einem Wulst
und zweifach abgetreppten Teil. Es war ursprünglich auf beiden
Seiten des Steines vorhanden. Die Aufsicht ist glatt und war in ih-
rer gesamten Fläche mit dem Zahneisen bearbeitet. Die rechte Sei-
te ist Bruchfläche, die linke ganz grob behauen oder ebenfalls
Bruch. Zur linken Seite hin findet sich ein verbrochener Dübel mit
vertikalem Gußkanal. Möglich wäre eine Interpretation des Werk-
stückes als Deckplatte einer Statuenbasis, allerdings fehlen in dem
erhaltenen Teil der Aufsicht Einlaßspuren für eine Statue.
Unpubliziert
118
te eine Figur stand. Somit können wir von der Aufstellung mehre-
rer Figuren auf dieser Basis ausgehen und damit ist auch die Exi-
stenz einer Gruppenweihung - wahrscheinlich aus dem 4. Jh. - für
das Artemision erstmals archäologisch belegt. Die ursprüngliche
Nutzung der Basis ist nicht mit einer Inschrift verbunden, möglich
ist sowohl, daß eine solche an heute nicht erhaltener Stelle, etwa
auf dem Pfeiler selbst vorhanden war, oder eine solche auf einem
daneben stehenden, separaten Pfeiler angebracht war.
Spuren einer weiteren Figur, die von der sekundären Wiederver-
wendung der Basis stammt, sind in Richtung auf die Seite D erhal-
ten. Es handelt sich um den 2,5 cm tief eingehauenen Umriß für
einen voll aufgesetzten, rechten vorgestellten Fuß sowie den Rest
eines Umrisses des linken Fußes derselben Figur. Auch hier war
das rechte Bein Stand-, das linke Spielbein. Auch hier handelt es
sich um eine überlebensgroße Figur, in diesem Fall trugen deren
Füße aber Schuhe bzw. Sandalen und man kann daher vermuten,
daß auch die Figur selbst bekleidet war.
Als logische Folgerung läßt sich annehmen, daß diese zweite Figur
auf der Basis aufgestellt wurde, als man den Senatsbeschluß auf der
Seite D anbrachte. Es ist sicher, daß es sich auch bei dieser Wie-
derbelegung der Basis um ein Gruppenmonument gehandelt hat, da
die Inschrift auf dem heute verlorenen Teil der Basis begann.
Lit.:
IvE II, 20, Nr. 204; D. Knibbe, ÖJh 50,1972-75, Beibl. 6ff. (geht
nur auf die Inschrift auf der Seite D ein).
423 Art. 70/5 Kat.-Nr. 178
H: 75,0 cm; L: 91,0 cm (oben); 76,5 cm (unten); T: 43,0 cm (AS)
FO: 10,30 m nördl. der N-Kante und 8,20 m westl. der O-Kante
des Altares
AO: Ephesos, Steindepot
Pfeilerförmige Statuenbasis mit geringer Tiefenerstreckung.
Das dreigeteilte, den oberen Abschluß bildende Profil besteht aus
einem glatten Teil, auf den zwei Hohlkehlen folgen, von denen die
untere über einem Rundstab beginnt. Die nur wenig geglättete
Aufsicht zeigt vier Einlaßlöcher.
Die Ausnehmungen sind teilweise an ihren Rändern verbrochen
und mit groben rosettenförmigen Meißelschlägen ausgehauen.
Die Vorderseite (A) weist eine 17zeilige Inschrift aus dem 1. Jh.
v. Chr. auf. Es handelt sich um den Beschluß über die Einrichtung
einer Wache im Heiligtum der Artemis. Anlaß für diesen Beschluß
war nach D. Knibbe der Einfall des jüngeren Labienus nach Klein-
asien, der mit parthischen Truppen die römische Provinz Asia
überrannte. In Zeile If. wird der zehnte Jahrestag von Caesars
Sieg bei der Schlacht von Pharsalos erwähnt.
Wie die Einlaßpuren zeigen, trug die Basis die unterlebensgroße
Figur eines Bronzepferdes. Die Schläge, mit denen die Vergüsse
gelockert wurden, um die Bronzefigur herauszulösen und das
Kunstwerk nicht zu beschädigen, sind bei allen Einlaßlöchern zu
erkennen. Um das Zentrum wurde dabei ein Schlagkranz gelegt,
der dabei half an die Sohle des Vergusses heranzukommen. Das
Profil der Basis und die Inschrift wurden dabei geschont.
Es handelt sich um eine späthellenistische Basis, auf der ein unter-
lebensgroßes Bronzepferd stand.
Ein Fragment einer änlichen Basis findet sich im Steingarten des
Artemisions unter der Nr. Ar 1538 G.
Lit.:
A. Bammer, RA 1976, 92; D. Knibbe, ÖJh 50, 1972-75, Beibl.
1 ff. (Inv.- Nr. 3669); IvE IV Nr. 1387; J. u. L. Robert, REG 86,
1973, 453f. Nr. 388 (zu AnzWien 108,1971, 90f.).
Art. 89/o. Nr. Kat.-Nr. 179 424
Maße: H: 20,1 cm; T: 83,5 cm; L: 88,4 cm
FO: 1989 auf einem Feld oberhalb des Artemisions gefunden
AO: Steingarten Artemision
Das Profil besteht aus einem glatten, 8,8 cm hohen Profil, einem
6,2 cm hohen, S-förmig geschwungenem Teil sowie einem Wulst
und zweifach abgetreppten Teil. Es war ursprünglich auf beiden
Seiten des Steines vorhanden. Die Aufsicht ist glatt und war in ih-
rer gesamten Fläche mit dem Zahneisen bearbeitet. Die rechte Sei-
te ist Bruchfläche, die linke ganz grob behauen oder ebenfalls
Bruch. Zur linken Seite hin findet sich ein verbrochener Dübel mit
vertikalem Gußkanal. Möglich wäre eine Interpretation des Werk-
stückes als Deckplatte einer Statuenbasis, allerdings fehlen in dem
erhaltenen Teil der Aufsicht Einlaßspuren für eine Statue.
Unpubliziert
118