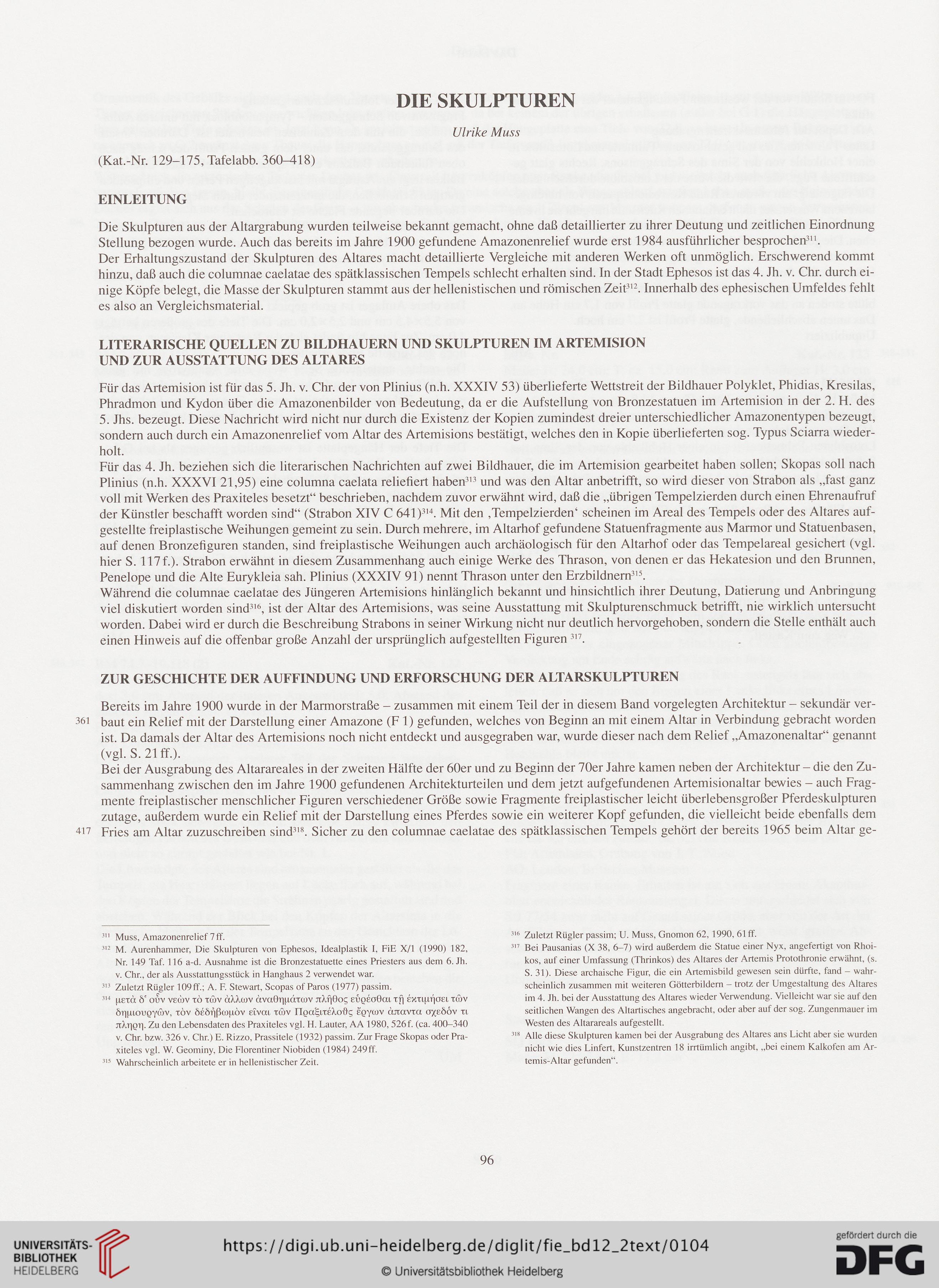DIE SKULPTUREN
Ulrike Muss
(Kat.-Nr. 129-175, Tafelabb. 360-418)
EINLEITUNG
Die Skulpturen aus der Altargrabung wurden teilweise bekannt gemacht, ohne daß detaillierter zu ihrer Deutung und zeitlichen Einordnung
Stellung bezogen wurde. Auch das bereits im Jahre 1900 gefundene Amazonenrelief wurde erst 1984 ausführlicher besprochen311.
Der Erhaltungszustand der Skulpturen des Altares macht detaillierte Vergleiche mit anderen Werken oft unmöglich. Erschwerend kommt
hinzu, daß auch die columnae caelatae des spätklassischen Tempels schlecht erhalten sind. In der Stadt Ephesos ist das 4. Jh. v. Chr. durch ei-
nige Köpfe belegt, die Masse der Skulpturen stammt aus der hellenistischen und römischen Zeit312. Innerhalb des ephesischen Umfeldes fehlt
es also an Vergleichsmaterial.
LITERARISCHE QUELLEN ZU BILDHAUERN UND SKULPTUREN IM ARTEMISION
UND ZUR AUSSTATTUNG DES ALTARES
Für das Artemision ist für das 5. Jh. v. Chr. der von Plinius (n.h. XXXIV 53) überlieferte Wettstreit der Bildhauer Polyklet, Phidias, Kresilas,
Phradmon und Kydon über die Amazonenbilder von Bedeutung, da er die Aufstellung von Bronzestatuen im Artemision in der 2. H. des
5. Jhs. bezeugt. Diese Nachricht wird nicht nur durch die Existenz der Kopien zumindest dreier unterschiedlicher Amazonentypen bezeugt,
sondern auch durch ein Amazonenrelief vom Altar des Artemisions bestätigt, welches den in Kopie überlieferten sog. Typus Sciarra wieder-
holt.
Für das 4. Jh. beziehen sich die literarischen Nachrichten auf zwei Bildhauer, die im Artemision gearbeitet haben sollen; Skopas soll nach
Plinius (n.h. XXXVI 21,95) eine columna caelata reliefiert haben313 und was den Altar anbetrifft, so wird dieser von Strabon als „fast ganz
voll mit Werken des Praxiteles besetzt“ beschrieben, nachdem zuvor erwähnt wird, daß die „übrigen Tempelzierden durch einen Ehrenaufruf
der Künstler beschafft worden sind“ (Strabon XIV C 641)314. Mit den ,Tempelzierden‘ scheinen im Areal des Tempels oder des Altares auf-
gestellte freiplastische Weihungen gemeint zu sein. Durch mehrere, im Altarhof gefundene Statuenfragmente aus Marmor und Statuenbasen,
auf denen Bronzefiguren standen, sind freiplastische Weihungen auch archäologisch für den Altarhof oder das Tempelareal gesichert (vgl.
hier S. 117 f.). Strabon erwähnt in diesem Zusammenhang auch einige Werke des Thrason, von denen er das Hekatesion und den Brunnen,
Penelope und die Alte Eurykleia sah. Plinius (XXXIV 91) nennt Thrason unter den Erzbildnem315.
Während die columnae caelatae des Jüngeren Artemisions hinlänglich bekannt und hinsichtlich ihrer Deutung, Datierung und Anbringung
viel diskutiert worden sind316, ist der Altar des Artemisions, was seine Ausstattung mit Skulpturenschmuck betrifft, nie wirklich untersucht
worden. Dabei wird er durch die Beschreibung Strabons in seiner Wirkung nicht nur deutlich hervorgehoben, sondern die Stelle enthält auch
einen Hinweis auf die offenbar große Anzahl der ursprünglich aufgestellten Figuren317.
ZUR GESCHICHTE DER AUFFINDUNG UND ERFORSCHUNG DER ALTARSKULPTUREN
Bereits im Jahre 1900 wurde in der Marmorstraße - zusammen mit einem Teil der in diesem Band vorgelegten Architektur - sekundär ver-
361 baut ein Relief mit der Darstellung einer Amazone (F 1) gefunden, welches von Beginn an mit einem Altar in Verbindung gebracht worden
ist. Da damals der Altar des Artemisions noch nicht entdeckt und ausgegraben war, wurde dieser nach dem Relief „Amazonenaltar“ genannt
(vgl. S.21ff.).
Bei der Ausgrabung des Altarareales in der zweiten Hälfte der 60er und zu Beginn der 70er Jahre kamen neben der Architektur - die den Zu-
sammenhang zwischen den im Jahre 1900 gefundenen Architekturteilen und dem jetzt aufgefundenen Artemisionaltar bewies - auch Frag-
mente freiplastischer menschlicher Figuren verschiedener Größe sowie Fragmente freiplastischer leicht überlebensgroßer Pferdeskulpturen
zutage, außerdem wurde ein Relief mit der Darstellung eines Pferdes sowie ein weiterer Kopf gefunden, die vielleicht beide ebenfalls dem
417 Fries am Altar zuzuschreiben sind318. Sicher zu den columnae caelatae des spätklassischen Tempels gehört der bereits 1965 beim Altar ge-
311 Muss, Amazonenrelief 7 ff.
312 M. Aurenhatnmer, Die Skulpturen von Ephesos, Idealplastik I, FiE X/l (1990) 182,
Nr. 149 Taf. 116 a-d. Ausnahme ist die Bronzestatuette eines Priesters aus dem 6. Jh.
v. Chr., der als Ausstattungsstück in Hanghaus 2 verwendet war.
313 Zuletzt Rügler 109ff.; A. F. Stewart, Scopas of Paros (1977) passim.
3,4 Lic'rrt ö' ovv vewv to tcöv «/j.(»v avaöripciTwv jtX.f|Oog evgeoOat rfj ezTi[xf|aet twv
örjpiovpYWV, röv öeöf|ßwpöv eivat r&v rioagiTÖ.oflg eovcdv äitavra o/eööv rt
jtXtjot]. Zu den Lebensdaten des Praxiteles vgl. H. Lauter, AA 1980,526f. (ca. 400-340
v. Chr. bzw. 326 v. Chr.) E. Rizzo, Prassitele (1932) passim. Zur Frage Skopas oder Pra-
xiteles vgl. W. Geominy, Die Florentiner Niobiden (1984) 249ff.
315 Wahrscheinlich arbeitete er in hellenistischer Zeit.
316 Zuletzt Rügler passim; U. Muss, Gnomon 62,1990, 61 ff.
317 Bei Pausanias (X 38, 6-7) wird außerdem die Statue einer Nyx, angefertigt von Rhoi-
kos, auf einer Umfassung (Thrinkos) des Altares der Artemis Protothronie erwähnt, (s.
S. 31). Diese archaische Figur, die ein Artemisbild gewesen sein dürfte, fand - wahr-
scheinlich zusammen mit weiteren Götterbildern - trotz der Umgestaltung des Altares
im 4. Jh. bei der Ausstattung des Altares wieder Verwendung. Vielleicht war sie auf den
seitlichen Wangen des Altartisches angebracht, oder aber auf der sog. Zungenmauer im
Westen des Altarareals aufgestellt.
318 Alle diese Skulpturen kamen bei der Ausgrabung des Altares ans Licht aber sie wurden
nicht wie dies Linfert, Kunstzentren 18 irrtümlich angibt, „bei einem Kalkofen am Ar-
temis-Altar gefunden“.
96
Ulrike Muss
(Kat.-Nr. 129-175, Tafelabb. 360-418)
EINLEITUNG
Die Skulpturen aus der Altargrabung wurden teilweise bekannt gemacht, ohne daß detaillierter zu ihrer Deutung und zeitlichen Einordnung
Stellung bezogen wurde. Auch das bereits im Jahre 1900 gefundene Amazonenrelief wurde erst 1984 ausführlicher besprochen311.
Der Erhaltungszustand der Skulpturen des Altares macht detaillierte Vergleiche mit anderen Werken oft unmöglich. Erschwerend kommt
hinzu, daß auch die columnae caelatae des spätklassischen Tempels schlecht erhalten sind. In der Stadt Ephesos ist das 4. Jh. v. Chr. durch ei-
nige Köpfe belegt, die Masse der Skulpturen stammt aus der hellenistischen und römischen Zeit312. Innerhalb des ephesischen Umfeldes fehlt
es also an Vergleichsmaterial.
LITERARISCHE QUELLEN ZU BILDHAUERN UND SKULPTUREN IM ARTEMISION
UND ZUR AUSSTATTUNG DES ALTARES
Für das Artemision ist für das 5. Jh. v. Chr. der von Plinius (n.h. XXXIV 53) überlieferte Wettstreit der Bildhauer Polyklet, Phidias, Kresilas,
Phradmon und Kydon über die Amazonenbilder von Bedeutung, da er die Aufstellung von Bronzestatuen im Artemision in der 2. H. des
5. Jhs. bezeugt. Diese Nachricht wird nicht nur durch die Existenz der Kopien zumindest dreier unterschiedlicher Amazonentypen bezeugt,
sondern auch durch ein Amazonenrelief vom Altar des Artemisions bestätigt, welches den in Kopie überlieferten sog. Typus Sciarra wieder-
holt.
Für das 4. Jh. beziehen sich die literarischen Nachrichten auf zwei Bildhauer, die im Artemision gearbeitet haben sollen; Skopas soll nach
Plinius (n.h. XXXVI 21,95) eine columna caelata reliefiert haben313 und was den Altar anbetrifft, so wird dieser von Strabon als „fast ganz
voll mit Werken des Praxiteles besetzt“ beschrieben, nachdem zuvor erwähnt wird, daß die „übrigen Tempelzierden durch einen Ehrenaufruf
der Künstler beschafft worden sind“ (Strabon XIV C 641)314. Mit den ,Tempelzierden‘ scheinen im Areal des Tempels oder des Altares auf-
gestellte freiplastische Weihungen gemeint zu sein. Durch mehrere, im Altarhof gefundene Statuenfragmente aus Marmor und Statuenbasen,
auf denen Bronzefiguren standen, sind freiplastische Weihungen auch archäologisch für den Altarhof oder das Tempelareal gesichert (vgl.
hier S. 117 f.). Strabon erwähnt in diesem Zusammenhang auch einige Werke des Thrason, von denen er das Hekatesion und den Brunnen,
Penelope und die Alte Eurykleia sah. Plinius (XXXIV 91) nennt Thrason unter den Erzbildnem315.
Während die columnae caelatae des Jüngeren Artemisions hinlänglich bekannt und hinsichtlich ihrer Deutung, Datierung und Anbringung
viel diskutiert worden sind316, ist der Altar des Artemisions, was seine Ausstattung mit Skulpturenschmuck betrifft, nie wirklich untersucht
worden. Dabei wird er durch die Beschreibung Strabons in seiner Wirkung nicht nur deutlich hervorgehoben, sondern die Stelle enthält auch
einen Hinweis auf die offenbar große Anzahl der ursprünglich aufgestellten Figuren317.
ZUR GESCHICHTE DER AUFFINDUNG UND ERFORSCHUNG DER ALTARSKULPTUREN
Bereits im Jahre 1900 wurde in der Marmorstraße - zusammen mit einem Teil der in diesem Band vorgelegten Architektur - sekundär ver-
361 baut ein Relief mit der Darstellung einer Amazone (F 1) gefunden, welches von Beginn an mit einem Altar in Verbindung gebracht worden
ist. Da damals der Altar des Artemisions noch nicht entdeckt und ausgegraben war, wurde dieser nach dem Relief „Amazonenaltar“ genannt
(vgl. S.21ff.).
Bei der Ausgrabung des Altarareales in der zweiten Hälfte der 60er und zu Beginn der 70er Jahre kamen neben der Architektur - die den Zu-
sammenhang zwischen den im Jahre 1900 gefundenen Architekturteilen und dem jetzt aufgefundenen Artemisionaltar bewies - auch Frag-
mente freiplastischer menschlicher Figuren verschiedener Größe sowie Fragmente freiplastischer leicht überlebensgroßer Pferdeskulpturen
zutage, außerdem wurde ein Relief mit der Darstellung eines Pferdes sowie ein weiterer Kopf gefunden, die vielleicht beide ebenfalls dem
417 Fries am Altar zuzuschreiben sind318. Sicher zu den columnae caelatae des spätklassischen Tempels gehört der bereits 1965 beim Altar ge-
311 Muss, Amazonenrelief 7 ff.
312 M. Aurenhatnmer, Die Skulpturen von Ephesos, Idealplastik I, FiE X/l (1990) 182,
Nr. 149 Taf. 116 a-d. Ausnahme ist die Bronzestatuette eines Priesters aus dem 6. Jh.
v. Chr., der als Ausstattungsstück in Hanghaus 2 verwendet war.
313 Zuletzt Rügler 109ff.; A. F. Stewart, Scopas of Paros (1977) passim.
3,4 Lic'rrt ö' ovv vewv to tcöv «/j.(»v avaöripciTwv jtX.f|Oog evgeoOat rfj ezTi[xf|aet twv
örjpiovpYWV, röv öeöf|ßwpöv eivat r&v rioagiTÖ.oflg eovcdv äitavra o/eööv rt
jtXtjot]. Zu den Lebensdaten des Praxiteles vgl. H. Lauter, AA 1980,526f. (ca. 400-340
v. Chr. bzw. 326 v. Chr.) E. Rizzo, Prassitele (1932) passim. Zur Frage Skopas oder Pra-
xiteles vgl. W. Geominy, Die Florentiner Niobiden (1984) 249ff.
315 Wahrscheinlich arbeitete er in hellenistischer Zeit.
316 Zuletzt Rügler passim; U. Muss, Gnomon 62,1990, 61 ff.
317 Bei Pausanias (X 38, 6-7) wird außerdem die Statue einer Nyx, angefertigt von Rhoi-
kos, auf einer Umfassung (Thrinkos) des Altares der Artemis Protothronie erwähnt, (s.
S. 31). Diese archaische Figur, die ein Artemisbild gewesen sein dürfte, fand - wahr-
scheinlich zusammen mit weiteren Götterbildern - trotz der Umgestaltung des Altares
im 4. Jh. bei der Ausstattung des Altares wieder Verwendung. Vielleicht war sie auf den
seitlichen Wangen des Altartisches angebracht, oder aber auf der sog. Zungenmauer im
Westen des Altarareals aufgestellt.
318 Alle diese Skulpturen kamen bei der Ausgrabung des Altares ans Licht aber sie wurden
nicht wie dies Linfert, Kunstzentren 18 irrtümlich angibt, „bei einem Kalkofen am Ar-
temis-Altar gefunden“.
96