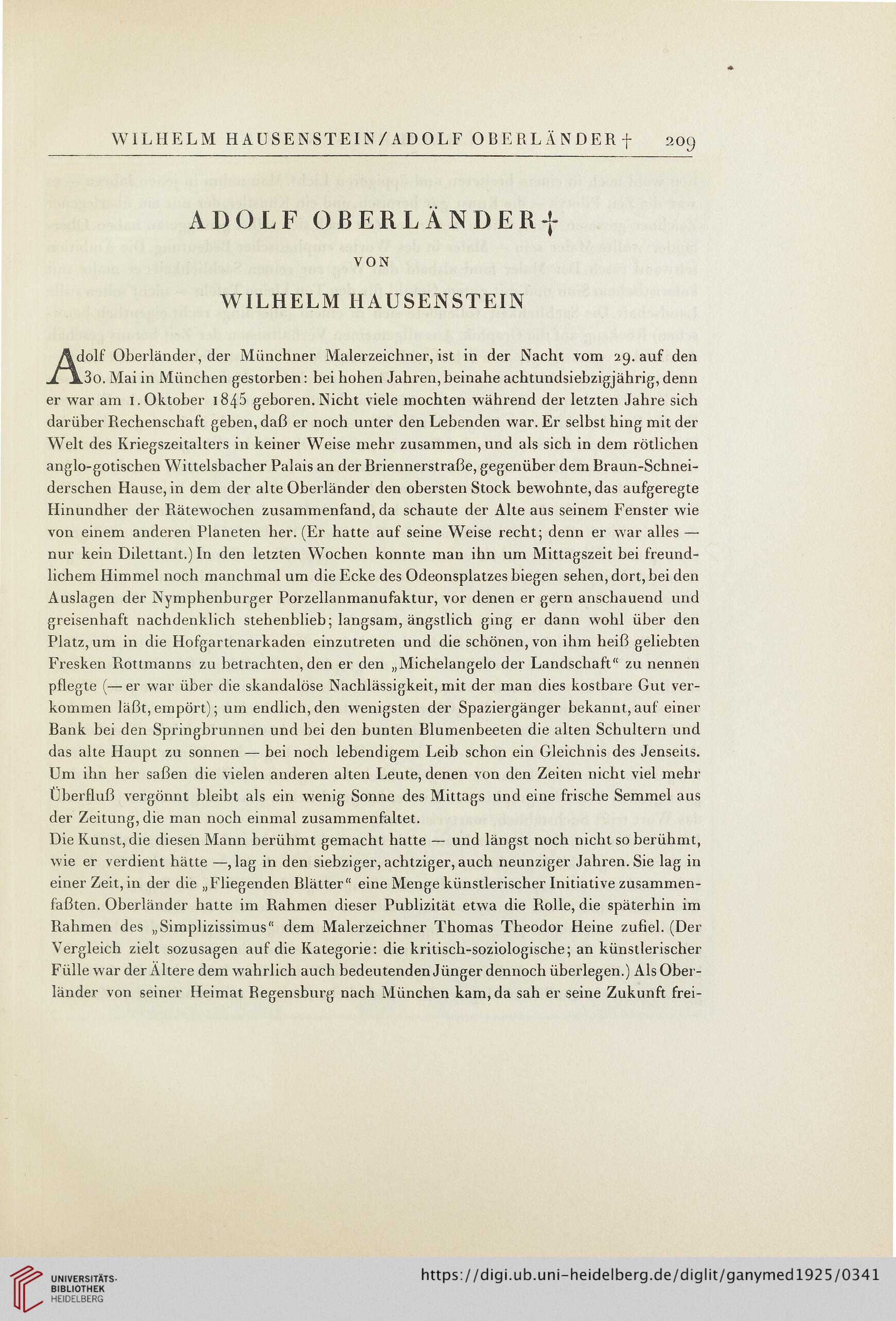WILHELM HAUSENSTEIN/ADOLF OBERLÄNDER f 209
ADOLF OBERLÄNDER^
VON
WILHELM HAUSENSTEIN
Adolf Oberländer, der Münchner Malerzeichner, ist in der Nacht vom 29. auf den
Jl3o. Mai in München gestorben: bei hohen Jahren, beinahe achtundsiebzigjährig, denn
er war am 1. Oktober 1845 geboren. Nicht viele mochten während der letzten Jahre sich
darüber Rechenschaft geben, daß er noch unter den Lebenden war. Er selbst hing mit der
Welt des Kriegszeitalters in keiner Weise mehr zusammen, und als sich in dem rötlichen
anglo-gotischen Wittelsbacher Palais an der Briennerstraße, gegenüber dem Braun-Schnei-
derschen Hause, in dem der alte Oberländer den obersten Stock bewohnte, das aufgeregte
Hinundher der Rätewochen zusammenfand, da schaute der Alte aus seinem Fenster wie
von einem anderen Planeten her. (Er hatte auf seine Weise recht; denn er war alles —
nur kein Dilettant.) In den letzten Wochen konnte man ihn um Mittagszeit bei freund-
lichem Himmel noch manchmal um die Ecke des Odeonsplatzes biegen sehen, dort, bei den
Auslagen der Nymphenburger Porzellanmanufaktur, vor denen er gern anschauend und
greisenhaft nachdenklich stehenblieb; langsam, ängstlich ging er dann wohl über den
Platz, um in die Hofgartenarkaden einzutreten und die schönen, von ihm heiß geliebten
Fresken Rottmanns zu betrachtenden er den „Michelangelo der Landschaft“ zu nennen
pflegte (—er war über die skandalöse Nachlässigkeit, mit der man dies kostbare Gut ver-
kommen läßt, empört); um endlich, den wenigsten der Spaziergänger bekannt, auf einer
Bank bei den Springbrunnen und bei den bunten Blumenbeeten die alten Schultern und
das alte Haupt zu sonnen — bei noch lebendigem Leib schon ein Gleichnis des Jenseits.
Um ihn her saßen die vielen anderen alten Leute, denen von den Zeiten nicht viel mehr
Überfluß vergönnt bleibt als ein wenig Sonne des Mittags und eine frische Semmel aus
der Zeitung, die man noch einmal zusammenfaltet.
Die Kunst, die diesen Mann berühmt gemacht hatte — und längst noch nicht so berühmt,
wie er verdient hätte —, lag in den siebziger, achtziger, auch neunziger Jahren. Sie lag in
einer Zeit, in der die „Fliegenden Blätter“ eine Menge künstlerischer Initiative zusammen-
faßten. Oberländer hatte im Rahmen dieser Publizität etwa die Rolle, die späterhin im
Rahmen des „Simplizissimus“ dem Malerzeichner Thomas Theodor Heine zufiel. (Der
Vergleich zielt sozusagen auf die Kategorie: die kritisch-soziologische; an künstlerischer
Fülle war der Ältere dem wahrlich auch bedeutenden Jünger dennoch überlegen.) Als Ober-
länder von seiner Heimat Regensburg nach München kam, da sah er seine Zukunft frei-
ADOLF OBERLÄNDER^
VON
WILHELM HAUSENSTEIN
Adolf Oberländer, der Münchner Malerzeichner, ist in der Nacht vom 29. auf den
Jl3o. Mai in München gestorben: bei hohen Jahren, beinahe achtundsiebzigjährig, denn
er war am 1. Oktober 1845 geboren. Nicht viele mochten während der letzten Jahre sich
darüber Rechenschaft geben, daß er noch unter den Lebenden war. Er selbst hing mit der
Welt des Kriegszeitalters in keiner Weise mehr zusammen, und als sich in dem rötlichen
anglo-gotischen Wittelsbacher Palais an der Briennerstraße, gegenüber dem Braun-Schnei-
derschen Hause, in dem der alte Oberländer den obersten Stock bewohnte, das aufgeregte
Hinundher der Rätewochen zusammenfand, da schaute der Alte aus seinem Fenster wie
von einem anderen Planeten her. (Er hatte auf seine Weise recht; denn er war alles —
nur kein Dilettant.) In den letzten Wochen konnte man ihn um Mittagszeit bei freund-
lichem Himmel noch manchmal um die Ecke des Odeonsplatzes biegen sehen, dort, bei den
Auslagen der Nymphenburger Porzellanmanufaktur, vor denen er gern anschauend und
greisenhaft nachdenklich stehenblieb; langsam, ängstlich ging er dann wohl über den
Platz, um in die Hofgartenarkaden einzutreten und die schönen, von ihm heiß geliebten
Fresken Rottmanns zu betrachtenden er den „Michelangelo der Landschaft“ zu nennen
pflegte (—er war über die skandalöse Nachlässigkeit, mit der man dies kostbare Gut ver-
kommen läßt, empört); um endlich, den wenigsten der Spaziergänger bekannt, auf einer
Bank bei den Springbrunnen und bei den bunten Blumenbeeten die alten Schultern und
das alte Haupt zu sonnen — bei noch lebendigem Leib schon ein Gleichnis des Jenseits.
Um ihn her saßen die vielen anderen alten Leute, denen von den Zeiten nicht viel mehr
Überfluß vergönnt bleibt als ein wenig Sonne des Mittags und eine frische Semmel aus
der Zeitung, die man noch einmal zusammenfaltet.
Die Kunst, die diesen Mann berühmt gemacht hatte — und längst noch nicht so berühmt,
wie er verdient hätte —, lag in den siebziger, achtziger, auch neunziger Jahren. Sie lag in
einer Zeit, in der die „Fliegenden Blätter“ eine Menge künstlerischer Initiative zusammen-
faßten. Oberländer hatte im Rahmen dieser Publizität etwa die Rolle, die späterhin im
Rahmen des „Simplizissimus“ dem Malerzeichner Thomas Theodor Heine zufiel. (Der
Vergleich zielt sozusagen auf die Kategorie: die kritisch-soziologische; an künstlerischer
Fülle war der Ältere dem wahrlich auch bedeutenden Jünger dennoch überlegen.) Als Ober-
länder von seiner Heimat Regensburg nach München kam, da sah er seine Zukunft frei-