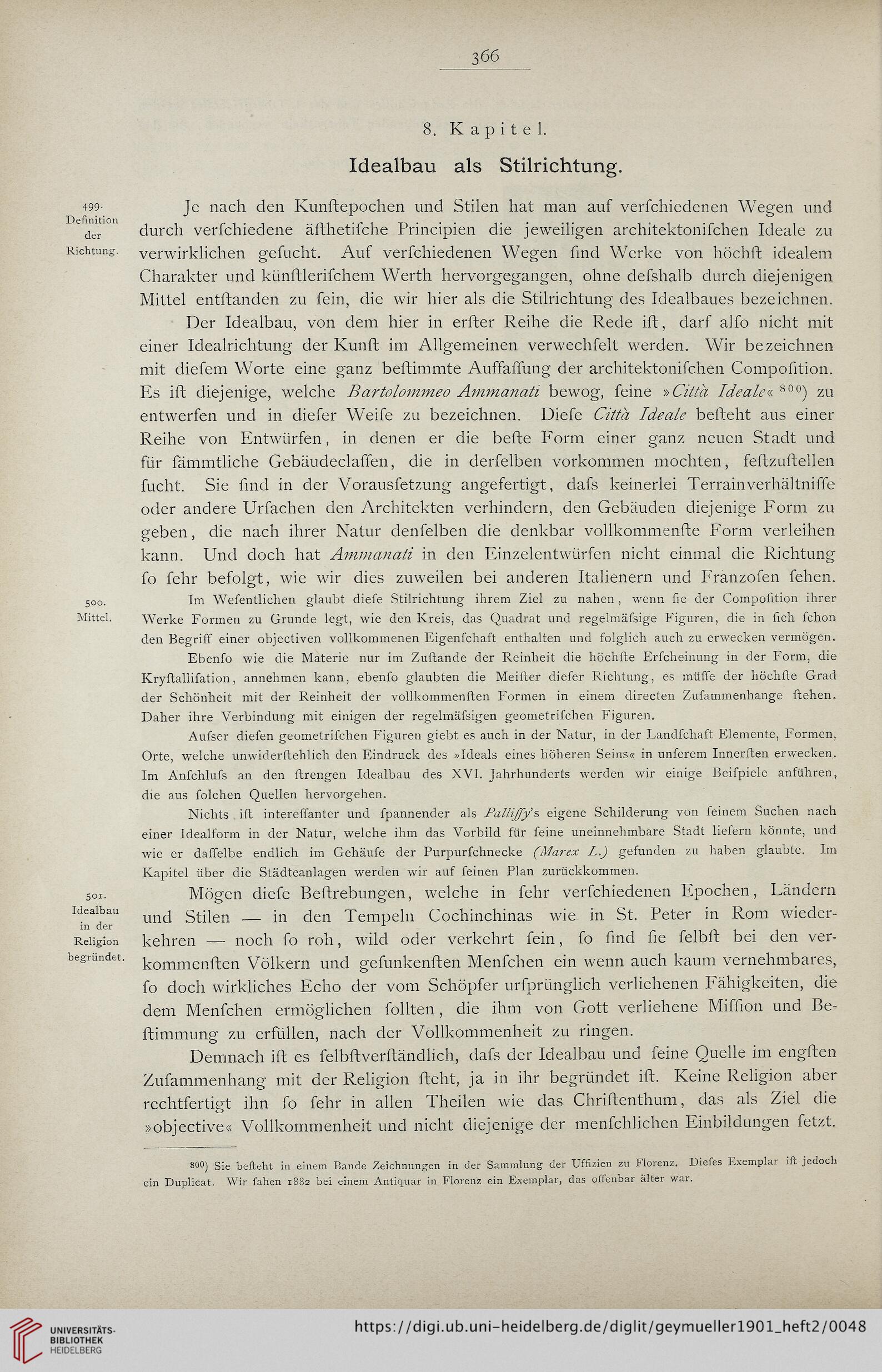366
499-
Definition
der
Richtung.
500.
Mittel.
501.
Idealbau
in der
Religion
begründet.
8. Kapitel.
Idealbau als Stilrichtung.
Je nach den Kunstepochen und Stilen hat man auf verschiedenen Wegen und
durch verschiedene ästhetische Principien die jeweiligen architektonischen Ideale zu
verwirklichen gesucht. Auf verschiedenen Wegen sind Werke von höchst idealem
Charakter und künstlerischem Werth hervorgegangen, ohne desshalb durch diejenigen
Mittel entstanden zu sein, die wir hier als die Stilrichtung des Idealbaues bezeichnen.
Der Idealbau, von dem hier in erster Reihe die Rede ist, darf also nicht mit
einer Idealrichtung der Kunst im Allgemeinen verwechselt werden. Wir bezeichnen
mit diesem Worte eine ganz bestimmte Auffassung der architektonischen Composition.
Es ist diejenige, welche Bartolommeo Ammanati bewog, seine »Cittä Ideale« 800) zu
entwerfen und in dieser Weise zu bezeichnen. Diese Cittä Ideale besteht aus einer
Reihe von Entwürfen, in denen er die beste Form einer ganz neuen Stadt und
für sämmtliche Gebäudeclassen, die in derselben vorkommen mochten, festzustellen
sucht. Sie sind in der Voraussetzung angefertigt, dass keinerlei Terrainverhältnisse
oder andere Ursachen den Architekten verhindern, den Gebäuden diejenige Form zu
geben, die nach ihrer Natur denselben die denkbar vollkommenste Form verleihen
kann. Und doch hat Ammanati in den Einzelentwürfen nicht einmal die Richtung
so sehr befolgt, wie wir dies zuweilen bei anderen Italienern und Franzosen sehen.
Im Wesentlichen glaubt diese Stilrichtung ihrem Ziel zu nahen, wenn sie der Composition ihrer
Werke Formen zu Grunde legt, wie den Kreis, das Quadrat und regelmässige Figuren, die in sich schon
den Begriff einer objectiven vollkommenen Eigenschaft enthalten und folglich auch zu erwecken vermögen.
Ebenso wie die Materie nur im Zustande der Reinheit die höchste Erscheinung in der Form, die
Krystallisation, annehmen kann, ebenso glaubten die Meister dieser Richtung, es müsse der höchste Grad
der Schönheit mit der Reinheit der vollkommensten Formen in einem directen Zusammenhange slehen.
Daher ihre Verbindung mit einigen der regelmässigen geometrischen Figuren.
Ausser diesen geometrischen Figuren giebt es auch in der Natur, in der Landschaft Elemente, Formen,
Orte, welche unwiderstehlich den Eindruck des »Ideals eines höheren Seins« in unterem Innersten erwecken.
Im Anschluss an den strengen Idealbau des XVI. Jahrhunderts werden wir einige Beispiele anführen,
die aus solchen Quellen hervorgehen.
Nichts ist interessanter und spannender als Palliffy,'& eigene Schilderung von seinem Suchen nach
einer Idealform in der Natur, welche ihm das Vorbild für seine uneinnehmbare Stadt liefern könnte, und
wie er dasselbe endlich im Gehäuse der Purpurschnecke (Marex L.) gefunden zu haben glaubte. Im
Kapitel über die Städteanlagen werden wir auf seinen Plan zurückkommen.
Mögen diese Bestrebungen, welche in sehr verschiedenen Epochen, Ländern
und Stilen — in den Tempeln Cochinchinas wie in St. Peter in Rom wieder-
kehren — noch so roh, wild oder verkehrt sein, so sind sie selbst bei den ver-
kommensten Völkern und gesunkensten Menschen ein wenn auch kaum vernehmbares,
so doch wirkliches Echo der vom Schöpfer ursprünglich verliehenen Fähigkeiten, die
dem Menschen ermöglichen sollten, die ihm von Gott verliehene Mission und Be-
stimmung zu erfüllen, nach der Vollkommenheit zu ringen.
Demnach ist es selbstverständlich, dass der Idealbau und seine Quelle im engsten
Zusammenhang mit der Religion steht, ja in ihr begründet ist. Keine Religion aber
rechtfertigt ihn so sehr in allen Theilen wie das Christenthum, das als Ziel die
»objective« Vollkommenheit und nicht diejenige der menschlichen Einbildungen setzt.
80°) Sie besteht in einem Bande Zeichnungen in der Sammlung der Uffizien zu Florenz. Dieses Exemplar ist jedoch
ein Duplicat. Wir sahen 1882 bei einem Antiquar in Florenz ein Exemplar, das offenbar älter war.
499-
Definition
der
Richtung.
500.
Mittel.
501.
Idealbau
in der
Religion
begründet.
8. Kapitel.
Idealbau als Stilrichtung.
Je nach den Kunstepochen und Stilen hat man auf verschiedenen Wegen und
durch verschiedene ästhetische Principien die jeweiligen architektonischen Ideale zu
verwirklichen gesucht. Auf verschiedenen Wegen sind Werke von höchst idealem
Charakter und künstlerischem Werth hervorgegangen, ohne desshalb durch diejenigen
Mittel entstanden zu sein, die wir hier als die Stilrichtung des Idealbaues bezeichnen.
Der Idealbau, von dem hier in erster Reihe die Rede ist, darf also nicht mit
einer Idealrichtung der Kunst im Allgemeinen verwechselt werden. Wir bezeichnen
mit diesem Worte eine ganz bestimmte Auffassung der architektonischen Composition.
Es ist diejenige, welche Bartolommeo Ammanati bewog, seine »Cittä Ideale« 800) zu
entwerfen und in dieser Weise zu bezeichnen. Diese Cittä Ideale besteht aus einer
Reihe von Entwürfen, in denen er die beste Form einer ganz neuen Stadt und
für sämmtliche Gebäudeclassen, die in derselben vorkommen mochten, festzustellen
sucht. Sie sind in der Voraussetzung angefertigt, dass keinerlei Terrainverhältnisse
oder andere Ursachen den Architekten verhindern, den Gebäuden diejenige Form zu
geben, die nach ihrer Natur denselben die denkbar vollkommenste Form verleihen
kann. Und doch hat Ammanati in den Einzelentwürfen nicht einmal die Richtung
so sehr befolgt, wie wir dies zuweilen bei anderen Italienern und Franzosen sehen.
Im Wesentlichen glaubt diese Stilrichtung ihrem Ziel zu nahen, wenn sie der Composition ihrer
Werke Formen zu Grunde legt, wie den Kreis, das Quadrat und regelmässige Figuren, die in sich schon
den Begriff einer objectiven vollkommenen Eigenschaft enthalten und folglich auch zu erwecken vermögen.
Ebenso wie die Materie nur im Zustande der Reinheit die höchste Erscheinung in der Form, die
Krystallisation, annehmen kann, ebenso glaubten die Meister dieser Richtung, es müsse der höchste Grad
der Schönheit mit der Reinheit der vollkommensten Formen in einem directen Zusammenhange slehen.
Daher ihre Verbindung mit einigen der regelmässigen geometrischen Figuren.
Ausser diesen geometrischen Figuren giebt es auch in der Natur, in der Landschaft Elemente, Formen,
Orte, welche unwiderstehlich den Eindruck des »Ideals eines höheren Seins« in unterem Innersten erwecken.
Im Anschluss an den strengen Idealbau des XVI. Jahrhunderts werden wir einige Beispiele anführen,
die aus solchen Quellen hervorgehen.
Nichts ist interessanter und spannender als Palliffy,'& eigene Schilderung von seinem Suchen nach
einer Idealform in der Natur, welche ihm das Vorbild für seine uneinnehmbare Stadt liefern könnte, und
wie er dasselbe endlich im Gehäuse der Purpurschnecke (Marex L.) gefunden zu haben glaubte. Im
Kapitel über die Städteanlagen werden wir auf seinen Plan zurückkommen.
Mögen diese Bestrebungen, welche in sehr verschiedenen Epochen, Ländern
und Stilen — in den Tempeln Cochinchinas wie in St. Peter in Rom wieder-
kehren — noch so roh, wild oder verkehrt sein, so sind sie selbst bei den ver-
kommensten Völkern und gesunkensten Menschen ein wenn auch kaum vernehmbares,
so doch wirkliches Echo der vom Schöpfer ursprünglich verliehenen Fähigkeiten, die
dem Menschen ermöglichen sollten, die ihm von Gott verliehene Mission und Be-
stimmung zu erfüllen, nach der Vollkommenheit zu ringen.
Demnach ist es selbstverständlich, dass der Idealbau und seine Quelle im engsten
Zusammenhang mit der Religion steht, ja in ihr begründet ist. Keine Religion aber
rechtfertigt ihn so sehr in allen Theilen wie das Christenthum, das als Ziel die
»objective« Vollkommenheit und nicht diejenige der menschlichen Einbildungen setzt.
80°) Sie besteht in einem Bande Zeichnungen in der Sammlung der Uffizien zu Florenz. Dieses Exemplar ist jedoch
ein Duplicat. Wir sahen 1882 bei einem Antiquar in Florenz ein Exemplar, das offenbar älter war.