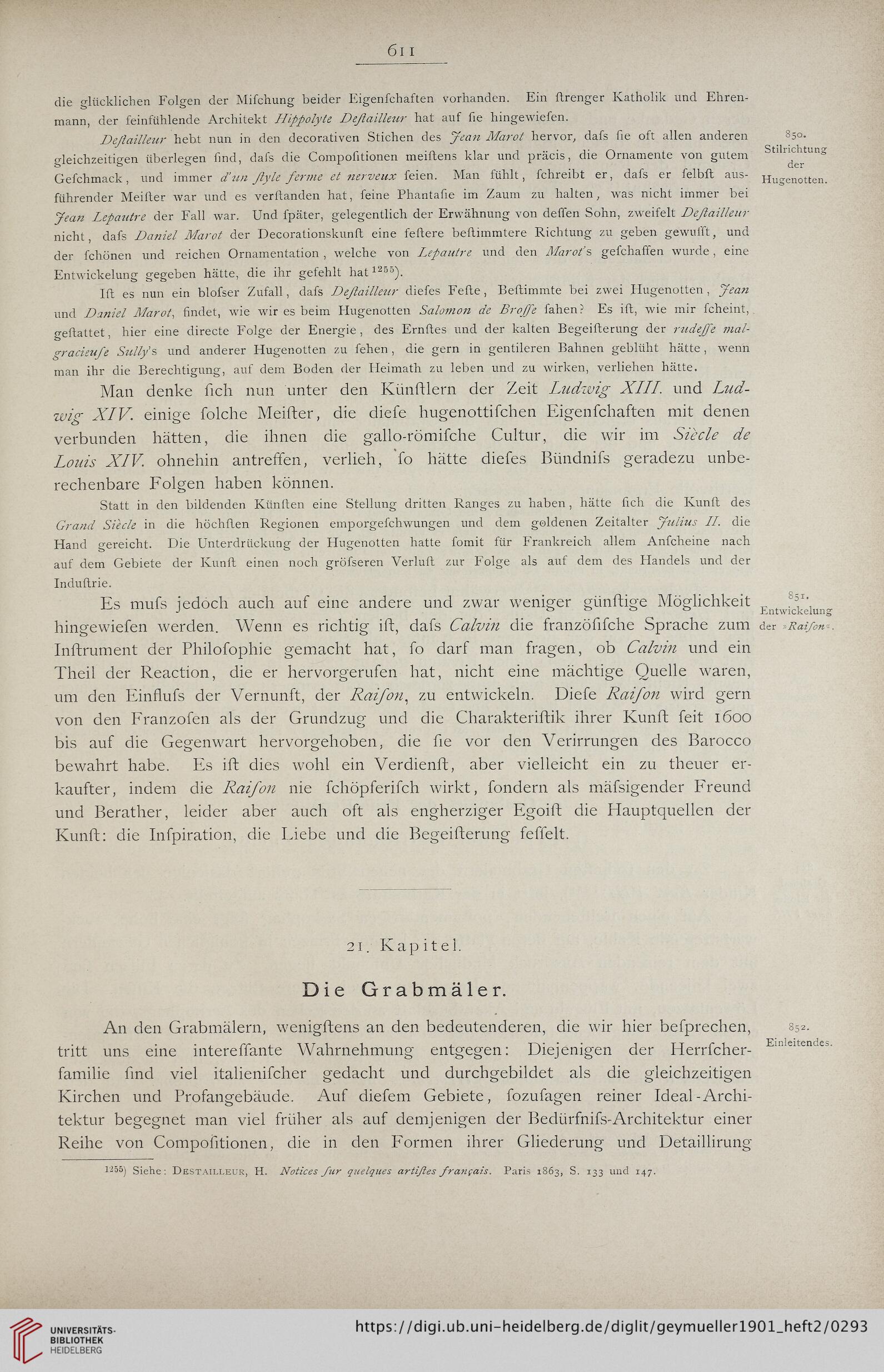611
die glücklichen Folgen der Mischung beider Eigenschaften vorhanden. Ein strenger Katholik und Ehren-
mann, der feinfühlende Architekt Hippolyte Deßailleur hat auf sie hingewiesen.
Deßailleur hebt nun in den decorativen Stichen des Jean Marot hervor, dass sie oft allen anderen 850.
gleichzeitigen überlegen sind, dass die Compositionen meistens klar und präcis, die Ornamente von gutem Stilrichtung
Geschmack, und immer d’un ßyle ferme et nerveux seien. Man fühlt, schreibt er, dass er selbsl aus- Hugenotten
führender Meister war und es verstanden hat, seine Phantasie im Zaum zu halten, was nicht immer bei
Jean Lepautre der Fall war. Und später, gelegentlich der Erwähnung von dessen Sohn, zweifelt Deßailleur
nicht, dass Daniel Marot der Decorationskunst eine feilere bellimmtere Richtung zu geben gewußt, und
der schönen und reichen Ornamentation , welche von Lepautre und den Marot’s geschaffen wurde, eine
Entwickelung gegeben hätte, die ihr gefehlt hat 1255).
Ist es nun ein blosser Zufall, dass Deßailleur dieses Felle, Beslimmte bei zwei Hugenotten, Jean
und Daniel Marot, findet, wie wir es beim Hugenotten Salomon de Broffe sahen? Es ist, wie mir scheint,
gellattet, hier eine directe Folge der Energie, des Ernsles und der kalten Begeisterung der rudefse mal-
gracieuse Sully's und anderer Hugenotten zu sehen, die gern in gentileren Bahnen geblüht hätte, wenn
man ihr die Berechtigung, auf dem Boden der Heimath zu leben und zu wirken, verliehen hätte.
Man denke sich nun unter den Künstlern der Zeit Ludwig XIII. und Lud-
wig XIV. einige solche Meister, die diese hugenottischen Eigenschaften mit denen
verbunden hätten, die ihnen die gallo-römische Cultur, die wir im Siecle de
Louis XIV. ohnehin antreffen, verlieh, so hätte dieses Bündniss geradezu unbe-
rechenbare Folgen haben können.
Statt in den bildenden Künslen eine Stellung dritten Ranges zu haben, hätte sich die Kunst des
Grand Siecle in die höchsten Regionen emporgeschwungen und dem goldenen Zeitalter Julius II. die
Hand gereicht. Die Unterdrückung der Hugenotten hatte somit für Frankreich allem Anscheine nach
auf dem Gebiete der Kunst einen noch grösseren Verlust zur Folge als auf dem des Handels und der
Industrie.
Es muss jedoch auch auf eine andere und zwar weniger günstige Möglichkeit E t "jj".
hingewiesen werden. Wenn es richtig ist, dass Calvin die französische Sprache zum der Raison-.
Instrument der Philosophie gemacht hat, so darf man fragen, ob Calvin und ein
Theil der Reaction, die er hervorgerufen hat, nicht eine mächtige Quelle waren,
um den Einssuss der Vernunft, der Raifon, zu entwickeln. Diese Raifon wird gern
von den Franzosen als der Grundzug und die Charakteristik ihrer Kunst seit 1600
bis auf die Gegenwart hervorgehoben, die sie vor den Verirrungen des Barocco
bewahrt habe. Es ist dies wohl ein Verdienst, aber vielleicht ein zu theuer er-
kaufter, indem die Raifon nie schöpferisch wirkt, sondern als mässigender Freund
und Berather, leider aber auch oft als engherziger Egoist die Hauptquellen der
Kunst: die Inspiration, die Liebe und die Begeisterung fesselt.
21. Kapitel.
Die Grabmäler.
An den Grabmälern, wenigstens an den bedeutenderen, die wir hier besprechen, 852.
tritt uns eine interessante Wahrnehmung entgegen: Diejenigen der Herrscher- Einleiten'eä
familie sind viel italienischer gedacht und durchgebildet als die gleichzeitigen
Kirchen und Profangebäude. Auf diesem Gebiete, sozusagen reiner Ideal-Archi-
tektur begegnet man viel früher als auf demjenigen der Bedürfniss-Architektur einer
Reihe von Compositionen, die in den Formen ihrer Gliederung und Detaillirung
1255) Siehe: Destailleur, H. Notices Jur quelques artißes fran^ais. Paris 1863, S. 133 und 147.
die glücklichen Folgen der Mischung beider Eigenschaften vorhanden. Ein strenger Katholik und Ehren-
mann, der feinfühlende Architekt Hippolyte Deßailleur hat auf sie hingewiesen.
Deßailleur hebt nun in den decorativen Stichen des Jean Marot hervor, dass sie oft allen anderen 850.
gleichzeitigen überlegen sind, dass die Compositionen meistens klar und präcis, die Ornamente von gutem Stilrichtung
Geschmack, und immer d’un ßyle ferme et nerveux seien. Man fühlt, schreibt er, dass er selbsl aus- Hugenotten
führender Meister war und es verstanden hat, seine Phantasie im Zaum zu halten, was nicht immer bei
Jean Lepautre der Fall war. Und später, gelegentlich der Erwähnung von dessen Sohn, zweifelt Deßailleur
nicht, dass Daniel Marot der Decorationskunst eine feilere bellimmtere Richtung zu geben gewußt, und
der schönen und reichen Ornamentation , welche von Lepautre und den Marot’s geschaffen wurde, eine
Entwickelung gegeben hätte, die ihr gefehlt hat 1255).
Ist es nun ein blosser Zufall, dass Deßailleur dieses Felle, Beslimmte bei zwei Hugenotten, Jean
und Daniel Marot, findet, wie wir es beim Hugenotten Salomon de Broffe sahen? Es ist, wie mir scheint,
gellattet, hier eine directe Folge der Energie, des Ernsles und der kalten Begeisterung der rudefse mal-
gracieuse Sully's und anderer Hugenotten zu sehen, die gern in gentileren Bahnen geblüht hätte, wenn
man ihr die Berechtigung, auf dem Boden der Heimath zu leben und zu wirken, verliehen hätte.
Man denke sich nun unter den Künstlern der Zeit Ludwig XIII. und Lud-
wig XIV. einige solche Meister, die diese hugenottischen Eigenschaften mit denen
verbunden hätten, die ihnen die gallo-römische Cultur, die wir im Siecle de
Louis XIV. ohnehin antreffen, verlieh, so hätte dieses Bündniss geradezu unbe-
rechenbare Folgen haben können.
Statt in den bildenden Künslen eine Stellung dritten Ranges zu haben, hätte sich die Kunst des
Grand Siecle in die höchsten Regionen emporgeschwungen und dem goldenen Zeitalter Julius II. die
Hand gereicht. Die Unterdrückung der Hugenotten hatte somit für Frankreich allem Anscheine nach
auf dem Gebiete der Kunst einen noch grösseren Verlust zur Folge als auf dem des Handels und der
Industrie.
Es muss jedoch auch auf eine andere und zwar weniger günstige Möglichkeit E t "jj".
hingewiesen werden. Wenn es richtig ist, dass Calvin die französische Sprache zum der Raison-.
Instrument der Philosophie gemacht hat, so darf man fragen, ob Calvin und ein
Theil der Reaction, die er hervorgerufen hat, nicht eine mächtige Quelle waren,
um den Einssuss der Vernunft, der Raifon, zu entwickeln. Diese Raifon wird gern
von den Franzosen als der Grundzug und die Charakteristik ihrer Kunst seit 1600
bis auf die Gegenwart hervorgehoben, die sie vor den Verirrungen des Barocco
bewahrt habe. Es ist dies wohl ein Verdienst, aber vielleicht ein zu theuer er-
kaufter, indem die Raifon nie schöpferisch wirkt, sondern als mässigender Freund
und Berather, leider aber auch oft als engherziger Egoist die Hauptquellen der
Kunst: die Inspiration, die Liebe und die Begeisterung fesselt.
21. Kapitel.
Die Grabmäler.
An den Grabmälern, wenigstens an den bedeutenderen, die wir hier besprechen, 852.
tritt uns eine interessante Wahrnehmung entgegen: Diejenigen der Herrscher- Einleiten'eä
familie sind viel italienischer gedacht und durchgebildet als die gleichzeitigen
Kirchen und Profangebäude. Auf diesem Gebiete, sozusagen reiner Ideal-Archi-
tektur begegnet man viel früher als auf demjenigen der Bedürfniss-Architektur einer
Reihe von Compositionen, die in den Formen ihrer Gliederung und Detaillirung
1255) Siehe: Destailleur, H. Notices Jur quelques artißes fran^ais. Paris 1863, S. 133 und 147.