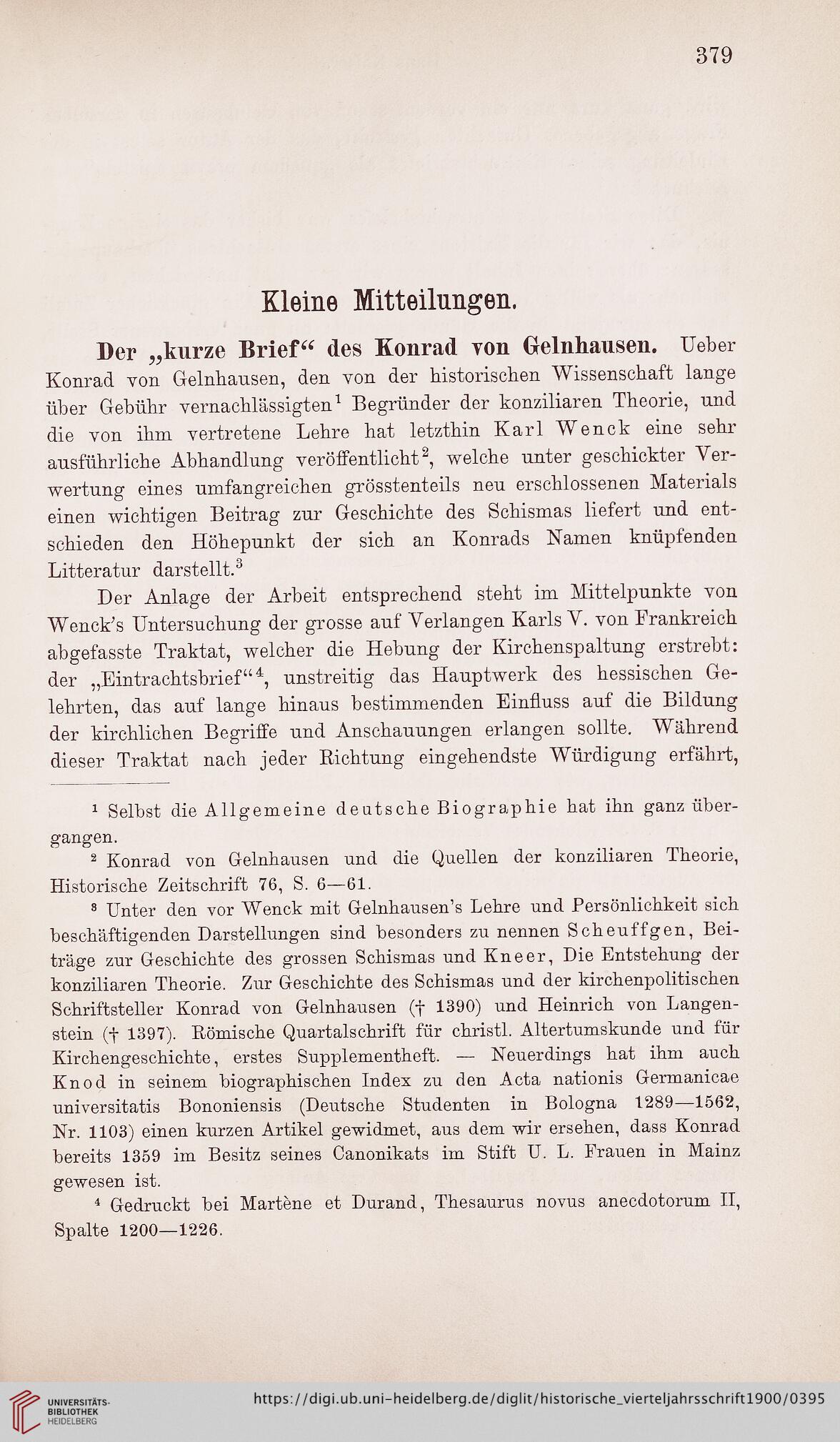379
Kleine Mitteilungen.
Der „kurze Brief“ des Kourad von Gelnhausen. Ueber
Konrad von Gelnhausen, den von der historischen Wissenschaft lange
über Gebühr vernachlässigten1 Begründer der konziliaren Theorie, und
die von ihm vertretene Lehre hat letzthin Karl Wenck eine sehr
ausführliche Abhandlung veröffentlicht2, welche unter geschickter Ver-
wertung eines umfangreichen grösstenteils neu erschlossenen Materials
einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des Schismas liefert und ent-
schieden den Höhepunkt der sich an Konrads Namen knüpfenden
Litteratur darstellt.3
Der Anlage der Arbeit entsprechend steht im Mittelpunkte von
Wenck’s Untersuchung der grosse auf Verlangen Karls V. von Frankreich
abgefasste Traktat, welcher die Hebung der Kirchenspaltung erstrebt:
der „Eintrachtsbrief“4, unstreitig das Hauptwerk des hessischen Ge-
lehrten, das auf lange hinaus bestimmenden Einfluss auf die Bildung
der kirchlichen Begriffe und Anschauungen erlangen sollte. Während
dieser Traktat nach jeder Richtung eingehendste Würdigung erfährt,
1 Selbst die Allgemeine deutsche Biographie hat ihn ganz über-
gangen.
2 Konrad von Gelnhausen und die Quellen der konziliaren Theorie,
Historische Zeitschrift 76, S. 6—61.
3 Unter den vor Wenck mit Gelnhausen’s Lehre und Persönlichkeit sich
beschäftigenden Darstellungen sind besonders zu nennen Scheuffgen, Bei-
träge zur Geschichte des grossen Schismas und Kneer, Die Entstehung der
konziliaren Theorie. Zur Geschichte des Schismas und der kirchenpolitischen
Schriftsteller Konrad von Gelnhausen (j- 1390) und Heinrich von Langen-
stein (f 1397). Römische Quartalschrift für christl. Altertumskunde und für
Kirchengeschichte, erstes Supplementheft. — Neuerdings hat ihm auch
Knod in seinem biographischen Index zu den Acta nationis Germanicae
universitatis Bononiensis (Deutsche Studenten in Bologna 1289—1562,
Nr. 1103) einen kurzen Artikel gewidmet, aus dem wir ersehen, dass Konrad
bereits 1359 im Besitz seines Canonikats im Stift U. L. Frauen in Mainz
gewesen ist.
4 Gedruckt bei Marten e et Durand, Thesaurus novus anecdotorum II,
Spalte 1200—1226.
Kleine Mitteilungen.
Der „kurze Brief“ des Kourad von Gelnhausen. Ueber
Konrad von Gelnhausen, den von der historischen Wissenschaft lange
über Gebühr vernachlässigten1 Begründer der konziliaren Theorie, und
die von ihm vertretene Lehre hat letzthin Karl Wenck eine sehr
ausführliche Abhandlung veröffentlicht2, welche unter geschickter Ver-
wertung eines umfangreichen grösstenteils neu erschlossenen Materials
einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des Schismas liefert und ent-
schieden den Höhepunkt der sich an Konrads Namen knüpfenden
Litteratur darstellt.3
Der Anlage der Arbeit entsprechend steht im Mittelpunkte von
Wenck’s Untersuchung der grosse auf Verlangen Karls V. von Frankreich
abgefasste Traktat, welcher die Hebung der Kirchenspaltung erstrebt:
der „Eintrachtsbrief“4, unstreitig das Hauptwerk des hessischen Ge-
lehrten, das auf lange hinaus bestimmenden Einfluss auf die Bildung
der kirchlichen Begriffe und Anschauungen erlangen sollte. Während
dieser Traktat nach jeder Richtung eingehendste Würdigung erfährt,
1 Selbst die Allgemeine deutsche Biographie hat ihn ganz über-
gangen.
2 Konrad von Gelnhausen und die Quellen der konziliaren Theorie,
Historische Zeitschrift 76, S. 6—61.
3 Unter den vor Wenck mit Gelnhausen’s Lehre und Persönlichkeit sich
beschäftigenden Darstellungen sind besonders zu nennen Scheuffgen, Bei-
träge zur Geschichte des grossen Schismas und Kneer, Die Entstehung der
konziliaren Theorie. Zur Geschichte des Schismas und der kirchenpolitischen
Schriftsteller Konrad von Gelnhausen (j- 1390) und Heinrich von Langen-
stein (f 1397). Römische Quartalschrift für christl. Altertumskunde und für
Kirchengeschichte, erstes Supplementheft. — Neuerdings hat ihm auch
Knod in seinem biographischen Index zu den Acta nationis Germanicae
universitatis Bononiensis (Deutsche Studenten in Bologna 1289—1562,
Nr. 1103) einen kurzen Artikel gewidmet, aus dem wir ersehen, dass Konrad
bereits 1359 im Besitz seines Canonikats im Stift U. L. Frauen in Mainz
gewesen ist.
4 Gedruckt bei Marten e et Durand, Thesaurus novus anecdotorum II,
Spalte 1200—1226.