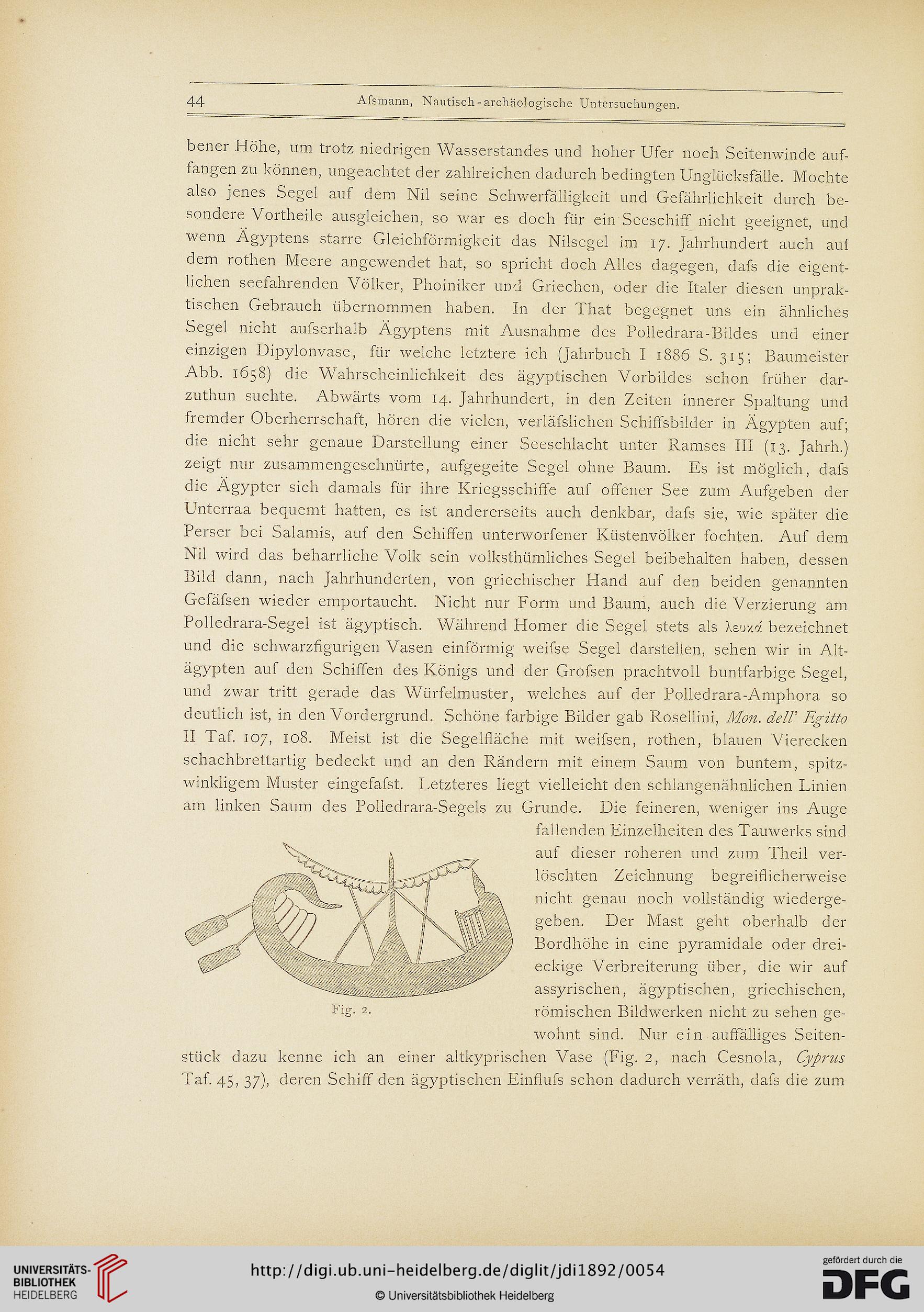44
Afsmann, Nautisch - archäologische Untersuchungen.
bener Höhe, um trotz niedrigen Wasserstandes und hoher Ufer noch Seitenwinde auf-
fangen zu können, ungeachtet der zahlreichen dadurch bedingten Unglücksfälle. Mochte
also jenes Segel auf dem Nil seine Schwerfälligkeit und Gefährlichkeit durch be-
sondere Vortheile ausgleichen, so war es doch für ein Seeschiff nicht geeignet, und
wenn Ägyptens starre Gleichförmigkeit das Nilsegel im 17. Jahrhundert auch aut
dem rothen Meere angewendet hat, so spricht doch Alles dagegen, dafs die eigent-
lichen seefahrenden Völker, Phoiniker und Griechen, oder die Italer diesen unprak-
tischen Gebrauch übernommen haben. In der That begegnet uns ein ähnliches
Segel nicht aufserhalb Ägyptens mit Ausnahme des Polledrara-Bildes und einer
einzigen Dipylonvase, für welche letztere ich (Jahrbuch I 1886 S. 315; Baumeister
Abb. 1658) die Wahrscheinlichkeit des ägyptischen Vorbildes schon früher dar-
zuthun suchte. Abwärts vom 14. Jahrhundert, in den Zeiten innerer Spaltung und
fremder Oberherrschaft, hören die vielen, verläfslichen Schiffsbilder in Ägypten auf;
die nicht sehr genaue Darstellung einer Seeschlacht unter Ramses III (13. Jahrh.)
zeigt nur zusammengeschnürte, aufgegeite Segel ohne Baum. Es ist möglich, dafs
die Ägypter sich damals für ihre Kriegsschiffe auf offener See zum Aufgeben der
Unterraa bequemt hatten, es ist andererseits auch denkbar, dafs sie, wie später die
Perser bei Salamis, auf den Schiffen unterworfener Küstenvölker fochten. Auf dem
Nil wird das beharrliche Volk sein volksthümliches Segel beibehalten haben, dessen
Bild dann, nach Jahrhunderten, von griechischer Hand auf den beiden genannten
Gefäfsen wieder emportaucht. Nicht nur Form und Baum, auch die Verzierung am
Polledrara-Segel ist ägyptisch. Während Homer die Segel stets als Xeuxa bezeichnet
und die schwarzfigurigen Vasen einförmig weifse Segel darstellen, sehen wir in Alt-
ägypten auf den Schiffen des Königs und der Grofsen prachtvoll buntfarbige Segel,
und zwar tritt gerade das Würfelmuster, welches auf der Polledrara-Amphora so
deutlich ist, in den Vordergrund. Schöne farbige Bilder gab Rosellini, Mon. deIV Egitto
II Taf. 107, 108. Meist ist die Segelfläche mit weifsen, rothen, blauen Vierecken
schachbrettartig bedeckt und an den Rändern mit einem Saum von buntem, spitz-
winkligem Muster eingefafst. Letzteres liegt vielleicht den schlangenähnlichen Linien
am linken Saum des Polledrara-Segels zu Grunde. Die feineren, weniger ins Auge
fallenden Einzelheiten des Tauwerks sind
auf dieser roheren und zum Theil ver-
löschten Zeichnung begreiflicherweise
nicht genau noch vollständig wiederge-
geben. Der Mast geht oberhalb der
Bordhöhe in eine pyramidale oder drei-
eckige Verbreiterung über, die wir auf
assyrischen, ägyptischen, griechischen,
römischen Bildwerken nicht zu sehen ge-
wohnt sind. Nur ein auffälliges Seiten-
stück dazu kenne ich an einer altkyprischen Vase (Pig. 2, nach Cesnola, Cyprus
Taf. 45, 37), deren Schiff den ägyptischen Einflufs schon dadurch verräth, dafs die zum
Afsmann, Nautisch - archäologische Untersuchungen.
bener Höhe, um trotz niedrigen Wasserstandes und hoher Ufer noch Seitenwinde auf-
fangen zu können, ungeachtet der zahlreichen dadurch bedingten Unglücksfälle. Mochte
also jenes Segel auf dem Nil seine Schwerfälligkeit und Gefährlichkeit durch be-
sondere Vortheile ausgleichen, so war es doch für ein Seeschiff nicht geeignet, und
wenn Ägyptens starre Gleichförmigkeit das Nilsegel im 17. Jahrhundert auch aut
dem rothen Meere angewendet hat, so spricht doch Alles dagegen, dafs die eigent-
lichen seefahrenden Völker, Phoiniker und Griechen, oder die Italer diesen unprak-
tischen Gebrauch übernommen haben. In der That begegnet uns ein ähnliches
Segel nicht aufserhalb Ägyptens mit Ausnahme des Polledrara-Bildes und einer
einzigen Dipylonvase, für welche letztere ich (Jahrbuch I 1886 S. 315; Baumeister
Abb. 1658) die Wahrscheinlichkeit des ägyptischen Vorbildes schon früher dar-
zuthun suchte. Abwärts vom 14. Jahrhundert, in den Zeiten innerer Spaltung und
fremder Oberherrschaft, hören die vielen, verläfslichen Schiffsbilder in Ägypten auf;
die nicht sehr genaue Darstellung einer Seeschlacht unter Ramses III (13. Jahrh.)
zeigt nur zusammengeschnürte, aufgegeite Segel ohne Baum. Es ist möglich, dafs
die Ägypter sich damals für ihre Kriegsschiffe auf offener See zum Aufgeben der
Unterraa bequemt hatten, es ist andererseits auch denkbar, dafs sie, wie später die
Perser bei Salamis, auf den Schiffen unterworfener Küstenvölker fochten. Auf dem
Nil wird das beharrliche Volk sein volksthümliches Segel beibehalten haben, dessen
Bild dann, nach Jahrhunderten, von griechischer Hand auf den beiden genannten
Gefäfsen wieder emportaucht. Nicht nur Form und Baum, auch die Verzierung am
Polledrara-Segel ist ägyptisch. Während Homer die Segel stets als Xeuxa bezeichnet
und die schwarzfigurigen Vasen einförmig weifse Segel darstellen, sehen wir in Alt-
ägypten auf den Schiffen des Königs und der Grofsen prachtvoll buntfarbige Segel,
und zwar tritt gerade das Würfelmuster, welches auf der Polledrara-Amphora so
deutlich ist, in den Vordergrund. Schöne farbige Bilder gab Rosellini, Mon. deIV Egitto
II Taf. 107, 108. Meist ist die Segelfläche mit weifsen, rothen, blauen Vierecken
schachbrettartig bedeckt und an den Rändern mit einem Saum von buntem, spitz-
winkligem Muster eingefafst. Letzteres liegt vielleicht den schlangenähnlichen Linien
am linken Saum des Polledrara-Segels zu Grunde. Die feineren, weniger ins Auge
fallenden Einzelheiten des Tauwerks sind
auf dieser roheren und zum Theil ver-
löschten Zeichnung begreiflicherweise
nicht genau noch vollständig wiederge-
geben. Der Mast geht oberhalb der
Bordhöhe in eine pyramidale oder drei-
eckige Verbreiterung über, die wir auf
assyrischen, ägyptischen, griechischen,
römischen Bildwerken nicht zu sehen ge-
wohnt sind. Nur ein auffälliges Seiten-
stück dazu kenne ich an einer altkyprischen Vase (Pig. 2, nach Cesnola, Cyprus
Taf. 45, 37), deren Schiff den ägyptischen Einflufs schon dadurch verräth, dafs die zum