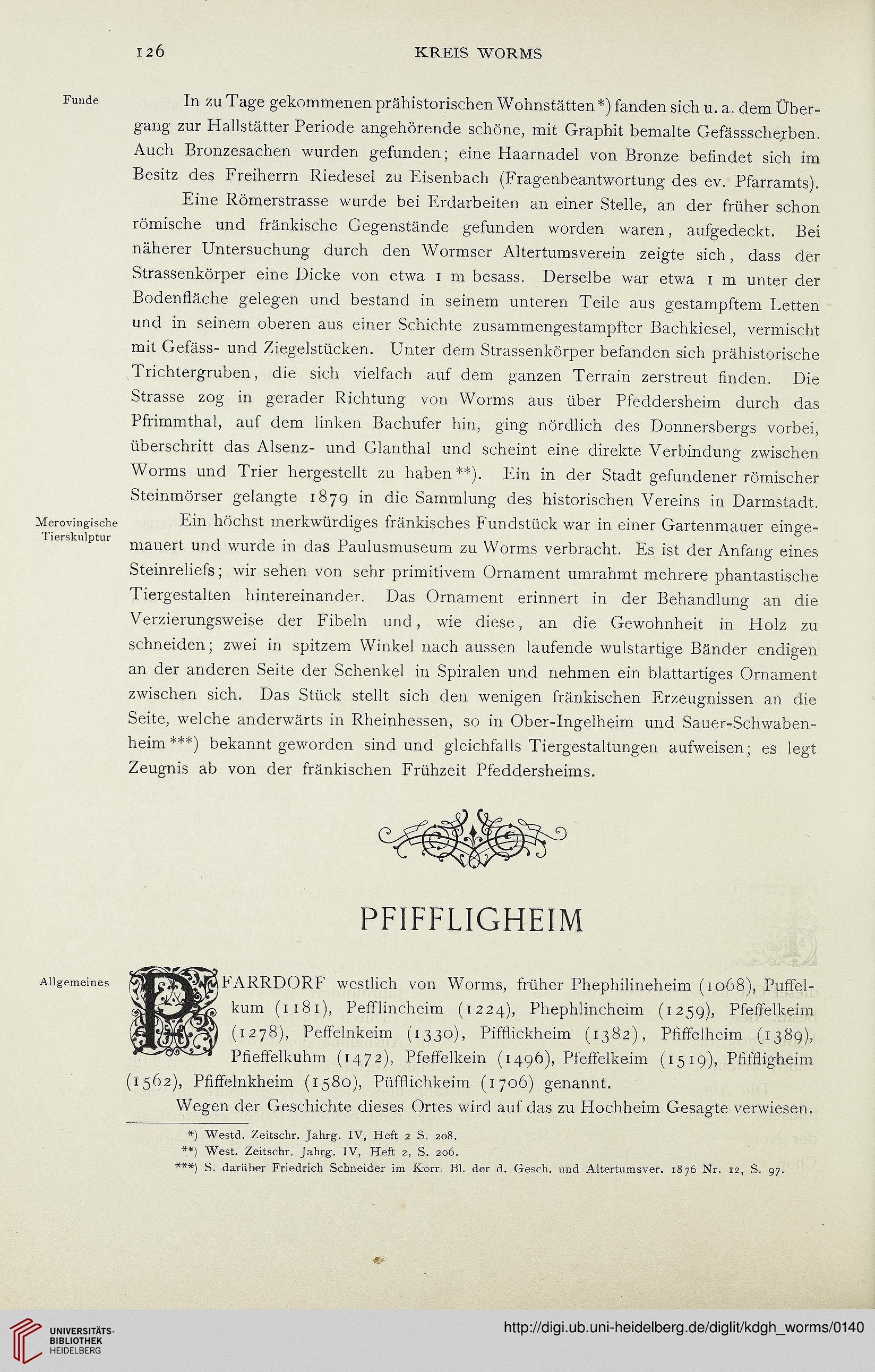126 KREIS WORMS
Fmde In zu Tage gekommenen prähistorischen Wohnstätten*) fanden sich u. a. dem Über-
gang zur Hallstätter Periode angehörende schöne, mit Graphit bemalte Gefässscherben.
Auch Bronzesachen wurden gefunden; eine Haarnadel von Bronze befindet sich im
Besitz des Freiherrn Riedesel zu Eisenbach (Fragenbeantwortung des ev. Pfarramts).
Eine Römerstrasse wurde bei Erdarbeiten an einer Stelle, an der früher schon
römische und fränkische Gegenstände gefunden worden waren, aufgedeckt. Bei
näherer Untersuchung durch den Wormser Altertumsverein zeigte sich, dass der
Strassenkörper eine Dicke von etwa i m besass. Derselbe war etwa i m unter der
Bodenfläche gelegen und bestand in seinem unteren Teile aus gestampftem Letten
und in seinem oberen aus einer Schichte zusammengestampfter Bachkiesel, vermischt
mit Gefäss- und Ziegelstücken. Unter dem Strassenkörper befanden sich prähistorische
Trichtergruben, die sich vielfach auf dem ganzen Terrain zerstreut finden. Die
Strasse zog in gerader Richtung von Worms aus über Pfeddersheim durch das
Pfrimmthal, auf dem linken Bachufer hin, ging nördlich des Donnersbergs vorbei,
überschritt das Alsenz- und Glanthal und scheint eine direkte Verbindung zwischen
Worms und Trier hergestellt zu haben**). Ein in der Stadt gefundener römischer
Steinmörser gelangte 1879 in die Sammlung des historischen Vereins in Darmstadt.
Merovingische Ein höchst merkwürdiges fränkisches Fundstück war in einer Gartenmauer einge-
mauert und wurde in das Paulusmuseum zu Worms verbracht. Es ist der Anfang eines
Steinreliefs; wir sehen von sehr primitivem Ornament umrahmt mehrere phantastische
Tiergestalten hintereinander. Das Ornament erinnert in der Behandlung an die
Verzierungsweise der Fibeln und, wie diese, an die Gewohnheit in Holz zu
schneiden; zwei in spitzem Winkel nach aussen laufende wulstartige Bänder endigen
an der anderen Seite der Schenkel in Spiralen und nehmen ein blattartiges Ornament
zwischen sich. Das Stück stellt sich den wenigen fränkischen Erzeugnissen an die
Seite, welche anderwärts in Rheinhessen, so in Ober-Ingelheim und Sauer-Schwaben-
heim ***) bekanntgeworden sind und gleichfalls Tiergestaltungen aufweisen; es legt
Zeugnis ab von der fränkischen Frühzeit Pfeddersheims.
Tierskulptur
PFIFFLIGHEIM
Allgemeines M] J^3tk^iJ& F.\ R KlJ< )RF westlich von Worms, früher Phephilineheim (1068), Puffel-
kum (1 181), Pefflincheim (1224), Phephlincheim (125g), Pfeffelkeim
(1278), Peffelnkeim (1330), Pifflickheim (1382), Pfiffelheim (1389),
Pfieffelkuhm (1472), Pfeffelkein (1496), Pfeffelkeim (1519), Pfiffligheim
(1562), Pfiffelnkheim (1580), Püfflichkeim (1706) genannt.
Wegen der Geschichte dieses Ortes wird auf das zu Hochheim Gesagte verwiesen.
*) Westd. Zeitschr. Jahrg. IV, Heft 2 S. 208.
**) West. Zeitschr. Jahrg. IV, Heft 2, S. 206.
***) S. darüber Friedrich Schneider im Korr. Bl. der d. Gesch. und Altertumsver. 1876 Nr. 12, S. 97.
Fmde In zu Tage gekommenen prähistorischen Wohnstätten*) fanden sich u. a. dem Über-
gang zur Hallstätter Periode angehörende schöne, mit Graphit bemalte Gefässscherben.
Auch Bronzesachen wurden gefunden; eine Haarnadel von Bronze befindet sich im
Besitz des Freiherrn Riedesel zu Eisenbach (Fragenbeantwortung des ev. Pfarramts).
Eine Römerstrasse wurde bei Erdarbeiten an einer Stelle, an der früher schon
römische und fränkische Gegenstände gefunden worden waren, aufgedeckt. Bei
näherer Untersuchung durch den Wormser Altertumsverein zeigte sich, dass der
Strassenkörper eine Dicke von etwa i m besass. Derselbe war etwa i m unter der
Bodenfläche gelegen und bestand in seinem unteren Teile aus gestampftem Letten
und in seinem oberen aus einer Schichte zusammengestampfter Bachkiesel, vermischt
mit Gefäss- und Ziegelstücken. Unter dem Strassenkörper befanden sich prähistorische
Trichtergruben, die sich vielfach auf dem ganzen Terrain zerstreut finden. Die
Strasse zog in gerader Richtung von Worms aus über Pfeddersheim durch das
Pfrimmthal, auf dem linken Bachufer hin, ging nördlich des Donnersbergs vorbei,
überschritt das Alsenz- und Glanthal und scheint eine direkte Verbindung zwischen
Worms und Trier hergestellt zu haben**). Ein in der Stadt gefundener römischer
Steinmörser gelangte 1879 in die Sammlung des historischen Vereins in Darmstadt.
Merovingische Ein höchst merkwürdiges fränkisches Fundstück war in einer Gartenmauer einge-
mauert und wurde in das Paulusmuseum zu Worms verbracht. Es ist der Anfang eines
Steinreliefs; wir sehen von sehr primitivem Ornament umrahmt mehrere phantastische
Tiergestalten hintereinander. Das Ornament erinnert in der Behandlung an die
Verzierungsweise der Fibeln und, wie diese, an die Gewohnheit in Holz zu
schneiden; zwei in spitzem Winkel nach aussen laufende wulstartige Bänder endigen
an der anderen Seite der Schenkel in Spiralen und nehmen ein blattartiges Ornament
zwischen sich. Das Stück stellt sich den wenigen fränkischen Erzeugnissen an die
Seite, welche anderwärts in Rheinhessen, so in Ober-Ingelheim und Sauer-Schwaben-
heim ***) bekanntgeworden sind und gleichfalls Tiergestaltungen aufweisen; es legt
Zeugnis ab von der fränkischen Frühzeit Pfeddersheims.
Tierskulptur
PFIFFLIGHEIM
Allgemeines M] J^3tk^iJ& F.\ R KlJ< )RF westlich von Worms, früher Phephilineheim (1068), Puffel-
kum (1 181), Pefflincheim (1224), Phephlincheim (125g), Pfeffelkeim
(1278), Peffelnkeim (1330), Pifflickheim (1382), Pfiffelheim (1389),
Pfieffelkuhm (1472), Pfeffelkein (1496), Pfeffelkeim (1519), Pfiffligheim
(1562), Pfiffelnkheim (1580), Püfflichkeim (1706) genannt.
Wegen der Geschichte dieses Ortes wird auf das zu Hochheim Gesagte verwiesen.
*) Westd. Zeitschr. Jahrg. IV, Heft 2 S. 208.
**) West. Zeitschr. Jahrg. IV, Heft 2, S. 206.
***) S. darüber Friedrich Schneider im Korr. Bl. der d. Gesch. und Altertumsver. 1876 Nr. 12, S. 97.