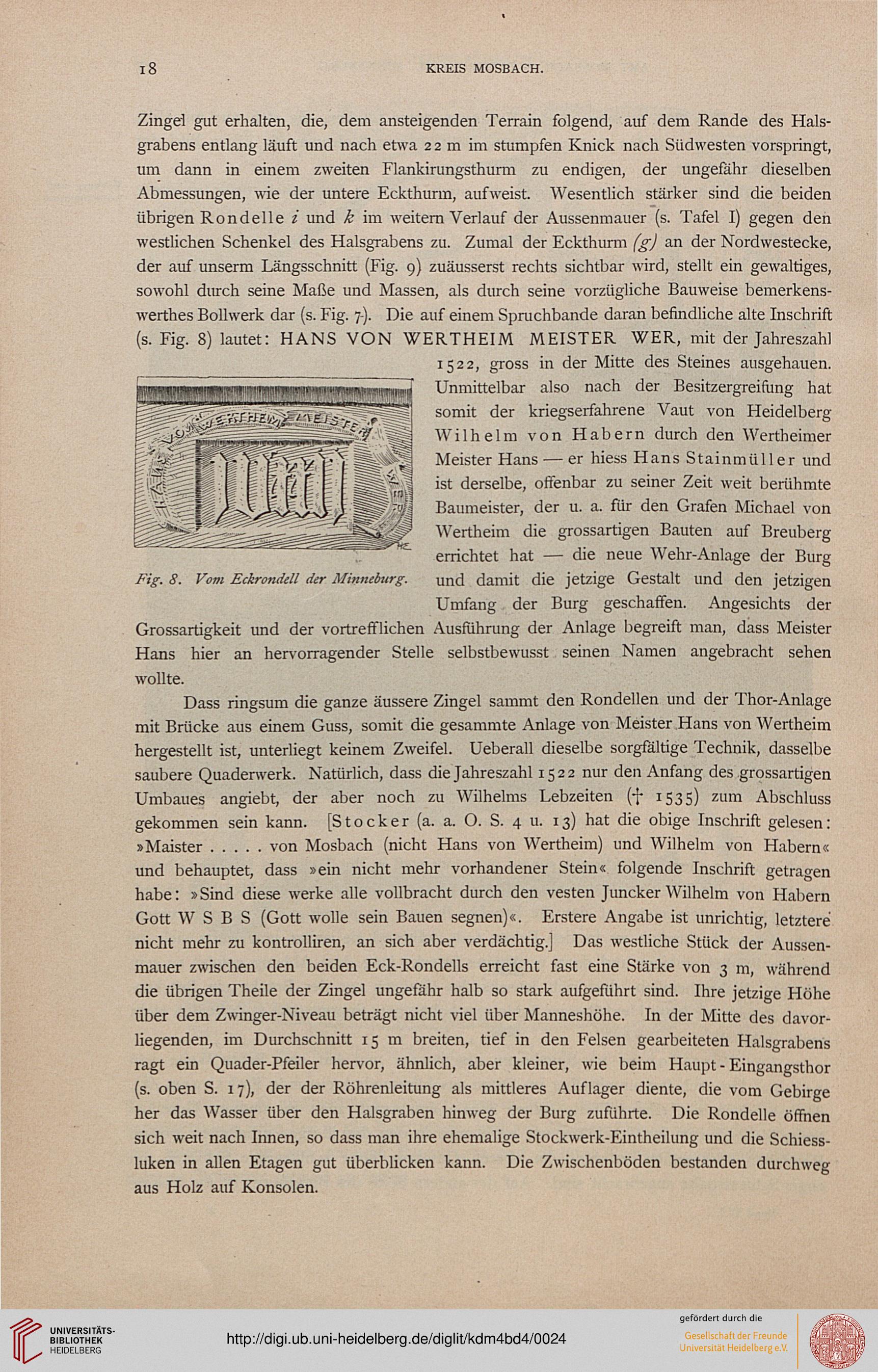i8
KREIS MOSBACH.
Fig. 8. Vom Eckrondell der Minneburg.
Zingei gut erhalten, die, dem ansteigenden Terrain folgend, auf dem Rande des Hals-
grabens entlang läuft und nach etwa 22m im stumpfen Knick nach Südwesten vorspringt,
um dann in einem zweiten Flankirungsthurm zu endigen, der ungefähr dieselben
Abmessungen, wie der untere Eckthurm, aufweist. Wesentlich stärker sind die beiden
übrigen Rondelle i und k im weitem Verlauf der Aussenmauer (s. Tafel I) gegen den
westlichen Schenkel des Halsgrabens zu. Zumal der Eckthurm (g) an der Nordwestecke,
der auf unserm Längsschnitt (Fig. 9) zuäusserst rechts sichtbar wird, stellt ein gewaltiges,
sowohl durch seine Maße und Massen, als durch seine vorzügliche Bauweise bemerkens-
werthes Bollwerk dar (s. Fig. 7-). Die auf einem Spruchbande daran befindliche alte Inschrift
(s. Fig. 8) lautet: HANS VON WERTHEIM MEISTER WER, mit der Jahreszahl
1522, gross in der Mitte des Steines ausgehauen.
Unmittelbar also nach der Besitzergreifung hat
somit der kriegserfahrene Vaut von Heidelberg
Wilhelm von Habern durch den Wertheimer
Meister Hans — er hiess Hans Stainmüller und
ist derselbe, offenbar zu seiner Zeit weit berühmte
Baumeister, der u. a. für den Grafen Michael von
Wertheim die grossartigen Bauten auf Breuberg
errichtet hat — die neue Wehr-Anlage der Burg
und damit die jetzige Gestalt und den jetzigen
Umfang der Burg geschaffen. Angesichts der
Grossartigkeit und der vortrefflichen Ausführung der Anlage begreift man, dass Meister
Hans hier an hervorragender Stelle selbstbewusst seinen Namen angebracht sehen
wollte.
Dass ringsum die ganze äussere Zingei sammt den Rondellen und der Thor-Anlage
mit Brücke aus einem Guss, somit die gesammte Anlage von Meister Hans von Wertheim
hergestellt ist, unterliegt keinem Zweifel. Ueberall dieselbe sorgfältige Technik, dasselbe
saubere Quadenverk. Natürlich, dass die Jahreszahl 1522 nur den Anfang des grossartigen
Umbaues angiebt, der aber noch zu Wilhelms Lebzeiten (f 1535) zum Abschluss
gekommen sein kann. [Stocker (a. a. O. S. 4 u. 13) hat die obige Inschrift gelesen:
»Maister.....von Mosbach (nicht Hans von Wertheim) und Wilhelm von Habern«
und behauptet, dass »ein nicht mehr vorhandener Stein« folgende Inschrift getragen
habe: »Sind diese werke alle vollbracht durch den vesten Juncker Wilhelm von Habern
Gott W S B S (Gott wolle sein Bauen segnen)«. Erstere Angabe ist unrichtig, letztere
nicht mehr zu kontrolliren, an sich aber verdächtig.] Das westliche Stück der Aussen-
mauer zwischen den beiden Eck-Rondells erreicht fast eine Stärke von 3 m, während
die übrigen Theile der Zingei ungefähr halb so stark aufgeführt sind. Ihre jetzige Höhe
über dem Zwinger-Niveau beträgt nicht viel über Manneshöhe. In der Mitte des davor-
liegenden, im Durchschnitt 15 m breiten, tief in den Felsen gearbeiteten Halsgrabens
ragt ein Quader-Pfeiler hervor, ähnlich, aber kleiner, wie beim Haupt - Eingangsthor
(s. oben S. 17), der der Röhrenleitung als mittleres Auflager diente, die vom Gebirge
her das Wasser über den Halsgraben hinweg der Burg zuführte. Die Rondelle öffnen
sich weit nach Innen, so dass man ihre ehemalige Stockwerk-Eintheilung und die Schiess-
luken in allen Etagen gut überblicken kann. Die Zwischenböden bestanden durchweg
aus Holz auf Konsolen.
KREIS MOSBACH.
Fig. 8. Vom Eckrondell der Minneburg.
Zingei gut erhalten, die, dem ansteigenden Terrain folgend, auf dem Rande des Hals-
grabens entlang läuft und nach etwa 22m im stumpfen Knick nach Südwesten vorspringt,
um dann in einem zweiten Flankirungsthurm zu endigen, der ungefähr dieselben
Abmessungen, wie der untere Eckthurm, aufweist. Wesentlich stärker sind die beiden
übrigen Rondelle i und k im weitem Verlauf der Aussenmauer (s. Tafel I) gegen den
westlichen Schenkel des Halsgrabens zu. Zumal der Eckthurm (g) an der Nordwestecke,
der auf unserm Längsschnitt (Fig. 9) zuäusserst rechts sichtbar wird, stellt ein gewaltiges,
sowohl durch seine Maße und Massen, als durch seine vorzügliche Bauweise bemerkens-
werthes Bollwerk dar (s. Fig. 7-). Die auf einem Spruchbande daran befindliche alte Inschrift
(s. Fig. 8) lautet: HANS VON WERTHEIM MEISTER WER, mit der Jahreszahl
1522, gross in der Mitte des Steines ausgehauen.
Unmittelbar also nach der Besitzergreifung hat
somit der kriegserfahrene Vaut von Heidelberg
Wilhelm von Habern durch den Wertheimer
Meister Hans — er hiess Hans Stainmüller und
ist derselbe, offenbar zu seiner Zeit weit berühmte
Baumeister, der u. a. für den Grafen Michael von
Wertheim die grossartigen Bauten auf Breuberg
errichtet hat — die neue Wehr-Anlage der Burg
und damit die jetzige Gestalt und den jetzigen
Umfang der Burg geschaffen. Angesichts der
Grossartigkeit und der vortrefflichen Ausführung der Anlage begreift man, dass Meister
Hans hier an hervorragender Stelle selbstbewusst seinen Namen angebracht sehen
wollte.
Dass ringsum die ganze äussere Zingei sammt den Rondellen und der Thor-Anlage
mit Brücke aus einem Guss, somit die gesammte Anlage von Meister Hans von Wertheim
hergestellt ist, unterliegt keinem Zweifel. Ueberall dieselbe sorgfältige Technik, dasselbe
saubere Quadenverk. Natürlich, dass die Jahreszahl 1522 nur den Anfang des grossartigen
Umbaues angiebt, der aber noch zu Wilhelms Lebzeiten (f 1535) zum Abschluss
gekommen sein kann. [Stocker (a. a. O. S. 4 u. 13) hat die obige Inschrift gelesen:
»Maister.....von Mosbach (nicht Hans von Wertheim) und Wilhelm von Habern«
und behauptet, dass »ein nicht mehr vorhandener Stein« folgende Inschrift getragen
habe: »Sind diese werke alle vollbracht durch den vesten Juncker Wilhelm von Habern
Gott W S B S (Gott wolle sein Bauen segnen)«. Erstere Angabe ist unrichtig, letztere
nicht mehr zu kontrolliren, an sich aber verdächtig.] Das westliche Stück der Aussen-
mauer zwischen den beiden Eck-Rondells erreicht fast eine Stärke von 3 m, während
die übrigen Theile der Zingei ungefähr halb so stark aufgeführt sind. Ihre jetzige Höhe
über dem Zwinger-Niveau beträgt nicht viel über Manneshöhe. In der Mitte des davor-
liegenden, im Durchschnitt 15 m breiten, tief in den Felsen gearbeiteten Halsgrabens
ragt ein Quader-Pfeiler hervor, ähnlich, aber kleiner, wie beim Haupt - Eingangsthor
(s. oben S. 17), der der Röhrenleitung als mittleres Auflager diente, die vom Gebirge
her das Wasser über den Halsgraben hinweg der Burg zuführte. Die Rondelle öffnen
sich weit nach Innen, so dass man ihre ehemalige Stockwerk-Eintheilung und die Schiess-
luken in allen Etagen gut überblicken kann. Die Zwischenböden bestanden durchweg
aus Holz auf Konsolen.