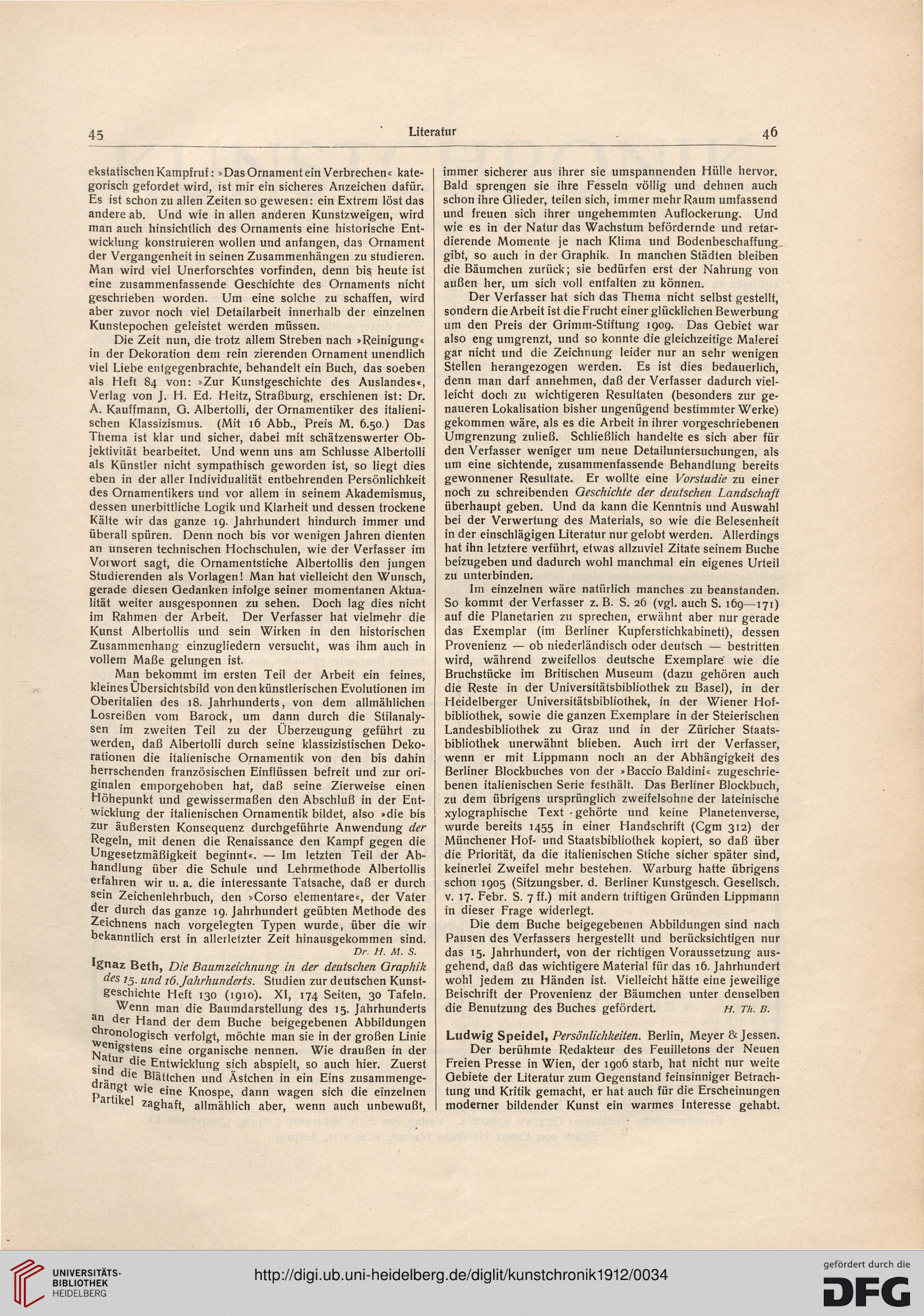45
Literatur
46
ekstatischen Kampfruf: »Das Ornament ein Verbrechen« kate-
gorisch gefordet wird, ist mir ein sicheres Anzeichen dafür.
Es ist schon zu allen Zeiten so gewesen: ein Extrem löst das
andere ab. Und wie in allen anderen Kunstzweigen, wird
man auch hinsichtlich des Ornaments eine historische Ent-
wicklung konstruieren wollen und anfangen, das Ornament
der Vergangenheit in seinen Zusammenhängen zu studieren.
Man wird viel Unerforschtes vorfinden, denn bis heute ist
eine zusammenfassende Geschichte des Ornaments nicht
geschrieben worden. Um eine solche zu schaffen, wird
aber zuvor noch viel Detailarbeit innerhalb der einzelnen
Kunstepochen geleistet werden müssen.
Die Zeit nun, die trotz allem Streben nach »Reinigung«
in der Dekoration dem rein zierenden Ornament unendlich
viel Liebe entgegenbrachte, behandelt ein Buch, das soeben
als Heft 84 von: »Zur Kunstgeschichte des Auslandes«,
Verlag von J. H. Ed. Heitz, Straßburg, erschienen ist: Dr.
A. Kauffmann, O. Albertolli, der Ornamentiker des italieni-
schen Klassizismus. (Mit 16 Abb., Preis M. 6.50.) Das
Thema ist klar und sicher, dabei mit schätzenswerter Ob-
jektivität bearbeitet. Und wenn uns am Schlüsse Albertolli
als Künstler nicht sympathisch geworden ist, so liegt dies
eben in der aller Individualität entbehrenden Persönlichkeit
des Ornamentikers und vor allem in seinem Akademismus,
dessen unerbittliche Logik und Klarheit und dessen trockene
Kälte wir das ganze 19. Jahrhundert hindurch immer und
überall spüren. Denn noch bis vor wenigen Jahren dienten
an unseren technischen Hochschulen, wie der Verfasser im
Vorwort sagt, die Ornamentstiche Albertollis den jungen
Studierenden als Vorlagen! Man hat vielleicht den Wunsch,
gerade diesen Oedanken infolge seiner momentanen Aktua-
lität weiter ausgesponnen zu sehen. Doch lag dies nicht
im Rahmen der Arbeit. Der Verfasser hat vielmehr die
Kunst Albertollis und sein Wirken in den historischen
Zusammenhang einzugliedern versucht, was ihm auch in
vollem Maße gelungen ist.
Man bekommt im ersten Teil der Arbeit ein feines,
kleines Übersichtsbild von den künstlerischen Evolutionen im
Oberitalien des 18. Jahrhunderts, von dem allmählichen
Losreißen vom Barock, um dann durch die Stilanaly-
sen im zweiten Teil zu der Überzeugung geführt zu
werden, daß Albertolli durch seine klassizistischen Deko-
rationen die italienische Ornamentik von den bis dahin
herrschenden französischen Einflüssen befreit und zur ori-
ginalen emporgehoben hat, daß seine Zierweise einen
Höhepunkt und gewissermaßen den Abschluß in der Ent-
wicklung der italienischen Ornamentik bildet, also »die bis
zur äußersten Konsequenz durchgeführte Anwendung der
Regeln, mit denen die Renaissance den Kampf gegen die
Ungesetzmäßigkeit beginnt«. — Im letzten Teil der Ab-
handlung über die Schule und Lehrmethode Albertollis
erfahren wir u. a. die interessante Tatsache, daß er durch
sein Zeichenlehrbuch, den »Corso elementare«, der Vater
der durch das ganze 19. Jahrhundert geübten Methode des
Zeichnens nach vorgelegten Typen wurde, über die wir
bekanntlich erst in allerletzter Zeit hinausgekommen sind.
Dr H. M. S.
'gnaz Beth, Die Baumzeichnung in der deutschen Graphik
des 15- und 16. Jahrhunderts. Studien zur deutschen Kunst-
geschichte Heft 130 (1910). XI, 174 Seiten, 30 Tafeln.
Wenn man die Baumdarstellung des 15. Jahrhunderts
an der Hand der dem Buche beigegebenen Abbildungen
ronologisch verfolgt, möchte man sie in der großen Linie
*er|igstens eine organische nennen. Wie draußen in der
Sjn.ur die Entwicklung sich abspielt, so auch hier. Zuerst
df- B'ättchen und Ästchen in ein Eins zusammenge-
fegt wie eine Knospe, dann wagen sich die einzelnen
Partikel
zaghaft, allmählich aber, wenn auch unbewußt,
immer sicherer aus ihrer sie umspannenden Hülle hervor.
Bald sprengen sie ihre Fesseln völlig und dehnen auch
schon ihre Glieder, teilen sich, immer mehr Raum umfassend
und freuen sich ihrer ungehemmten Auflockerung. Und
wie es in der Natur das Wachstum befördernde und retar-
dierende Momente je nach Klima und Bodenbeschaffung
gibt, so auch in der Graphik. In manchen Städten bleiben
die Bäumchen zurück; sie bedürfen erst der Nahrung von
außen her, um sich voll entfalten zu können.
Der Verfasser hat sich das Thema nicht selbst gestellt,
sondern die Arbeit ist die Frucht einer glücklichen Bewerbung
um den Preis der Grimm-Stiftung 1909. Das Gebiet war
also eng umgrenzt, und so konnte die gleichzeitige Malerei
gar nicht und die Zeichnung leider nur an sehr wenigen
Stellen herangezogen werden. Es ist dies bedauerlich,
denn man darf annehmen, daß der Verfasser dadurch viel-
leicht doch zu wichtigeren Resultaten (besonders zur ge-
naueren Lokalisation bisher ungenügend bestimmter Werke)
gekommen wäre, als es die Arbeit in ihrer vorgeschriebenen
Umgrenzung zuließ. Schließlich handelte es sich aber für
den Verfasser weniger um neue Detailuntersuchungen, als
um eine sichtende, zusammenfassende Behandlung bereits
gewonnener Resultate. Er wollte eine Vorstudie zu einer
noch zu schreibenden Geschichte der deutschen Landschaft
überhaupt geben. Und da kann die Kenntnis und Auswahl
bei der Verwertung des Materials, so wie die Belesenheit
in der einschlägigen Literatur nur gelobt werden. Allerdings
hat ihn letztere verführt, etwas allzuviel Zitate seinem Buche
beizugeben und dadurch wohl manchmal ein eigenes Urteil
zu unterbinden.
Im einzelnen wäre natürlich manches zu beanstanden.
So kommt der Verfasser z. B. S. 26 (vgl. auch S. 16g—171)
auf die Planetarien zu sprechen, erwähnt aber nur gerade
das Exemplar (im Berliner Kupferstichkabinett), dessen
Provenienz — ob niederländisch oder deutsch — bestritten
wird, während zweifellos deutsche Exemplare' wie die
Bruchstücke im Britischen Museum (dazu gehören auch
die Reste in der Universitätsbibliothek zu Basel), in der
Heidelberger Universitätsbibliothek, in der Wiener Hof-
bibliothek, sowie die ganzen Exemplare in der Steierischen
Landesbibliothek zu Graz und in der Züricher Staats-
bibliothek unerwähnt blieben. Auch irrt der Verfasser,
wenn er mit Lippmann noch an der Abhängigkeit des
Berliner Blockbuches von der »Baccio Baldini« zugeschrie-
benen italienischen Serie festhält. Das Berliner Blockbuch,
zu dem übrigens ursprünglich zweifelsohne der lateinische
xylographische Text -gehörte und keine Planetenverse,
wurde bereits 1455 in einer Handschrift (Cgm 312) der
Münchener Hof- und Staatsbibliothek kopiert, so daß über
die Priorität, da die italienischen Stiche sicher später sind,
keinerlei Zweifel mehr bestehen. Warburg hatte übrigens
schon 1905 (Sitzungsber. d. Berliner Kunstgesch. Gesellsch.
v. 17. Febr. S. 7 ff.) mit andern triftigen Gründen Lippmann
in dieser Frage widerlegt.
Die dem Buche beigegebenen Abbildungen sind nach
Pausen des Verfassers hergestellt und berücksichtigen nur
das 15. Jahrhundert, von der richtigen Voraussetzung aus-
gehend, daß das wichtigere Material für das 16. Jahrhundert
wohl jedem zu Händen ist. Vielleicht hätte eine jeweilige
Beischrift der Provenienz der Bäumchen unter denselben
die Benutzung des Buches gefördert. h. Th. B.
Ludwig Speidel, Persönlichkeiten. Berlin, Meyer & Jessen.
Der berühmte Redakteur des Feuilletons der Neuen
Freien Presse in Wien, der 1906 starb, hat nicht nur weite
Gebiete der Literatur zum Gegenstand feinsinniger Betrach-
tung und Kritik gemacht, er hat auch für die Erscheinungen
moderner bildender Kunst ein warmes Interesse gehabt.
Literatur
46
ekstatischen Kampfruf: »Das Ornament ein Verbrechen« kate-
gorisch gefordet wird, ist mir ein sicheres Anzeichen dafür.
Es ist schon zu allen Zeiten so gewesen: ein Extrem löst das
andere ab. Und wie in allen anderen Kunstzweigen, wird
man auch hinsichtlich des Ornaments eine historische Ent-
wicklung konstruieren wollen und anfangen, das Ornament
der Vergangenheit in seinen Zusammenhängen zu studieren.
Man wird viel Unerforschtes vorfinden, denn bis heute ist
eine zusammenfassende Geschichte des Ornaments nicht
geschrieben worden. Um eine solche zu schaffen, wird
aber zuvor noch viel Detailarbeit innerhalb der einzelnen
Kunstepochen geleistet werden müssen.
Die Zeit nun, die trotz allem Streben nach »Reinigung«
in der Dekoration dem rein zierenden Ornament unendlich
viel Liebe entgegenbrachte, behandelt ein Buch, das soeben
als Heft 84 von: »Zur Kunstgeschichte des Auslandes«,
Verlag von J. H. Ed. Heitz, Straßburg, erschienen ist: Dr.
A. Kauffmann, O. Albertolli, der Ornamentiker des italieni-
schen Klassizismus. (Mit 16 Abb., Preis M. 6.50.) Das
Thema ist klar und sicher, dabei mit schätzenswerter Ob-
jektivität bearbeitet. Und wenn uns am Schlüsse Albertolli
als Künstler nicht sympathisch geworden ist, so liegt dies
eben in der aller Individualität entbehrenden Persönlichkeit
des Ornamentikers und vor allem in seinem Akademismus,
dessen unerbittliche Logik und Klarheit und dessen trockene
Kälte wir das ganze 19. Jahrhundert hindurch immer und
überall spüren. Denn noch bis vor wenigen Jahren dienten
an unseren technischen Hochschulen, wie der Verfasser im
Vorwort sagt, die Ornamentstiche Albertollis den jungen
Studierenden als Vorlagen! Man hat vielleicht den Wunsch,
gerade diesen Oedanken infolge seiner momentanen Aktua-
lität weiter ausgesponnen zu sehen. Doch lag dies nicht
im Rahmen der Arbeit. Der Verfasser hat vielmehr die
Kunst Albertollis und sein Wirken in den historischen
Zusammenhang einzugliedern versucht, was ihm auch in
vollem Maße gelungen ist.
Man bekommt im ersten Teil der Arbeit ein feines,
kleines Übersichtsbild von den künstlerischen Evolutionen im
Oberitalien des 18. Jahrhunderts, von dem allmählichen
Losreißen vom Barock, um dann durch die Stilanaly-
sen im zweiten Teil zu der Überzeugung geführt zu
werden, daß Albertolli durch seine klassizistischen Deko-
rationen die italienische Ornamentik von den bis dahin
herrschenden französischen Einflüssen befreit und zur ori-
ginalen emporgehoben hat, daß seine Zierweise einen
Höhepunkt und gewissermaßen den Abschluß in der Ent-
wicklung der italienischen Ornamentik bildet, also »die bis
zur äußersten Konsequenz durchgeführte Anwendung der
Regeln, mit denen die Renaissance den Kampf gegen die
Ungesetzmäßigkeit beginnt«. — Im letzten Teil der Ab-
handlung über die Schule und Lehrmethode Albertollis
erfahren wir u. a. die interessante Tatsache, daß er durch
sein Zeichenlehrbuch, den »Corso elementare«, der Vater
der durch das ganze 19. Jahrhundert geübten Methode des
Zeichnens nach vorgelegten Typen wurde, über die wir
bekanntlich erst in allerletzter Zeit hinausgekommen sind.
Dr H. M. S.
'gnaz Beth, Die Baumzeichnung in der deutschen Graphik
des 15- und 16. Jahrhunderts. Studien zur deutschen Kunst-
geschichte Heft 130 (1910). XI, 174 Seiten, 30 Tafeln.
Wenn man die Baumdarstellung des 15. Jahrhunderts
an der Hand der dem Buche beigegebenen Abbildungen
ronologisch verfolgt, möchte man sie in der großen Linie
*er|igstens eine organische nennen. Wie draußen in der
Sjn.ur die Entwicklung sich abspielt, so auch hier. Zuerst
df- B'ättchen und Ästchen in ein Eins zusammenge-
fegt wie eine Knospe, dann wagen sich die einzelnen
Partikel
zaghaft, allmählich aber, wenn auch unbewußt,
immer sicherer aus ihrer sie umspannenden Hülle hervor.
Bald sprengen sie ihre Fesseln völlig und dehnen auch
schon ihre Glieder, teilen sich, immer mehr Raum umfassend
und freuen sich ihrer ungehemmten Auflockerung. Und
wie es in der Natur das Wachstum befördernde und retar-
dierende Momente je nach Klima und Bodenbeschaffung
gibt, so auch in der Graphik. In manchen Städten bleiben
die Bäumchen zurück; sie bedürfen erst der Nahrung von
außen her, um sich voll entfalten zu können.
Der Verfasser hat sich das Thema nicht selbst gestellt,
sondern die Arbeit ist die Frucht einer glücklichen Bewerbung
um den Preis der Grimm-Stiftung 1909. Das Gebiet war
also eng umgrenzt, und so konnte die gleichzeitige Malerei
gar nicht und die Zeichnung leider nur an sehr wenigen
Stellen herangezogen werden. Es ist dies bedauerlich,
denn man darf annehmen, daß der Verfasser dadurch viel-
leicht doch zu wichtigeren Resultaten (besonders zur ge-
naueren Lokalisation bisher ungenügend bestimmter Werke)
gekommen wäre, als es die Arbeit in ihrer vorgeschriebenen
Umgrenzung zuließ. Schließlich handelte es sich aber für
den Verfasser weniger um neue Detailuntersuchungen, als
um eine sichtende, zusammenfassende Behandlung bereits
gewonnener Resultate. Er wollte eine Vorstudie zu einer
noch zu schreibenden Geschichte der deutschen Landschaft
überhaupt geben. Und da kann die Kenntnis und Auswahl
bei der Verwertung des Materials, so wie die Belesenheit
in der einschlägigen Literatur nur gelobt werden. Allerdings
hat ihn letztere verführt, etwas allzuviel Zitate seinem Buche
beizugeben und dadurch wohl manchmal ein eigenes Urteil
zu unterbinden.
Im einzelnen wäre natürlich manches zu beanstanden.
So kommt der Verfasser z. B. S. 26 (vgl. auch S. 16g—171)
auf die Planetarien zu sprechen, erwähnt aber nur gerade
das Exemplar (im Berliner Kupferstichkabinett), dessen
Provenienz — ob niederländisch oder deutsch — bestritten
wird, während zweifellos deutsche Exemplare' wie die
Bruchstücke im Britischen Museum (dazu gehören auch
die Reste in der Universitätsbibliothek zu Basel), in der
Heidelberger Universitätsbibliothek, in der Wiener Hof-
bibliothek, sowie die ganzen Exemplare in der Steierischen
Landesbibliothek zu Graz und in der Züricher Staats-
bibliothek unerwähnt blieben. Auch irrt der Verfasser,
wenn er mit Lippmann noch an der Abhängigkeit des
Berliner Blockbuches von der »Baccio Baldini« zugeschrie-
benen italienischen Serie festhält. Das Berliner Blockbuch,
zu dem übrigens ursprünglich zweifelsohne der lateinische
xylographische Text -gehörte und keine Planetenverse,
wurde bereits 1455 in einer Handschrift (Cgm 312) der
Münchener Hof- und Staatsbibliothek kopiert, so daß über
die Priorität, da die italienischen Stiche sicher später sind,
keinerlei Zweifel mehr bestehen. Warburg hatte übrigens
schon 1905 (Sitzungsber. d. Berliner Kunstgesch. Gesellsch.
v. 17. Febr. S. 7 ff.) mit andern triftigen Gründen Lippmann
in dieser Frage widerlegt.
Die dem Buche beigegebenen Abbildungen sind nach
Pausen des Verfassers hergestellt und berücksichtigen nur
das 15. Jahrhundert, von der richtigen Voraussetzung aus-
gehend, daß das wichtigere Material für das 16. Jahrhundert
wohl jedem zu Händen ist. Vielleicht hätte eine jeweilige
Beischrift der Provenienz der Bäumchen unter denselben
die Benutzung des Buches gefördert. h. Th. B.
Ludwig Speidel, Persönlichkeiten. Berlin, Meyer & Jessen.
Der berühmte Redakteur des Feuilletons der Neuen
Freien Presse in Wien, der 1906 starb, hat nicht nur weite
Gebiete der Literatur zum Gegenstand feinsinniger Betrach-
tung und Kritik gemacht, er hat auch für die Erscheinungen
moderner bildender Kunst ein warmes Interesse gehabt.