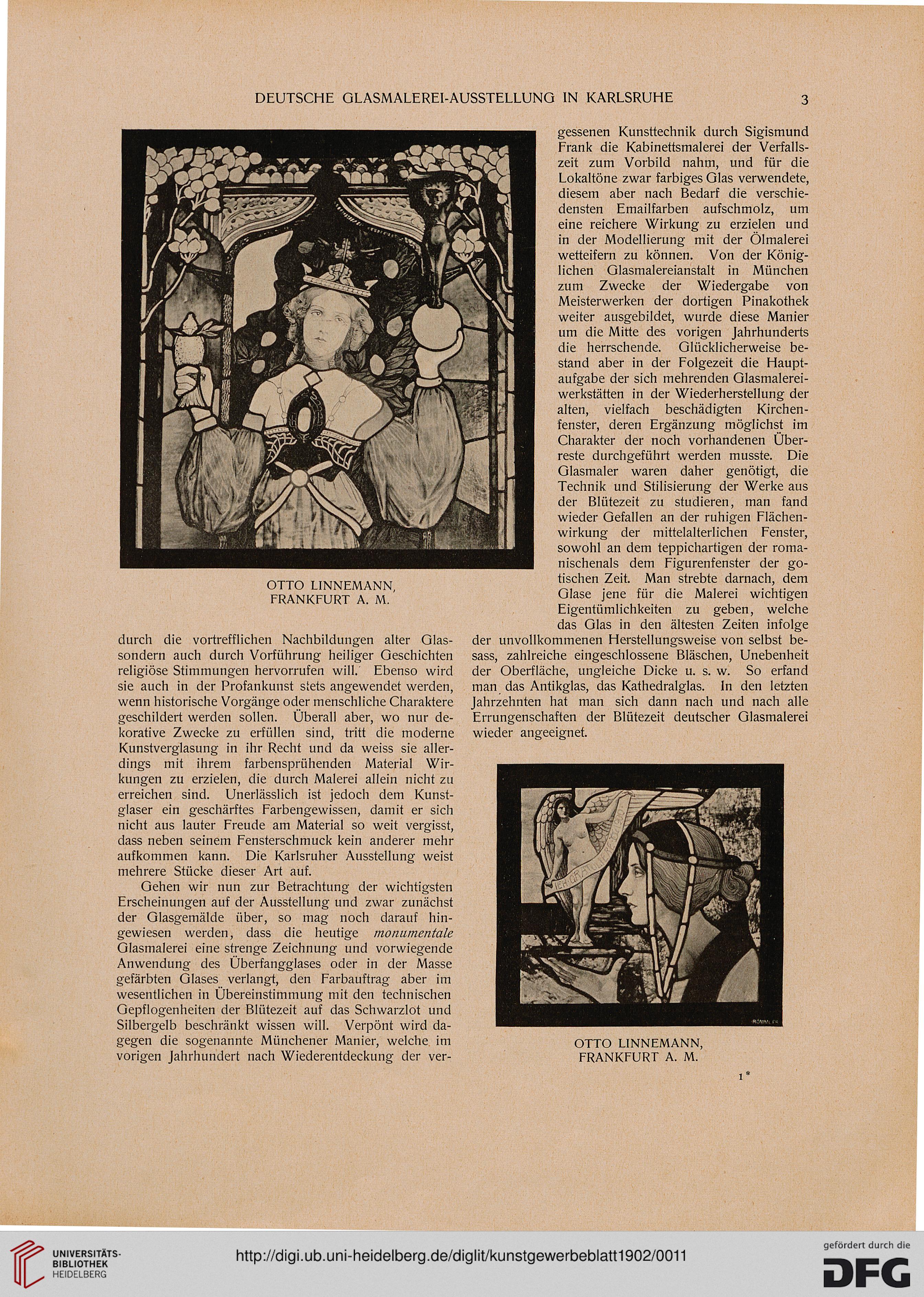DEUTSCHE GLASMALEREI-AUSSTELLUNG IN KARLSRUHE
OTTO LINNEMANN,
FRANKFURT A. M.
durch die vortrefflichen Nachbildungen alter Glas-
sondern auch durch Vorführung heiliger Geschichten
religiöse Stimmungen hervorrufen will. Ebenso wird
sie auch in der Profankunst stets angewendet werden,
wenn historische Vorgänge oder menschliche Charaktere
geschildert werden sollen. Überall aber, wo nur de-
korative Zwecke zu erfüllen sind, tritt die moderne
Kunstverglasung in ihr Recht und da weiss sie aller-
dings mit ihrem farbensprühenden Material Wir-
kungen zu erzielen, die durch Malerei allein nicht zu
erreichen sind. Unerlässlich ist jedoch dem Kunst-
glaser ein geschärftes Farbengewissen, damit er sich
nicht aus lauter Freude am Material so weit vergisst,
dass neben seinem Fensterschmuck kein anderer mehr
aufkommen kann. Die Karlsruher Ausstellung weist
mehrere Stücke dieser Art auf.
Gehen wir nun zur Betrachtung der wichtigsten
Erscheinungen auf der Ausstellung und zwar zunächst
der Glasgemälde über, so mag noch darauf hin-
gewiesen werden, dass die heutige monumentale
Glasmalerei eine strenge Zeichnung und vorwiegende
Anwendung des Überfangglases oder in der Masse
gefärbten Glases verlangt, den Farbauftrag aber im
wesentlichen in Übereinstimmung mit den technischen
Gepflogenheiten der Blütezeit auf das Schwarzlot und
Silbergelb beschränkt wissen will. Verpönt wird da-
gegen die sogenannte Münchener Manier, welche, im
vorigen Jahrhundert nach Wiederentdeckung der ver-
gessenen Kunsttechnik durch Sigismund
Frank die Kabinettsmalerei der Verfalls-
zeit zum Vorbild nahm, und für die
Lokaltöne zwar farbiges Glas verwendete,
diesem aber nach Bedarf die verschie-
densten Emailfarben aufschmolz, um
eine reichere Wirkung zu erzielen und
in der Modellierung mit der Ölmalerei
wetteifern zu können. Von der König-
lichen Glasmalereianstalt in München
zum Zwecke der Wiedergabe von
Meisterwerken der dortigen Pinakothek
weiter ausgebildet, wurde diese Manier
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
die herrschende. Glücklicherweise be-
stand aber in der Folgezeit die Haupt-
aufgabe der sich mehrenden Glasmalerei-
werkstätten in der Wiederherstellung der
alten, vielfach beschädigten Kirchen-
fenster, deren Ergänzung möglichst im
Charakter der noch vorhandenen Über-
reste durchgeführt werden musste. Die
Glasmaler waren daher genötigt, die
Technik und Stilisierung der Werke aus
der Blütezeit zu studieren, man fand
wieder Gefallen an der ruhigen Flächen-
wirkung der mittelalterlichen Fenster,
sowohl an dem teppichartigen der roma-
nischenals dem Figurenfenster der go-
tischen Zeit. Man strebte darnach, dem
Glase jene für die Malerei wichtigen
Eigentümlichkeiten zu geben, welche
das Glas in den ältesten Zeiten infolge
der unvollkommenen Herstellungsweise von selbst be-
sass, zahlreiche eingeschlossene Bläschen, Unebenheit
der Oberfläche, ungleiche Dicke u. s. w. So erfand
man das Antikglas, das Kathedralglas. In den letzten
Jahrzehnten hat man sich dann nach und nach alle
Errungenschaften der Blütezeit deutscher Glasmalerei
wieder angeeignet.
OTTO LINNEMANN,
FRANKFURT A. M.
OTTO LINNEMANN,
FRANKFURT A. M.
durch die vortrefflichen Nachbildungen alter Glas-
sondern auch durch Vorführung heiliger Geschichten
religiöse Stimmungen hervorrufen will. Ebenso wird
sie auch in der Profankunst stets angewendet werden,
wenn historische Vorgänge oder menschliche Charaktere
geschildert werden sollen. Überall aber, wo nur de-
korative Zwecke zu erfüllen sind, tritt die moderne
Kunstverglasung in ihr Recht und da weiss sie aller-
dings mit ihrem farbensprühenden Material Wir-
kungen zu erzielen, die durch Malerei allein nicht zu
erreichen sind. Unerlässlich ist jedoch dem Kunst-
glaser ein geschärftes Farbengewissen, damit er sich
nicht aus lauter Freude am Material so weit vergisst,
dass neben seinem Fensterschmuck kein anderer mehr
aufkommen kann. Die Karlsruher Ausstellung weist
mehrere Stücke dieser Art auf.
Gehen wir nun zur Betrachtung der wichtigsten
Erscheinungen auf der Ausstellung und zwar zunächst
der Glasgemälde über, so mag noch darauf hin-
gewiesen werden, dass die heutige monumentale
Glasmalerei eine strenge Zeichnung und vorwiegende
Anwendung des Überfangglases oder in der Masse
gefärbten Glases verlangt, den Farbauftrag aber im
wesentlichen in Übereinstimmung mit den technischen
Gepflogenheiten der Blütezeit auf das Schwarzlot und
Silbergelb beschränkt wissen will. Verpönt wird da-
gegen die sogenannte Münchener Manier, welche, im
vorigen Jahrhundert nach Wiederentdeckung der ver-
gessenen Kunsttechnik durch Sigismund
Frank die Kabinettsmalerei der Verfalls-
zeit zum Vorbild nahm, und für die
Lokaltöne zwar farbiges Glas verwendete,
diesem aber nach Bedarf die verschie-
densten Emailfarben aufschmolz, um
eine reichere Wirkung zu erzielen und
in der Modellierung mit der Ölmalerei
wetteifern zu können. Von der König-
lichen Glasmalereianstalt in München
zum Zwecke der Wiedergabe von
Meisterwerken der dortigen Pinakothek
weiter ausgebildet, wurde diese Manier
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
die herrschende. Glücklicherweise be-
stand aber in der Folgezeit die Haupt-
aufgabe der sich mehrenden Glasmalerei-
werkstätten in der Wiederherstellung der
alten, vielfach beschädigten Kirchen-
fenster, deren Ergänzung möglichst im
Charakter der noch vorhandenen Über-
reste durchgeführt werden musste. Die
Glasmaler waren daher genötigt, die
Technik und Stilisierung der Werke aus
der Blütezeit zu studieren, man fand
wieder Gefallen an der ruhigen Flächen-
wirkung der mittelalterlichen Fenster,
sowohl an dem teppichartigen der roma-
nischenals dem Figurenfenster der go-
tischen Zeit. Man strebte darnach, dem
Glase jene für die Malerei wichtigen
Eigentümlichkeiten zu geben, welche
das Glas in den ältesten Zeiten infolge
der unvollkommenen Herstellungsweise von selbst be-
sass, zahlreiche eingeschlossene Bläschen, Unebenheit
der Oberfläche, ungleiche Dicke u. s. w. So erfand
man das Antikglas, das Kathedralglas. In den letzten
Jahrzehnten hat man sich dann nach und nach alle
Errungenschaften der Blütezeit deutscher Glasmalerei
wieder angeeignet.
OTTO LINNEMANN,
FRANKFURT A. M.