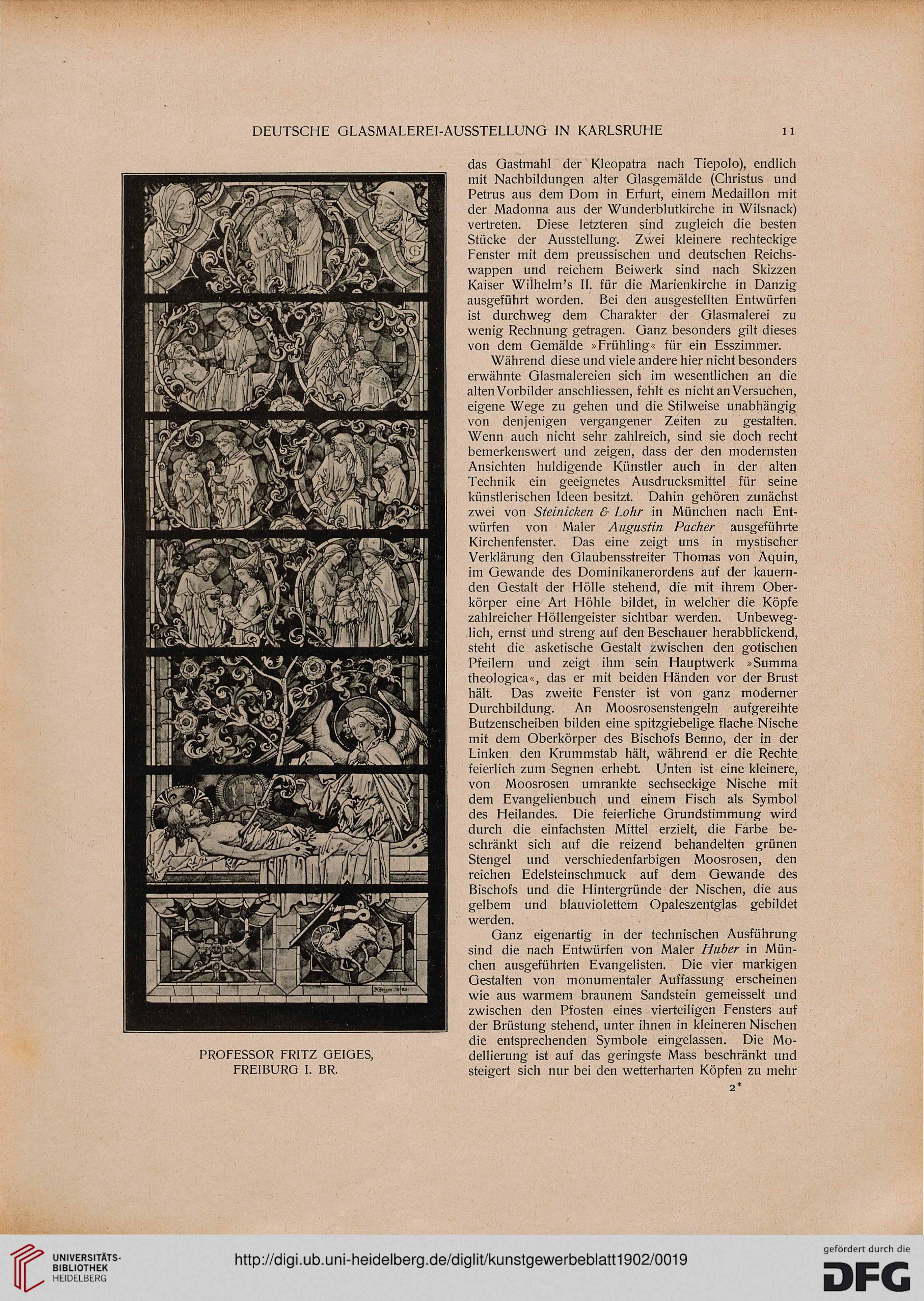DEUTSCHE GLASMALEREI-AUSSTELLUNG IN KARLSRUHE
11
PROFESSOR FRITZ GEIGES,
FREIBURO I. BR.
das Gastmahl der Kleopatra nach Tiepolo), endlich
mit Nachbildungen alter Glasgemälde (Christus und
Petrus aus dem Dom in Erfurt, einem Medaillon mit
der Madonna aus der Wunderblutkirche in Wilsnack)
vertreten. Diese letzteren sind zugleich die besten
Stücke der Ausstellung. Zwei kleinere rechteckige
Fenster mit dem preussischen und deutschen Reichs-
wappen und reichem Beiwerk sind nach Skizzen
Kaiser Wilhelm's II. für die Marienkirche in Danzig
ausgeführt worden. Bei den ausgestellten Entwürfen
ist durchweg dem Charakter der Glasmalerei zu
wenig Rechnung getragen. Ganz besonders gilt dieses
von dem Gemälde »Frühling« für ein Esszimmer.
Während diese und viele andere hier nicht besonders
erwähnte Glasmalereien sich im wesentlichen an die
alten Vorbilder anschliessen, fehlt es nicht an Versuchen,
eigene Wege zu gehen und die Stilweise unabhängig
von denjenigen vergangener Zeiten zu gestalten.
Wenn auch nicht sehr zahlreich, sind sie doch recht
bemerkenswert und zeigen, dass der den modernsten
Ansichten huldigende Künstler auch in der alten
Technik ein geeignetes Ausdrucksmittel für seine
künstlerischen Ideen besitzt. Dahin gehören zunächst
zwei von Stelnicken & Lohr in München nach Ent-
würfen von Maler Augustin Packer ausgeführte
Kirchenfenster. Das eine zeigt uns in mystischer
Verklärung den Glaubensstreiter Thomas von Aquin,
im Gewände des Dominikanerordens auf der kauern-
den Gestalt der Hölle stehend, die mit ihrem Ober-
körper eine Art Höhle bildet, in welcher die Köpfe
zahlreicher Höllengeister sichtbar werden. Unbeweg-
lich, ernst und streng auf den Beschauer herabblickend,
steht die asketische Gestalt zwischen den gotischen
Pfeilern und zeigt ihm sein Hauptwerk »Summa
theologica«, das er mit beiden Händen vor der Brust
hält. Das zweite Fenster ist von ganz moderner
Durchbildung. An Moosrosenstengeln aufgereihte
Butzenscheiben bilden eine spitzgiebelige flache Nische
mit dem Oberkörper des Bischofs Benno, der in der
Linken den Krummstab hält, während er die Rechte
feierlich zum Segnen erhebt. Unten ist eine kleinere,
von Moosrosen umrankte sechseckige Nische mit
dem Evangelienbuch und einem Fisch als Symbol
des Heilandes. Die feierliche Grundstimmung wird
durch die einfachsten Mittel erzielt, die Farbe be-
schränkt sich auf die reizend behandelten grünen
Stengel und verschiedenfarbigen Moosrosen, den
reichen Edelsteinschmuck auf dem Gewände des
Bischofs und die Hintergründe der Nischen, die aus
gelbem und blauviolettem Opaleszentglas gebildet
werden.
Ganz eigenartig in der technischen Ausführung
sind die nach Entwürfen von Maler Huber in Mün-
chen ausgeführten Evangelisten. Die vier markigen
Gestalten von monumentaler Auffassung erscheinen
wie aus warmem braunem Sandstein gemeisselt und
zwischen den Pfosten eines vierteiligen Fensters auf
der Brüstung stehend, unter ihnen in kleineren Nischen
die entsprechenden Symbole eingelassen. Die Mo-
dellierung ist auf das geringste Mass beschränkt und
steigert sich nur bei den wetterharten Köpfen zu mehr
2*
11
PROFESSOR FRITZ GEIGES,
FREIBURO I. BR.
das Gastmahl der Kleopatra nach Tiepolo), endlich
mit Nachbildungen alter Glasgemälde (Christus und
Petrus aus dem Dom in Erfurt, einem Medaillon mit
der Madonna aus der Wunderblutkirche in Wilsnack)
vertreten. Diese letzteren sind zugleich die besten
Stücke der Ausstellung. Zwei kleinere rechteckige
Fenster mit dem preussischen und deutschen Reichs-
wappen und reichem Beiwerk sind nach Skizzen
Kaiser Wilhelm's II. für die Marienkirche in Danzig
ausgeführt worden. Bei den ausgestellten Entwürfen
ist durchweg dem Charakter der Glasmalerei zu
wenig Rechnung getragen. Ganz besonders gilt dieses
von dem Gemälde »Frühling« für ein Esszimmer.
Während diese und viele andere hier nicht besonders
erwähnte Glasmalereien sich im wesentlichen an die
alten Vorbilder anschliessen, fehlt es nicht an Versuchen,
eigene Wege zu gehen und die Stilweise unabhängig
von denjenigen vergangener Zeiten zu gestalten.
Wenn auch nicht sehr zahlreich, sind sie doch recht
bemerkenswert und zeigen, dass der den modernsten
Ansichten huldigende Künstler auch in der alten
Technik ein geeignetes Ausdrucksmittel für seine
künstlerischen Ideen besitzt. Dahin gehören zunächst
zwei von Stelnicken & Lohr in München nach Ent-
würfen von Maler Augustin Packer ausgeführte
Kirchenfenster. Das eine zeigt uns in mystischer
Verklärung den Glaubensstreiter Thomas von Aquin,
im Gewände des Dominikanerordens auf der kauern-
den Gestalt der Hölle stehend, die mit ihrem Ober-
körper eine Art Höhle bildet, in welcher die Köpfe
zahlreicher Höllengeister sichtbar werden. Unbeweg-
lich, ernst und streng auf den Beschauer herabblickend,
steht die asketische Gestalt zwischen den gotischen
Pfeilern und zeigt ihm sein Hauptwerk »Summa
theologica«, das er mit beiden Händen vor der Brust
hält. Das zweite Fenster ist von ganz moderner
Durchbildung. An Moosrosenstengeln aufgereihte
Butzenscheiben bilden eine spitzgiebelige flache Nische
mit dem Oberkörper des Bischofs Benno, der in der
Linken den Krummstab hält, während er die Rechte
feierlich zum Segnen erhebt. Unten ist eine kleinere,
von Moosrosen umrankte sechseckige Nische mit
dem Evangelienbuch und einem Fisch als Symbol
des Heilandes. Die feierliche Grundstimmung wird
durch die einfachsten Mittel erzielt, die Farbe be-
schränkt sich auf die reizend behandelten grünen
Stengel und verschiedenfarbigen Moosrosen, den
reichen Edelsteinschmuck auf dem Gewände des
Bischofs und die Hintergründe der Nischen, die aus
gelbem und blauviolettem Opaleszentglas gebildet
werden.
Ganz eigenartig in der technischen Ausführung
sind die nach Entwürfen von Maler Huber in Mün-
chen ausgeführten Evangelisten. Die vier markigen
Gestalten von monumentaler Auffassung erscheinen
wie aus warmem braunem Sandstein gemeisselt und
zwischen den Pfosten eines vierteiligen Fensters auf
der Brüstung stehend, unter ihnen in kleineren Nischen
die entsprechenden Symbole eingelassen. Die Mo-
dellierung ist auf das geringste Mass beschränkt und
steigert sich nur bei den wetterharten Köpfen zu mehr
2*