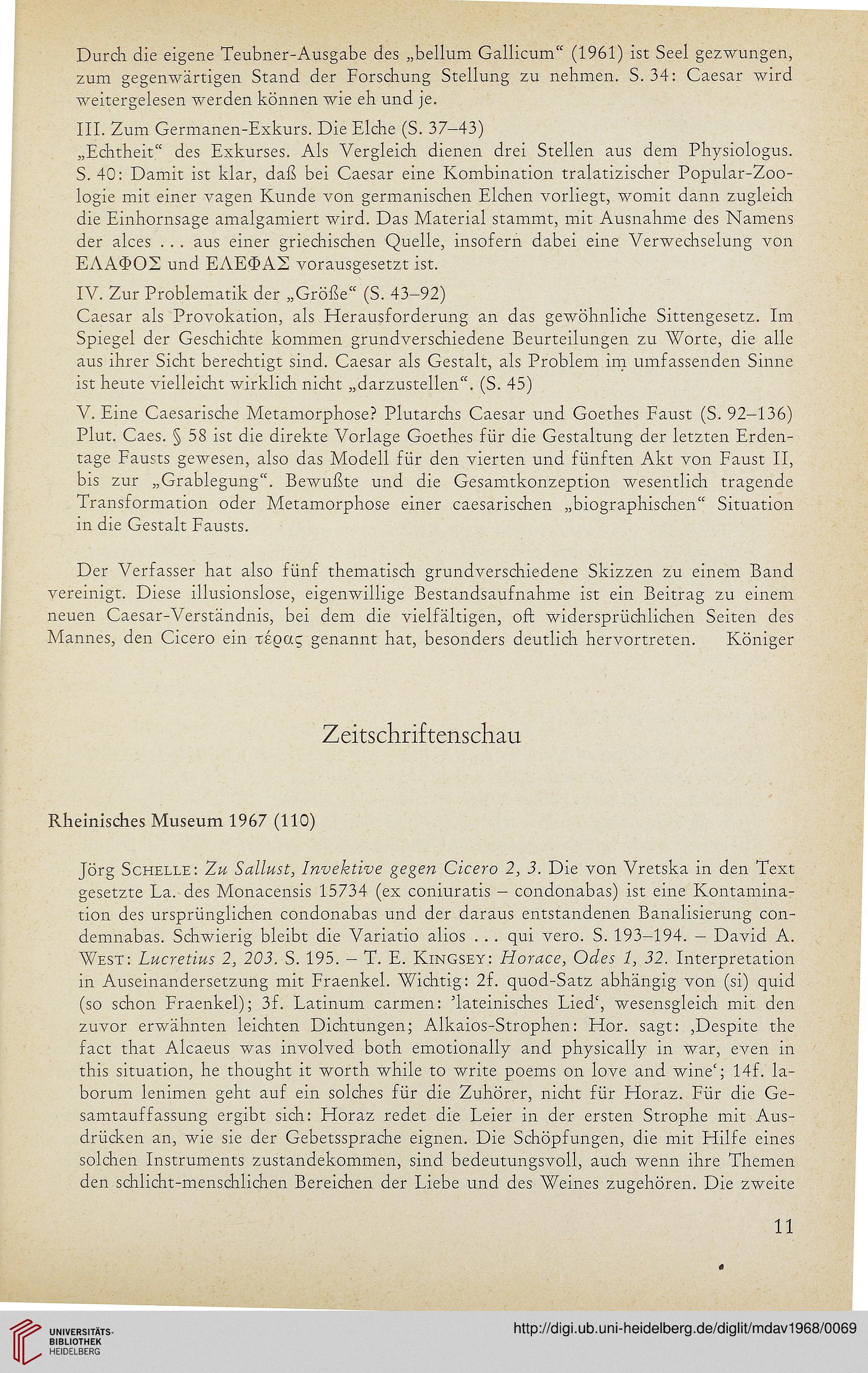Durch die eigene Teubner-Ausgabe des „bellum Gallicum“ (1961) ist Seel gezwungen,
zum gegenwärtigen Stand der Forschung Stellung zu nehmen. S. 34: Caesar wird
weitergelesen werden können wie eh und je.
III. Zum Germanen-Exkurs. Die Elche (S. 37-43)
„Echtheit“ des Exkurses. Als Vergleich dienen drei Stellen aus dem Physiologus.
S. 40: Damit ist klar, daß bei Caesar eine Kombination tralatizischer Popular-Zoo-
logie mit einer vagen Kunde von germanischen Elchen vorliegt, womit dann zugleich
die Einhornsage amalgamiert wird. Das Material stammt, mit Ausnahme des Namens
der alces . . . aus einer griechischen Quelle, insofern dabei eine Verwechselung von
EAA$02 und EAE$A2 vorausgesetzt ist.
IV. Zur Problematik der „Größe“ (S. 43-92)
Caesar als Provokation, als Herausforderung an das gewöhnliche Sittengesetz. Im
Spiegel der Geschichte kommen grundverschiedene Beurteilungen zu Worte, die alle
aus ihrer Sicht berechtigt sind. Caesar als Gestalt, als Problem im umfassenden Sinne
ist heute vielleicht wirklich nicht „darzustellen“. (S. 45)
V. Eine Caesarische Metamorphose? Plutarchs Caesar und Goethes Faust (S. 92-136)
Plut. Caes. § 58 ist die direkte Vorlage Goethes fiir die Gestaltung der letzten Erden-
tage Fausts gewesen, also das Modell für den vierten und fiinften Akt von Faust II,
bis zur „Grablegung“. Bewußte und die Gesamtkonzeption wesentlich tragende
Transformation oder Metamorphose einer caesarischen „biographischen“ Situation
in die Gestalt Fausts.
Der Verfasser hat also fünf thematisch grundverschiedene Skizzen zu einem Band
vereinigt. Diese illusionslose, eigenwillige Bestandsaufnahme ist ein Beitrag zu einem
neuen Caesar-Verständnis, bei dem die vielfältigen, oft widerspriichlichen Seiten des
Mannes, den Cicero ein Tsgag genannt hat, besonders deutlich hervortreten. Königer
Z eitschrif tenschau
Rheinisches Museum 1967 (110)
Jörg Schelle: Zu Sallust, Invektive gegen Cicero 2, 3. Die von Vretska in den Text
gesetzte La. des Monacensis 15734 (ex coniuratis — condonabas) ist eine Kontamina-
tion des ursprünglichen condonabas und der daraus entstandenen Banalisierung con-
demnabas. Schwierig bleibt die Variatio alios . . . qui vero. S. 193-194. - David A.
West: Lucretius 2, 203. S. 195. — T. E. Kingsey: Horace, Odes 1, 32. Interpretation
in Auseinandersetzung mit Fraenkel. Wichtig: 2f. quod-Satz abhängig von (si) quid
(so schon Fraenkel); 3f. Latinum carmen: ’lateinisches Lied', wesensgleich mit den
zuvor erwähnten leichten Dichtungen; Alkaios-Strophen: Hor. sagt: ,Despite the
fact that Alcaeus was involved both emotionally and physically in war, even in
this situation, he thought it worth while to write poems on love and wine'; 14f. la-
borum lenimen geht auf ein solches für die Zuhörer, nicht für Horaz. Für die Ge-
samtauffassung ergibt sich: Horaz redet die Leier in der ersten Strophe mit Aus-
drücken an, wie sie der Gebetssprache eignen. Die Schöpfungen, die mit Hilfe eines
solchen Instruments zustandekommen, sind bedeutungsvoll, auch wenn ihre Themen
den schlicht-menschlichen Bereichen der Liebe und des Weines zugehören. Die zweite
11
zum gegenwärtigen Stand der Forschung Stellung zu nehmen. S. 34: Caesar wird
weitergelesen werden können wie eh und je.
III. Zum Germanen-Exkurs. Die Elche (S. 37-43)
„Echtheit“ des Exkurses. Als Vergleich dienen drei Stellen aus dem Physiologus.
S. 40: Damit ist klar, daß bei Caesar eine Kombination tralatizischer Popular-Zoo-
logie mit einer vagen Kunde von germanischen Elchen vorliegt, womit dann zugleich
die Einhornsage amalgamiert wird. Das Material stammt, mit Ausnahme des Namens
der alces . . . aus einer griechischen Quelle, insofern dabei eine Verwechselung von
EAA$02 und EAE$A2 vorausgesetzt ist.
IV. Zur Problematik der „Größe“ (S. 43-92)
Caesar als Provokation, als Herausforderung an das gewöhnliche Sittengesetz. Im
Spiegel der Geschichte kommen grundverschiedene Beurteilungen zu Worte, die alle
aus ihrer Sicht berechtigt sind. Caesar als Gestalt, als Problem im umfassenden Sinne
ist heute vielleicht wirklich nicht „darzustellen“. (S. 45)
V. Eine Caesarische Metamorphose? Plutarchs Caesar und Goethes Faust (S. 92-136)
Plut. Caes. § 58 ist die direkte Vorlage Goethes fiir die Gestaltung der letzten Erden-
tage Fausts gewesen, also das Modell für den vierten und fiinften Akt von Faust II,
bis zur „Grablegung“. Bewußte und die Gesamtkonzeption wesentlich tragende
Transformation oder Metamorphose einer caesarischen „biographischen“ Situation
in die Gestalt Fausts.
Der Verfasser hat also fünf thematisch grundverschiedene Skizzen zu einem Band
vereinigt. Diese illusionslose, eigenwillige Bestandsaufnahme ist ein Beitrag zu einem
neuen Caesar-Verständnis, bei dem die vielfältigen, oft widerspriichlichen Seiten des
Mannes, den Cicero ein Tsgag genannt hat, besonders deutlich hervortreten. Königer
Z eitschrif tenschau
Rheinisches Museum 1967 (110)
Jörg Schelle: Zu Sallust, Invektive gegen Cicero 2, 3. Die von Vretska in den Text
gesetzte La. des Monacensis 15734 (ex coniuratis — condonabas) ist eine Kontamina-
tion des ursprünglichen condonabas und der daraus entstandenen Banalisierung con-
demnabas. Schwierig bleibt die Variatio alios . . . qui vero. S. 193-194. - David A.
West: Lucretius 2, 203. S. 195. — T. E. Kingsey: Horace, Odes 1, 32. Interpretation
in Auseinandersetzung mit Fraenkel. Wichtig: 2f. quod-Satz abhängig von (si) quid
(so schon Fraenkel); 3f. Latinum carmen: ’lateinisches Lied', wesensgleich mit den
zuvor erwähnten leichten Dichtungen; Alkaios-Strophen: Hor. sagt: ,Despite the
fact that Alcaeus was involved both emotionally and physically in war, even in
this situation, he thought it worth while to write poems on love and wine'; 14f. la-
borum lenimen geht auf ein solches für die Zuhörer, nicht für Horaz. Für die Ge-
samtauffassung ergibt sich: Horaz redet die Leier in der ersten Strophe mit Aus-
drücken an, wie sie der Gebetssprache eignen. Die Schöpfungen, die mit Hilfe eines
solchen Instruments zustandekommen, sind bedeutungsvoll, auch wenn ihre Themen
den schlicht-menschlichen Bereichen der Liebe und des Weines zugehören. Die zweite
11