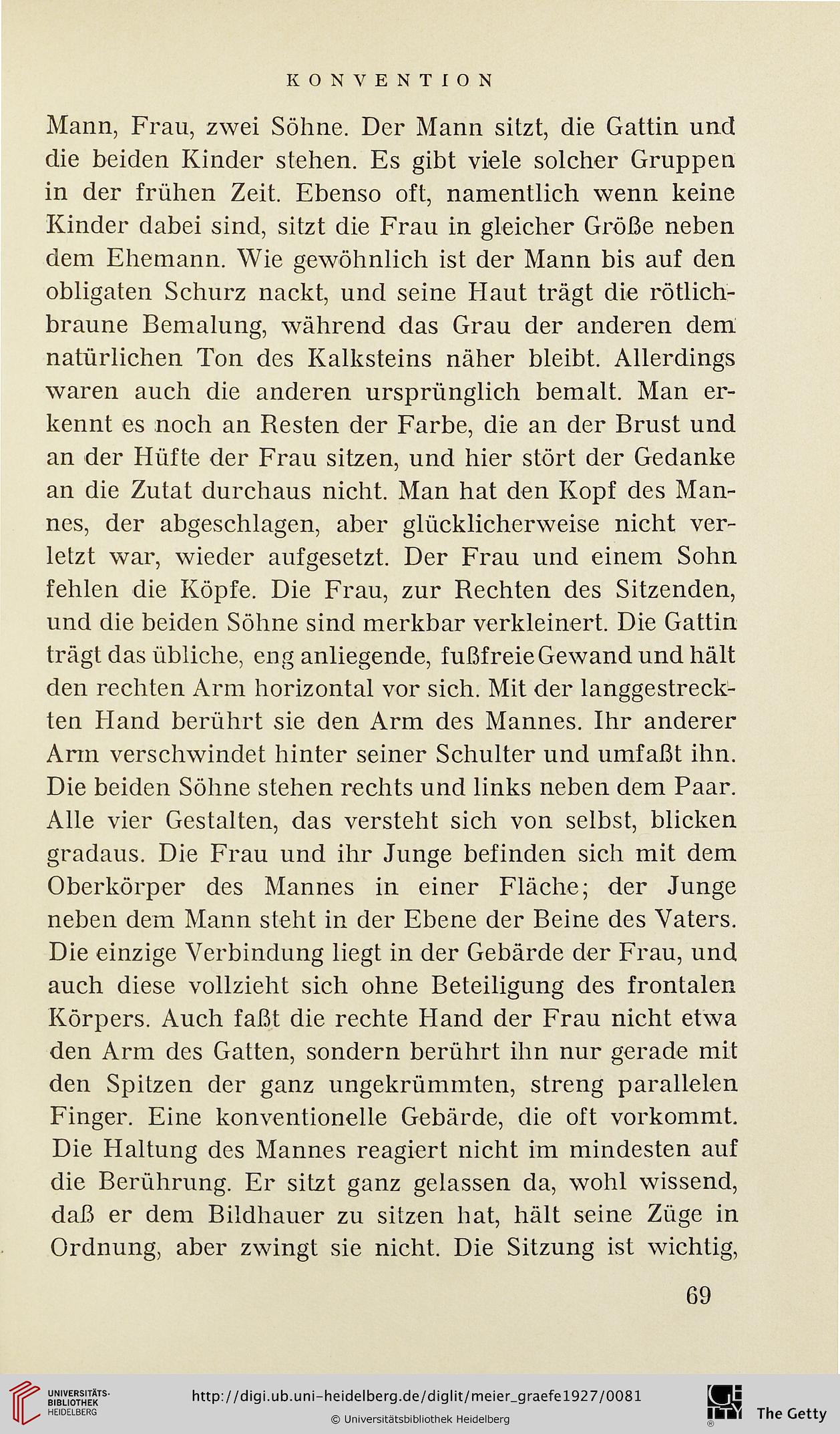KONVENTION
Mann, Frau, zwei Söhne. Der Mann sitzt, die Gattin und
die beiden Kinder stehen. Es gibt viele solcher Gruppen
in der frühen Zeit. Ebenso oft, namentlich wenn keine
Kinder dabei sind, sitzt die Frau in gleicher Größe neben
dem Ehemann. Wie gewöhnlich ist der Mann bis auf den
obligaten Schurz nackt, und seine Haut trägt die rötlich-
braune Bemalung, während das Grau der anderen dem
natürlichen Ton des Kalksteins näher bleibt. Allerdings
waren auch die anderen ursprünglich bemalt. Man er-
kennt es noch an Resten der Farbe, die an der Brust und
an der Hüfte der Frau sitzen, und hier stört der Gedanke
an die Zutat durchaus nicht. Man hat den Kopf des Man-
nes, der abgeschlagen, aber glücklicherweise nicht ver-
letzt war, wieder aufgesetzt. Der Frau und einem Sohn
fehlen die Köpfe. Die Frau, zur Rechten des Sitzenden,
und die beiden Söhne sind merkbar verkleinert. Die Gattin
trägt das übliche, enganliegende, fußfreie Gewand und hält
den rechten Arm horizontal vor sich. Mit der langgestreck-
ten Hand berührt sie den Arm des Mannes. Ihr anderer
Ann verschwindet hinter seiner Schulter und umfaßt ihn.
Die beiden Söhne stehen rechts und links neben dem Paar.
Alle vier Gestalten, das versteht sich von selbst, blicken
gradaus. Die Frau und ihr Junge befinden sich mit dem
Oberkörper des Mannes in einer Fläche; der Junge
neben dem Mann steht in der Ebene der Beine des Vaters.
Die einzige Verbindung liegt in der Gebärde der Frau, und
auch diese vollzieht sich ohne Beteiligung des frontalen
Körpers. Auch faßt die rechte Hand der Frau nicht etwa
den Arm des Gatten, sondern berührt ihn nur gerade mit
den Spitzen der ganz ungekrümmten, streng parallelen
Finger. Eine konventionelle Gebärde, die oft vorkommt.
Die Haltung des Mannes reagiert nicht im mindesten auf
die Berührung. Er sitzt ganz gelassen da, wohl wissend,
daß er dem Bildhauer zu sitzen hat, hält seine Züge in
Ordnung, aber zwingt sie nicht. Die Sitzung ist wichtig,
69
Mann, Frau, zwei Söhne. Der Mann sitzt, die Gattin und
die beiden Kinder stehen. Es gibt viele solcher Gruppen
in der frühen Zeit. Ebenso oft, namentlich wenn keine
Kinder dabei sind, sitzt die Frau in gleicher Größe neben
dem Ehemann. Wie gewöhnlich ist der Mann bis auf den
obligaten Schurz nackt, und seine Haut trägt die rötlich-
braune Bemalung, während das Grau der anderen dem
natürlichen Ton des Kalksteins näher bleibt. Allerdings
waren auch die anderen ursprünglich bemalt. Man er-
kennt es noch an Resten der Farbe, die an der Brust und
an der Hüfte der Frau sitzen, und hier stört der Gedanke
an die Zutat durchaus nicht. Man hat den Kopf des Man-
nes, der abgeschlagen, aber glücklicherweise nicht ver-
letzt war, wieder aufgesetzt. Der Frau und einem Sohn
fehlen die Köpfe. Die Frau, zur Rechten des Sitzenden,
und die beiden Söhne sind merkbar verkleinert. Die Gattin
trägt das übliche, enganliegende, fußfreie Gewand und hält
den rechten Arm horizontal vor sich. Mit der langgestreck-
ten Hand berührt sie den Arm des Mannes. Ihr anderer
Ann verschwindet hinter seiner Schulter und umfaßt ihn.
Die beiden Söhne stehen rechts und links neben dem Paar.
Alle vier Gestalten, das versteht sich von selbst, blicken
gradaus. Die Frau und ihr Junge befinden sich mit dem
Oberkörper des Mannes in einer Fläche; der Junge
neben dem Mann steht in der Ebene der Beine des Vaters.
Die einzige Verbindung liegt in der Gebärde der Frau, und
auch diese vollzieht sich ohne Beteiligung des frontalen
Körpers. Auch faßt die rechte Hand der Frau nicht etwa
den Arm des Gatten, sondern berührt ihn nur gerade mit
den Spitzen der ganz ungekrümmten, streng parallelen
Finger. Eine konventionelle Gebärde, die oft vorkommt.
Die Haltung des Mannes reagiert nicht im mindesten auf
die Berührung. Er sitzt ganz gelassen da, wohl wissend,
daß er dem Bildhauer zu sitzen hat, hält seine Züge in
Ordnung, aber zwingt sie nicht. Die Sitzung ist wichtig,
69