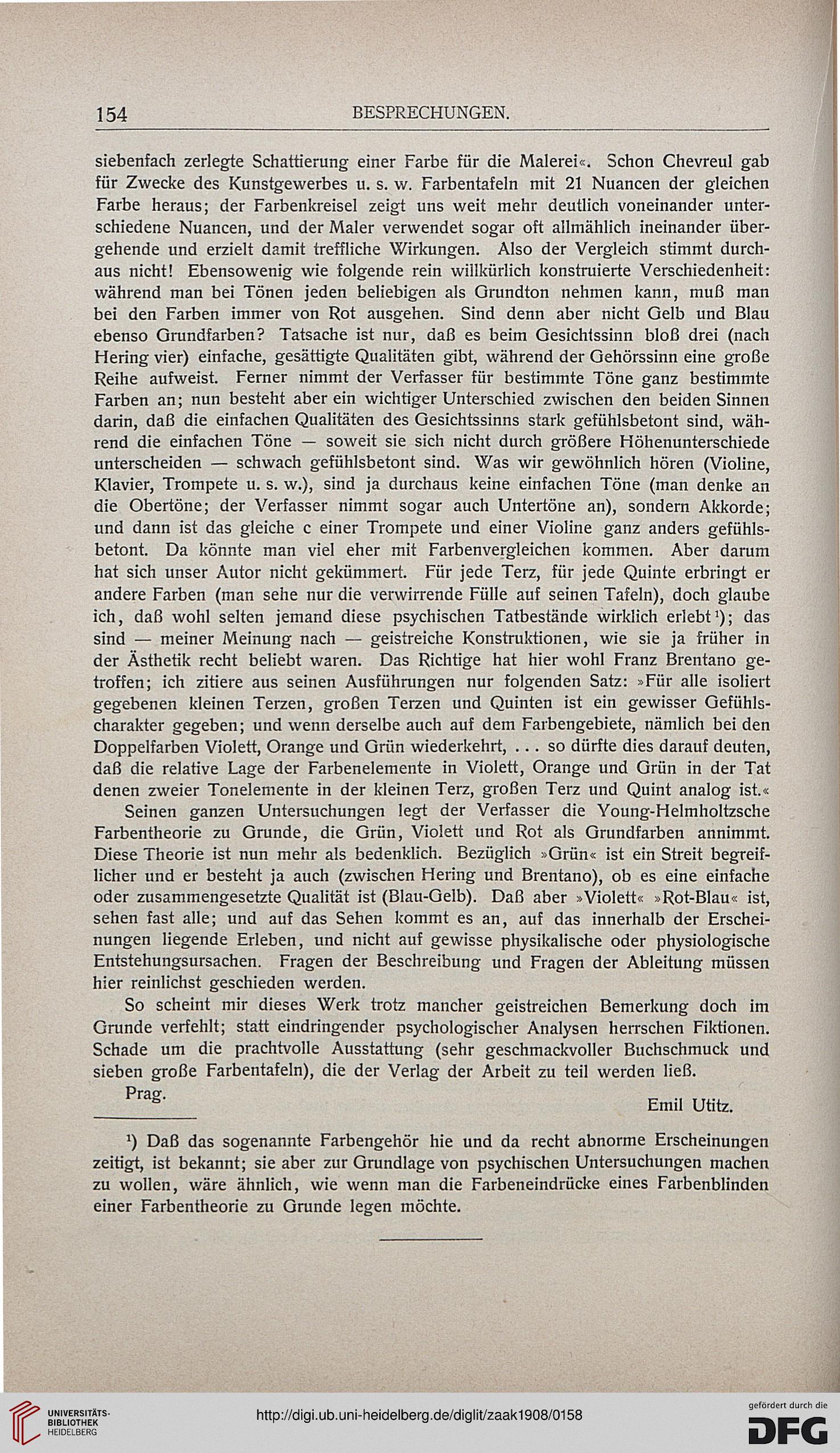154 BESPRECHUNGEN.
siebenfach zerlegte Schattierung einer Farbe für die Malerei«. Schon Chevreul gab
für Zwecke des Kunstgewerbes u. s. w. Farbentafeln mit 21 Nuancen der gleichen
Farbe heraus; der Farbenkreisel zeigt uns weit mehr deutlich voneinander unter-
schiedene Nuancen, und der Maler verwendet sogar oft allmählich ineinander über-
gehende und erzielt damit treffliche Wirkungen. Also der Vergleich stimmt durch-
aus nicht! Ebensowenig wie folgende rein willkürlich konstruierte Verschiedenheit:
während man bei Tönen jeden beliebigen als Qrundton nehmen kann, muß man
bei den Farben immer von Rot ausgehen. Sind denn aber nicht Gelb und Blau
ebenso Grundfarben? Tatsache ist nur, daß es beim Gesichtssinn bloß drei (nach
Hering vier) einfache, gesättigte Qualitäten gibt, während der Gehörssinn eine große
Reihe aufweist. Ferner nimmt der Verfasser für bestimmte Töne ganz bestimmte
Farben an; nun besteht aber ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Sinnen
darin, daß die einfachen Qualitäten des Gesichtssinns stark gefühlsbetont sind, wäh-
rend die einfachen Töne — soweit sie sich nicht durch größere Höhenunterschiede
unterscheiden — schwach gefühlsbetont sind. Was wir gewöhnlich hören (Violine,
Klavier, Trompete u. s. w.), sind ja durchaus keine einfachen Töne (man denke an
die Obertöne; der Verfasser nimmt sogar auch Untertöne an), sondern Akkorde;
und dann ist das gleiche c einer Trompete und einer Violine ganz anders gefühls-
betont. Da könnte man viel eher mit Farbenvergleichen kommen. Aber darum
hat sich unser Autor nicht gekümmert. Für jede Terz, für jede Quinte erbringt er
andere Farben (man sehe nur die verwirrende Fülle auf seinen Tafeln), doch glaube
ich, daß wohl selten jemand diese psychischen Tatbestände wirklich erlebt1); das
sind — meiner Meinung nach — geistreiche Konstruktionen, wie sie ja früher in
der Ästhetik recht beliebt waren. Das Richtige hat hier wohl Franz Brentano ge-
troffen; ich zitiere aus seinen Ausführungen nur folgenden Satz: »Für alle isoliert
gegebenen kleinen Terzen, großen Terzen und Quinten ist ein gewisser Gefühls-
charakter gegeben; und wenn derselbe auch auf dem Farbengebiete, nämlich bei den
Doppelfarben Violett, Orange und Grün wiederkehrt, ... so dürfte dies darauf deuten,
daß die relative Lage der Farbenelemente in Violett, Orange und Grün in der Tat
denen zweier Tonelemente in der kleinen Terz, großen Terz und Quint analog ist.«
Seinen ganzen Untersuchungen legt der Verfasser die Young-Helmholtzsche
Farbentheorie zu Grunde, die Grün, Violett und Rot als Grundfarben annimmt.
Diese Theorie ist nun mehr als bedenklich. Bezüglich »Grün« ist ein Streit begreif-
licher und er besteht ja auch (zwischen Hering und Brentano), ob es eine einfache
oder zusammengesetzte Qualität ist (Blau-Gelb). Daß aber »Violett« »Rot-Blau« ist,
sehen fast alle; und auf das Sehen kommt es an, auf das innerhalb der Erschei-
nungen liegende Erleben, und nicht auf gewisse physikalische oder physiologische
Entstehungsursachen. Fragen der Beschreibung und Fragen der Ableitung müssen
hier reinlichst geschieden werden.
So scheint mir dieses Werk trotz mancher geistreichen Bemerkung doch im
Grunde verfehlt; statt eindringender psychologischer Analysen herrschen Fiktionen.
Schade um die prachtvolle Ausstattung (sehr geschmackvoller Buchschmuck und
sieben große Farbentafeln), die der Verlag der Arbeit zu teil werden ließ.
Prag" Emil Utitz.
') Daß das sogenannte Farbengehör hie und da recht abnorme Erscheinungen
zeitigt, ist bekannt; sie aber zur Grundlage von psychischen Untersuchungen machen
zu wollen, wäre ähnlich, wie wenn man die Farbeneindrücke eines Farbenblinden
einer Farbentheorie zu Grunde legen möchte.
siebenfach zerlegte Schattierung einer Farbe für die Malerei«. Schon Chevreul gab
für Zwecke des Kunstgewerbes u. s. w. Farbentafeln mit 21 Nuancen der gleichen
Farbe heraus; der Farbenkreisel zeigt uns weit mehr deutlich voneinander unter-
schiedene Nuancen, und der Maler verwendet sogar oft allmählich ineinander über-
gehende und erzielt damit treffliche Wirkungen. Also der Vergleich stimmt durch-
aus nicht! Ebensowenig wie folgende rein willkürlich konstruierte Verschiedenheit:
während man bei Tönen jeden beliebigen als Qrundton nehmen kann, muß man
bei den Farben immer von Rot ausgehen. Sind denn aber nicht Gelb und Blau
ebenso Grundfarben? Tatsache ist nur, daß es beim Gesichtssinn bloß drei (nach
Hering vier) einfache, gesättigte Qualitäten gibt, während der Gehörssinn eine große
Reihe aufweist. Ferner nimmt der Verfasser für bestimmte Töne ganz bestimmte
Farben an; nun besteht aber ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Sinnen
darin, daß die einfachen Qualitäten des Gesichtssinns stark gefühlsbetont sind, wäh-
rend die einfachen Töne — soweit sie sich nicht durch größere Höhenunterschiede
unterscheiden — schwach gefühlsbetont sind. Was wir gewöhnlich hören (Violine,
Klavier, Trompete u. s. w.), sind ja durchaus keine einfachen Töne (man denke an
die Obertöne; der Verfasser nimmt sogar auch Untertöne an), sondern Akkorde;
und dann ist das gleiche c einer Trompete und einer Violine ganz anders gefühls-
betont. Da könnte man viel eher mit Farbenvergleichen kommen. Aber darum
hat sich unser Autor nicht gekümmert. Für jede Terz, für jede Quinte erbringt er
andere Farben (man sehe nur die verwirrende Fülle auf seinen Tafeln), doch glaube
ich, daß wohl selten jemand diese psychischen Tatbestände wirklich erlebt1); das
sind — meiner Meinung nach — geistreiche Konstruktionen, wie sie ja früher in
der Ästhetik recht beliebt waren. Das Richtige hat hier wohl Franz Brentano ge-
troffen; ich zitiere aus seinen Ausführungen nur folgenden Satz: »Für alle isoliert
gegebenen kleinen Terzen, großen Terzen und Quinten ist ein gewisser Gefühls-
charakter gegeben; und wenn derselbe auch auf dem Farbengebiete, nämlich bei den
Doppelfarben Violett, Orange und Grün wiederkehrt, ... so dürfte dies darauf deuten,
daß die relative Lage der Farbenelemente in Violett, Orange und Grün in der Tat
denen zweier Tonelemente in der kleinen Terz, großen Terz und Quint analog ist.«
Seinen ganzen Untersuchungen legt der Verfasser die Young-Helmholtzsche
Farbentheorie zu Grunde, die Grün, Violett und Rot als Grundfarben annimmt.
Diese Theorie ist nun mehr als bedenklich. Bezüglich »Grün« ist ein Streit begreif-
licher und er besteht ja auch (zwischen Hering und Brentano), ob es eine einfache
oder zusammengesetzte Qualität ist (Blau-Gelb). Daß aber »Violett« »Rot-Blau« ist,
sehen fast alle; und auf das Sehen kommt es an, auf das innerhalb der Erschei-
nungen liegende Erleben, und nicht auf gewisse physikalische oder physiologische
Entstehungsursachen. Fragen der Beschreibung und Fragen der Ableitung müssen
hier reinlichst geschieden werden.
So scheint mir dieses Werk trotz mancher geistreichen Bemerkung doch im
Grunde verfehlt; statt eindringender psychologischer Analysen herrschen Fiktionen.
Schade um die prachtvolle Ausstattung (sehr geschmackvoller Buchschmuck und
sieben große Farbentafeln), die der Verlag der Arbeit zu teil werden ließ.
Prag" Emil Utitz.
') Daß das sogenannte Farbengehör hie und da recht abnorme Erscheinungen
zeitigt, ist bekannt; sie aber zur Grundlage von psychischen Untersuchungen machen
zu wollen, wäre ähnlich, wie wenn man die Farbeneindrücke eines Farbenblinden
einer Farbentheorie zu Grunde legen möchte.