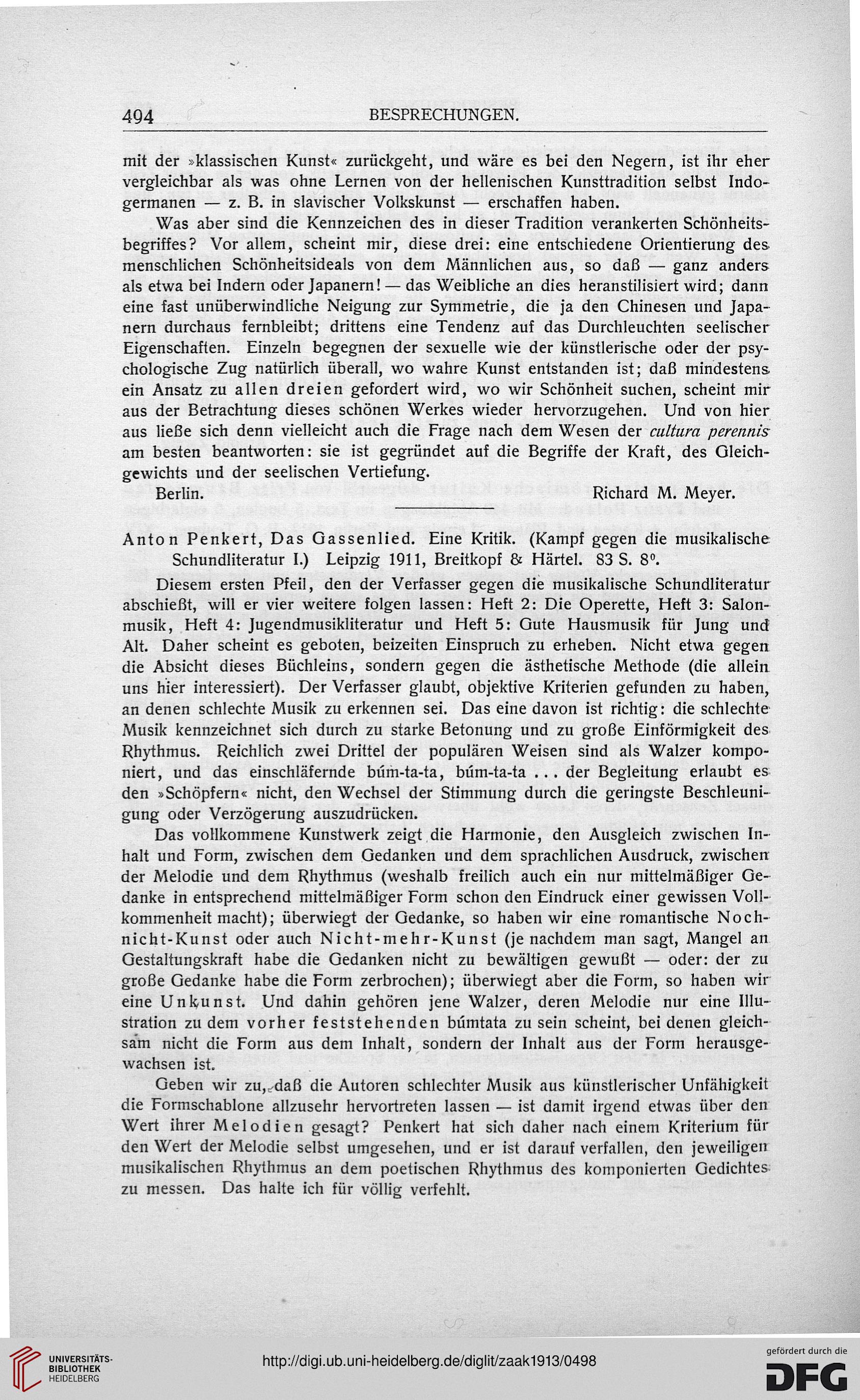494 BESPRECHUNGEN.
mit der »klassischen Kunst« zurückgeht, und wäre es bei den Negern, ist ihr eher
vergleichbar als was ohne Lernen von der hellenischen Kunsttradition selbst Indo-
germanen — z. B. in slavischer Volkskunst — erschaffen haben.
Was aber sind die Kennzeichen des in dieser Tradition verankerten Schönheits-
begriffes? Vor allem, scheint mir, diese drei: eine entschiedene Orientierung des
menschlichen Schönheitsideals von dem Männlichen aus, so daß — ganz anders
als etwa bei Indern oder Japanern! — das Weibliche an dies heranstilisiert wird; dann
eine fast unüberwindliche Neigung zur Symmetrie, die ja den Chinesen und Japa-
nern durchaus fernbleibt; drittens eine Tendenz auf das Durchleuchten seelischer
Eigenschaften. Einzeln begegnen der sexuelle wie der künstlerische oder der psy-
chologische Zug natürlich überall, wo wahre Kunst entstanden ist; daß mindestens
ein Ansatz zu allen dreien gefordert wird, wo wir Schönheit suchen, scheint mir
aus der Betrachtung dieses schönen Werkes wieder hervorzugehen. Und von hier
aus ließe sich denn vielleicht auch die Frage nach dem Wesen der cultura perennis
am besten beantworten: sie ist gegründet auf die Begriffe der Kraft, des Gleich-
gewichts und der seelischen Vertiefung.
Berlin. Richard M. Meyer.
Anton Penkert, Das Gassenlied. Eine Kritik. (Kampf gegen die musikalische
Schundliteraturl.) Leipzig 1911, Breitkopf & Härtel. 83 S. 8°.
Diesem ersten Pfeil, den der Verfasser gegen die musikalische Schundliteratur
abschießt, will er vier weitere folgen lassen: Heft 2: Die Operette, Heft 3: Salon-
musik, Heft 4: Jugendmusikliteratur und Heft 5: Gute Hausmusik für Jung und
Alt. Daher scheint es geboten, beizeiten Einspruch zu erheben. Nicht etwa gegen
die Absicht dieses Büchleins, sondern gegen die ästhetische Methode (die allein
uns hier interessiert). Der Verfasser glaubt, objektive Kriterien gefunden zu haben,
an denen schlechte Musik zu erkennen sei. Das eine davon ist richtig: die schlechte
Musik kennzeichnet sich durch zu starke Betonung und zu große Einförmigkeit des
Rhythmus. Reichlich zwei Drittel der populären Weisen sind als Walzer kompo-
niert, und das einschläfernde büm-ta-ta, büm-ta-ta .. . der Begleitung erlaubt es
den »Schöpfern« nicht, den Wechsel der Stimmung durch die geringste Beschleuni-
gung oder Verzögerung auszudrücken.
Das vollkommene Kunstwerk zeigt die Harmonie, den Ausgleich zwischen In-
halt und Form, zwischen dem Gedanken und dem sprachlichen Ausdruck, zwischen:
der Melodie und dem Rhythmus (weshalb freilich auch ein nur mittelmäßiger Ge-
danke in entsprechend mittelmäßiger Form schon den Eindruck einer gewissen Voll-
kommenheit macht); überwiegt der Gedanke, so haben wir eine romantische Noch-
nicht-Kunst oder auch Nicht-mehr-Kunst (je nachdem man sagt, Mangel an
Gestaltungskraft habe die Gedanken nicht zu bewältigen gewußt — oder: der zu
große Gedanke habe die Form zerbrochen); überwiegt aber die Form, so haben wir
eine Unkunst. Und dahin gehören jene Walzer, deren Melodie nur eine Illu-
stration zu dem vorher feststehenden bümtata zu sein scheint, bei denen gleich-
sam nicht die Form aus dem Inhalt, sondern der Inhalt aus der Form herausge-
wachsen ist.
Geben wir zu,^daß die Autoren schlechter Musik aus künstlerischer Unfähigkeit
die Formschablone allzusehr hervortreten lassen — ist damit irgend etwas über den
Wert ihrer Melodien gesagt? Penkert hat sich daher nach einem Kriterium für
den Wert der Melodie selbst umgesehen, und er ist darauf verfallen, den jeweiligen
musikalischen Rhythmus an dem poetischen Rhythmus des komponierten Gedichtes
zu messen. Das halte ich für völlig verfehlt.
mit der »klassischen Kunst« zurückgeht, und wäre es bei den Negern, ist ihr eher
vergleichbar als was ohne Lernen von der hellenischen Kunsttradition selbst Indo-
germanen — z. B. in slavischer Volkskunst — erschaffen haben.
Was aber sind die Kennzeichen des in dieser Tradition verankerten Schönheits-
begriffes? Vor allem, scheint mir, diese drei: eine entschiedene Orientierung des
menschlichen Schönheitsideals von dem Männlichen aus, so daß — ganz anders
als etwa bei Indern oder Japanern! — das Weibliche an dies heranstilisiert wird; dann
eine fast unüberwindliche Neigung zur Symmetrie, die ja den Chinesen und Japa-
nern durchaus fernbleibt; drittens eine Tendenz auf das Durchleuchten seelischer
Eigenschaften. Einzeln begegnen der sexuelle wie der künstlerische oder der psy-
chologische Zug natürlich überall, wo wahre Kunst entstanden ist; daß mindestens
ein Ansatz zu allen dreien gefordert wird, wo wir Schönheit suchen, scheint mir
aus der Betrachtung dieses schönen Werkes wieder hervorzugehen. Und von hier
aus ließe sich denn vielleicht auch die Frage nach dem Wesen der cultura perennis
am besten beantworten: sie ist gegründet auf die Begriffe der Kraft, des Gleich-
gewichts und der seelischen Vertiefung.
Berlin. Richard M. Meyer.
Anton Penkert, Das Gassenlied. Eine Kritik. (Kampf gegen die musikalische
Schundliteraturl.) Leipzig 1911, Breitkopf & Härtel. 83 S. 8°.
Diesem ersten Pfeil, den der Verfasser gegen die musikalische Schundliteratur
abschießt, will er vier weitere folgen lassen: Heft 2: Die Operette, Heft 3: Salon-
musik, Heft 4: Jugendmusikliteratur und Heft 5: Gute Hausmusik für Jung und
Alt. Daher scheint es geboten, beizeiten Einspruch zu erheben. Nicht etwa gegen
die Absicht dieses Büchleins, sondern gegen die ästhetische Methode (die allein
uns hier interessiert). Der Verfasser glaubt, objektive Kriterien gefunden zu haben,
an denen schlechte Musik zu erkennen sei. Das eine davon ist richtig: die schlechte
Musik kennzeichnet sich durch zu starke Betonung und zu große Einförmigkeit des
Rhythmus. Reichlich zwei Drittel der populären Weisen sind als Walzer kompo-
niert, und das einschläfernde büm-ta-ta, büm-ta-ta .. . der Begleitung erlaubt es
den »Schöpfern« nicht, den Wechsel der Stimmung durch die geringste Beschleuni-
gung oder Verzögerung auszudrücken.
Das vollkommene Kunstwerk zeigt die Harmonie, den Ausgleich zwischen In-
halt und Form, zwischen dem Gedanken und dem sprachlichen Ausdruck, zwischen:
der Melodie und dem Rhythmus (weshalb freilich auch ein nur mittelmäßiger Ge-
danke in entsprechend mittelmäßiger Form schon den Eindruck einer gewissen Voll-
kommenheit macht); überwiegt der Gedanke, so haben wir eine romantische Noch-
nicht-Kunst oder auch Nicht-mehr-Kunst (je nachdem man sagt, Mangel an
Gestaltungskraft habe die Gedanken nicht zu bewältigen gewußt — oder: der zu
große Gedanke habe die Form zerbrochen); überwiegt aber die Form, so haben wir
eine Unkunst. Und dahin gehören jene Walzer, deren Melodie nur eine Illu-
stration zu dem vorher feststehenden bümtata zu sein scheint, bei denen gleich-
sam nicht die Form aus dem Inhalt, sondern der Inhalt aus der Form herausge-
wachsen ist.
Geben wir zu,^daß die Autoren schlechter Musik aus künstlerischer Unfähigkeit
die Formschablone allzusehr hervortreten lassen — ist damit irgend etwas über den
Wert ihrer Melodien gesagt? Penkert hat sich daher nach einem Kriterium für
den Wert der Melodie selbst umgesehen, und er ist darauf verfallen, den jeweiligen
musikalischen Rhythmus an dem poetischen Rhythmus des komponierten Gedichtes
zu messen. Das halte ich für völlig verfehlt.