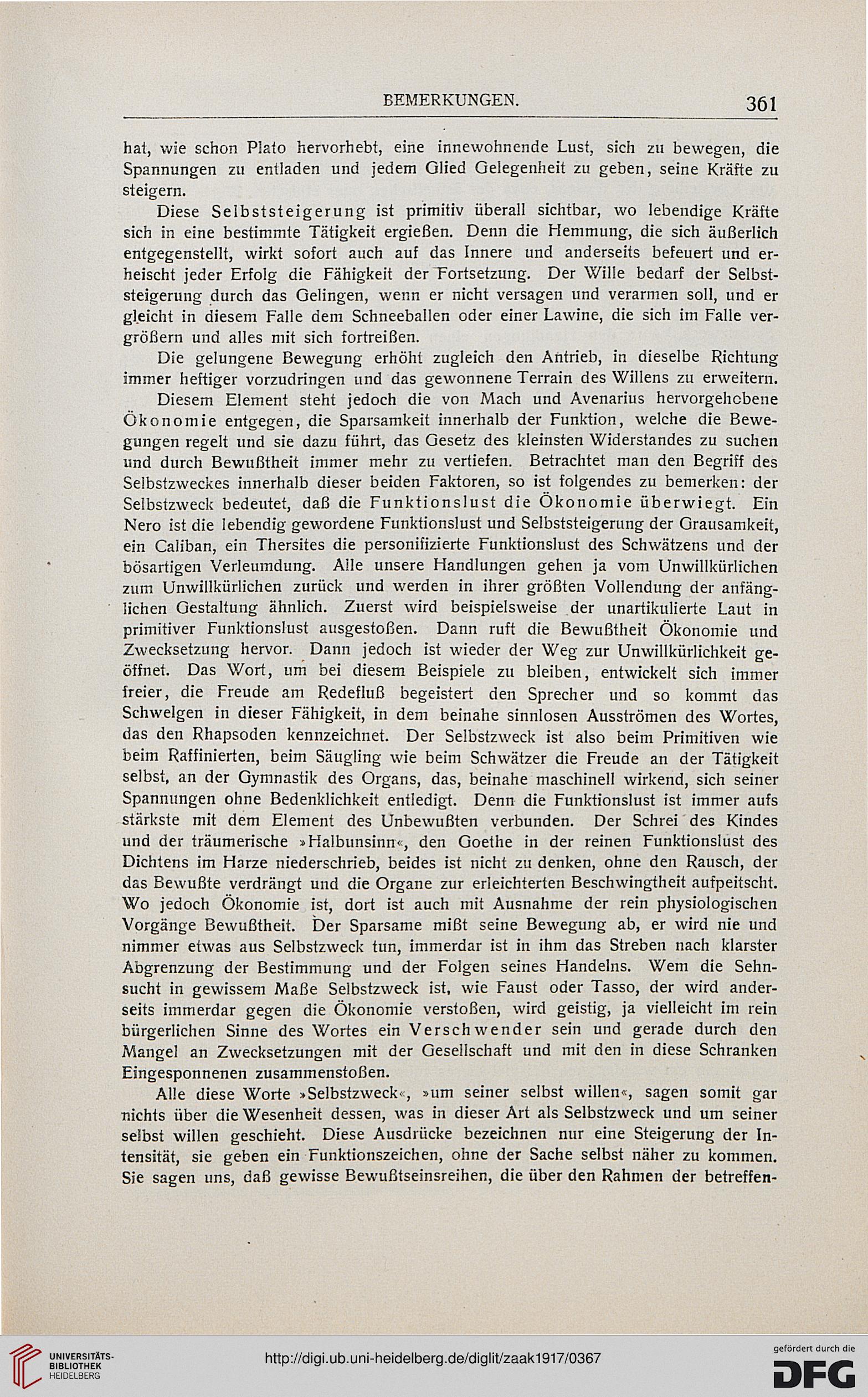BEMERKUNGEN. 261
hat, wie schon Plato hervorhebt, eine innewohnende Lust, sich zu bewegen, die
Spannungen zu entladen und jedem Glied Gelegenheit zu geben, seine Kräfte zu
steigern.
Diese Selbststeigerung ist primitiv überall sichtbar, wo lebendige Kräfte
sich in eine bestimmte Tätigkeit ergießen. Denn die Hemmung, die sich äußerlich
entgegenstellt, wirkt sofort auch auf das Innere und anderseits befeuert und er-
heischt jeder Erfolg die Fähigkeit der Tortsetzung. Der Wille bedarf der Selbst-
steigerung durch das Gelingen, wenn er nicht versagen und verarmen soll, und er
gleicht in diesem Falle dem Schneeballen oder einer Lawine, die sich im Falle ver-
größern und alles mit sich fortreißen.
Die gelungene Bewegung erhöht zugleich den Antrieb, in dieselbe Richtung
immer heftiger vorzudringen und das gewonnene Terrain des Willens zu erweitern.
Diesem Element steht jedoch die von Mach und Avenarius hervorgehebene
Ökonomie entgegen, die Sparsamkeit innerhalb der Funktion, welche die Bewe-
gungen regelt und sie dazu führt, das Gesetz des kleinsten Widerstandes zu suchen
und durch Bewußtheit immer mehr zu vertiefen. Betrachtet man den Begriff des
Selbstzweckes innerhalb dieser beiden Faktoren, so ist folgendes zu bemerken: der
Selbstzweck bedeutet, daß die Funktionslust die Ökonomie überwiegt. Ein
Nero ist die lebendig gewordene Funktionslust und Selbststeigerung der Grausamkeit,
ein Caliban, ein Thersites die personifizierte Funktionslust des Schwätzens und der
bösartigen Verleumdung. Alle unsere Handlungen gehen ja vom Unwillkürlichen
zum Unwillkürlichen zurück und werden in ihrer größten Vollendung der anfäng-
lichen Gestaltung ähnlich. Zuerst wird beispielsweise der unartikulierte Laut in
primitiver Funktionslust ausgestoßen. Dann ruft die Bewußtheit Ökonomie und
Zwecksetzung hervor. Dann jedoch ist wieder der Weg zur Unwillkürlichkeit ge-
öffnet. Das Wort, um bei diesem Beispiele zu bleiben, entwickelt sich immer
freier, die Freude am Redefluß begeistert den Sprecher und so kommt das
Schwelgen in dieser Fähigkeit, in dem beinahe sinnlosen Ausströmen des Wortes,
das den Rhapsoden kennzeichnet. Der Selbstzweck ist also beim Primitiven wie
beim Raffinierten, beim Säugling wie beim Schwätzer die Freude an der Tätigkeit
selbst, an der Gymnastik des Organs, das, beinahe maschinell wirkend, sich seiner
Spannungen ohne Bedenklichkeit entledigt. Denn die Funktionslust ist immer aufs
stärkste mit dem Element des Unbewußten verbunden. Der Schrei des Kindes
und der träumerische »Halbunsinn<, den Goethe in der reinen Funktionslust des
Dichtens im Harze niederschrieb, beides ist nicht zu denken, ohne den Rausch, der
das Bewußte verdrängt und die Organe zur erleichterten Beschwingtheit aufpeitscht.
Wo jedoch Ökonomie ist, dort ist auch mit Ausnahme der rein physiologischen
Vorgänge Bewußtheit. Der Sparsame mißt seine Bewegung ab, er wird nie und
nimmer etwas aus Selbstzweck tun, immerdar ist in ihm das Streben nach klarster
Abgrenzung der Bestimmung und der Folgen seines Handelns. Wem die Sehn-
sucht in gewissem Maße Selbstzweck ist, wie Faust oder Tasso, der wird ander-
seits immerdar gegen die Ökonomie verstoßen, wird geistig, ja vielleicht im rein
bürgerlichen Sinne des Wortes ein Verschwender sein und gerade durch den
Mangel an Zwecksetzungen mit der Gesellschaft und mit den in diese Schranken
Eingesponnenen zusammenstoßen.
Alle diese Worte »Selbstzweck, »um seiner selbst willen«, sagen somit gar
nichts über die Wesenheit dessen, was in dieser Art als Selbstzweck und um seiner
selbst willen geschieht. Diese Ausdrücke bezeichnen nur eine Steigerung der In-
tensität, sie geben ein Funktionszeichen, ohne der Sache selbst näher zu kommen.
Sie sagen uns, daß gewisse Bewußtseinsreihen, die über den Rahmen der betreffen-