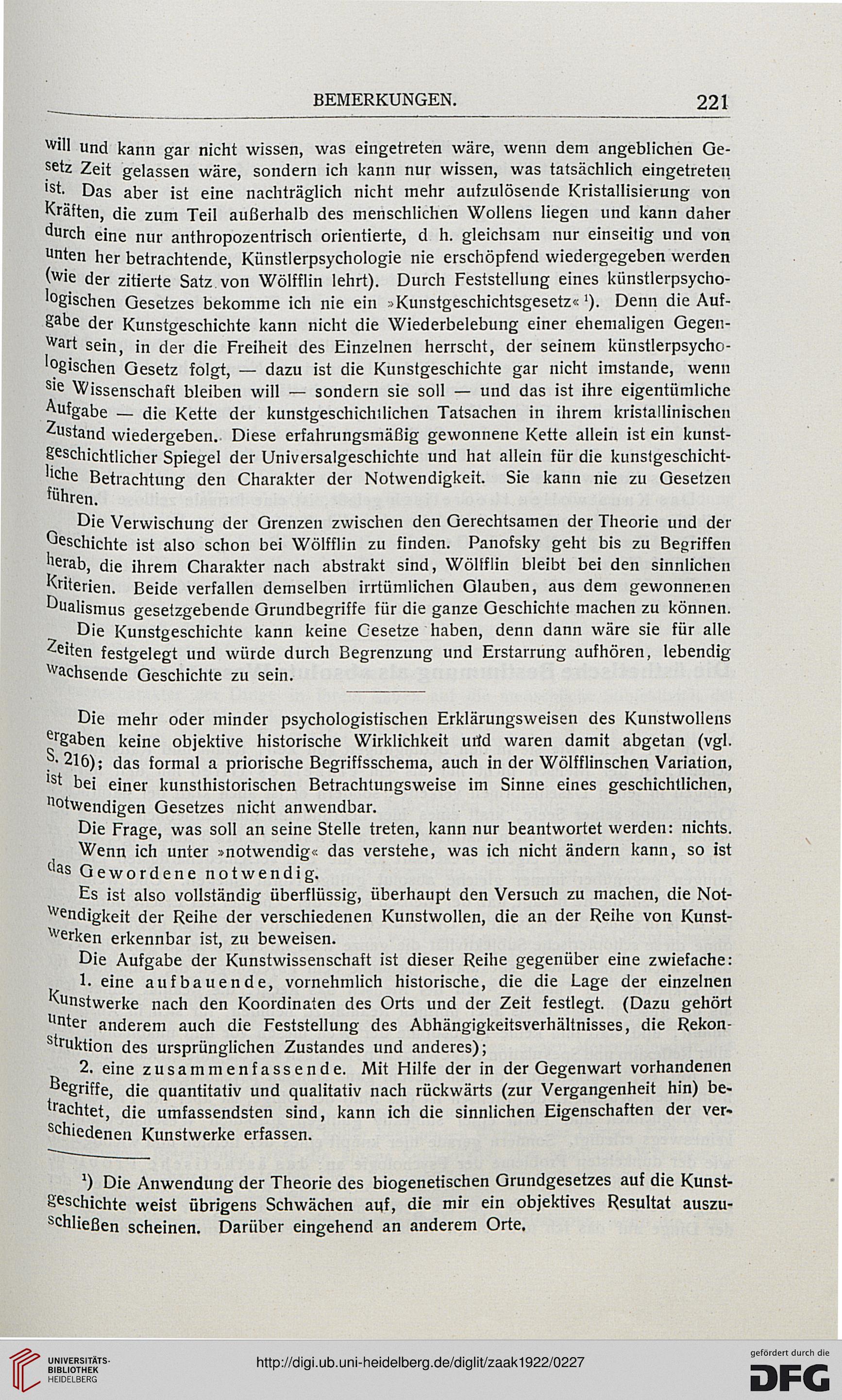BEMERKUNGEN. 221
W'H Und kann gar nicht wissen, was eingetreten wäre, wenn dem angeblichen Ge-
setz Zeit gelassen wäre, sondern ich kann nur wissen, was tatsächlich eingetreten
Is*' Das aber ist eine nachträglich nicht mehr aufzulösende Kristallisierung von
Kräften, die zum Teil außerhalb des menschlichen Wollens liegen und kann daher
durch eine nur anthropozentrisch orientierte, d h. gleichsam nur einseitig und von
unten her betrachtende, Künstlerpsychologie nie erschöpfend wiedergegeben werden
(wie der zitierte Satz von Wölfflin lehrt). Durch Feststellung eines künstlerpsycho-
'ogischen Gesetzes bekomme ich nie ein :>Kunstgeschichtsgesetz« '). Denn die Auf-
gabe der Kunstgeschichte kann nicht die Wiederbelebung einer ehemaligen Gegen-
wart sein, in der die Freiheit des Einzelnen herrscht, der seinem künstlerpsycho-
°§ischen Gesetz folgt, — dazu ist die Kunstgeschichte gar nicht imstande, wenn
Sle Wissenschaft bleiben will — sondern sie soll — und das ist ihre eigentümliche
Aufgabe — die Kette der kunstgeschichtlichen Tatsachen in ihrem kristallinischen
Zustand wiedergeben. Diese erfahrungsmäßig gewonnene Kette allein ist ein kunst-
§eschichtlicher Spiegel der Universalgeschichte und hat allein für die kunstgeschicht-
'che Betrachtung den Charakter der Notwendigkeit. Sie kann nie zu Gesetzen
führen.
Die Verwischung der Grenzen zwischen den Gerechtsamen der Theorie und der
beschichte ist also schon bei Wölfflin zu finden. Panofsky geht bis zu Begriffen
uerab, die ihrem Charakter nach abstrakt sind, Wölfflin bleibt bei den sinnlichen
Kriterien. Beide verfallen demselben irrtümlichen Glauben, aus dem gewonnenen
Uüalismus gesetzgebende Grundbegriffe für die ganze Geschichte machen zu können.
Die Kunstgeschichte kann keine Gesetze haben, denn dann wäre sie für alle
leiten festgelegt und würde durch Begrenzung und Erstarrung aufhören, lebendig
Wachsende Geschichte zu sein.
Die mehr oder minder psychologistischen Erklärungsweisen des Kunstwollens
rgaben keine objektive historische Wirklichkeit uftd waren damit abgetan (vgl.
.•216); das formal a priorische Begriffsschema, auch in der Wölfflinschen Variation,
lst bei einer kunsthistorischen Betrachtungsweise im Sinne eines geschichtlichen,
"otwendigen Gesetzes nicht anwendbar.
Die Frage, was soll an seine Stelle treten, kann nur beantwortet werden: nichts.
Wenn ich unter »notwendig« das verstehe, was ich nicht ändern kann, so ist
"as Gewordene notwendig.
Es ist also vollständig überflüssig, überhaupt den Versuch zu machen, die Not-
Wendigkeit der Reihe der verschiedenen Kunstwollen, die an der Reihe von Kunst-
werken erkennbar ist, zu beweisen.
Die Aufgabe der Kunstwissenschaft ist dieser Reihe gegenüber eine zwiefache:
1. eine aufbauende, vornehmlich historische, die die Lage der einzelnen
Kunstwerke nach den Koordinaten des Orts und der Zeit festlegt. (Dazu gehört
"uer anderem auch die Feststellung des Abhängigkeitsverhältnisses, die Rekon-
'fuktion des ursprünglichen Zustandes und anderes);
2. eine zusammenfassende. Mit Hilfe der in der Gegenwart vorhandenen
öegriffe, die quantitativ und qualitativ nach rückwärts (zur Vergangenheit hin) be-
dachtet, die umfassendsten sind, kann ich die sinnlichen Eigenschaften der ver-
schiedenen Kunstwerke erfassen.
') Die Anwendung der Theorie des biogenetischen Grundgesetzes auf die Kunst-
geschichte weist übrigens Schwächen auf, die mir ein objektives Resultat auszu-
sehließen scheinen. Darüber eingehend an anderem Orte,
W'H Und kann gar nicht wissen, was eingetreten wäre, wenn dem angeblichen Ge-
setz Zeit gelassen wäre, sondern ich kann nur wissen, was tatsächlich eingetreten
Is*' Das aber ist eine nachträglich nicht mehr aufzulösende Kristallisierung von
Kräften, die zum Teil außerhalb des menschlichen Wollens liegen und kann daher
durch eine nur anthropozentrisch orientierte, d h. gleichsam nur einseitig und von
unten her betrachtende, Künstlerpsychologie nie erschöpfend wiedergegeben werden
(wie der zitierte Satz von Wölfflin lehrt). Durch Feststellung eines künstlerpsycho-
'ogischen Gesetzes bekomme ich nie ein :>Kunstgeschichtsgesetz« '). Denn die Auf-
gabe der Kunstgeschichte kann nicht die Wiederbelebung einer ehemaligen Gegen-
wart sein, in der die Freiheit des Einzelnen herrscht, der seinem künstlerpsycho-
°§ischen Gesetz folgt, — dazu ist die Kunstgeschichte gar nicht imstande, wenn
Sle Wissenschaft bleiben will — sondern sie soll — und das ist ihre eigentümliche
Aufgabe — die Kette der kunstgeschichtlichen Tatsachen in ihrem kristallinischen
Zustand wiedergeben. Diese erfahrungsmäßig gewonnene Kette allein ist ein kunst-
§eschichtlicher Spiegel der Universalgeschichte und hat allein für die kunstgeschicht-
'che Betrachtung den Charakter der Notwendigkeit. Sie kann nie zu Gesetzen
führen.
Die Verwischung der Grenzen zwischen den Gerechtsamen der Theorie und der
beschichte ist also schon bei Wölfflin zu finden. Panofsky geht bis zu Begriffen
uerab, die ihrem Charakter nach abstrakt sind, Wölfflin bleibt bei den sinnlichen
Kriterien. Beide verfallen demselben irrtümlichen Glauben, aus dem gewonnenen
Uüalismus gesetzgebende Grundbegriffe für die ganze Geschichte machen zu können.
Die Kunstgeschichte kann keine Gesetze haben, denn dann wäre sie für alle
leiten festgelegt und würde durch Begrenzung und Erstarrung aufhören, lebendig
Wachsende Geschichte zu sein.
Die mehr oder minder psychologistischen Erklärungsweisen des Kunstwollens
rgaben keine objektive historische Wirklichkeit uftd waren damit abgetan (vgl.
.•216); das formal a priorische Begriffsschema, auch in der Wölfflinschen Variation,
lst bei einer kunsthistorischen Betrachtungsweise im Sinne eines geschichtlichen,
"otwendigen Gesetzes nicht anwendbar.
Die Frage, was soll an seine Stelle treten, kann nur beantwortet werden: nichts.
Wenn ich unter »notwendig« das verstehe, was ich nicht ändern kann, so ist
"as Gewordene notwendig.
Es ist also vollständig überflüssig, überhaupt den Versuch zu machen, die Not-
Wendigkeit der Reihe der verschiedenen Kunstwollen, die an der Reihe von Kunst-
werken erkennbar ist, zu beweisen.
Die Aufgabe der Kunstwissenschaft ist dieser Reihe gegenüber eine zwiefache:
1. eine aufbauende, vornehmlich historische, die die Lage der einzelnen
Kunstwerke nach den Koordinaten des Orts und der Zeit festlegt. (Dazu gehört
"uer anderem auch die Feststellung des Abhängigkeitsverhältnisses, die Rekon-
'fuktion des ursprünglichen Zustandes und anderes);
2. eine zusammenfassende. Mit Hilfe der in der Gegenwart vorhandenen
öegriffe, die quantitativ und qualitativ nach rückwärts (zur Vergangenheit hin) be-
dachtet, die umfassendsten sind, kann ich die sinnlichen Eigenschaften der ver-
schiedenen Kunstwerke erfassen.
') Die Anwendung der Theorie des biogenetischen Grundgesetzes auf die Kunst-
geschichte weist übrigens Schwächen auf, die mir ein objektives Resultat auszu-
sehließen scheinen. Darüber eingehend an anderem Orte,