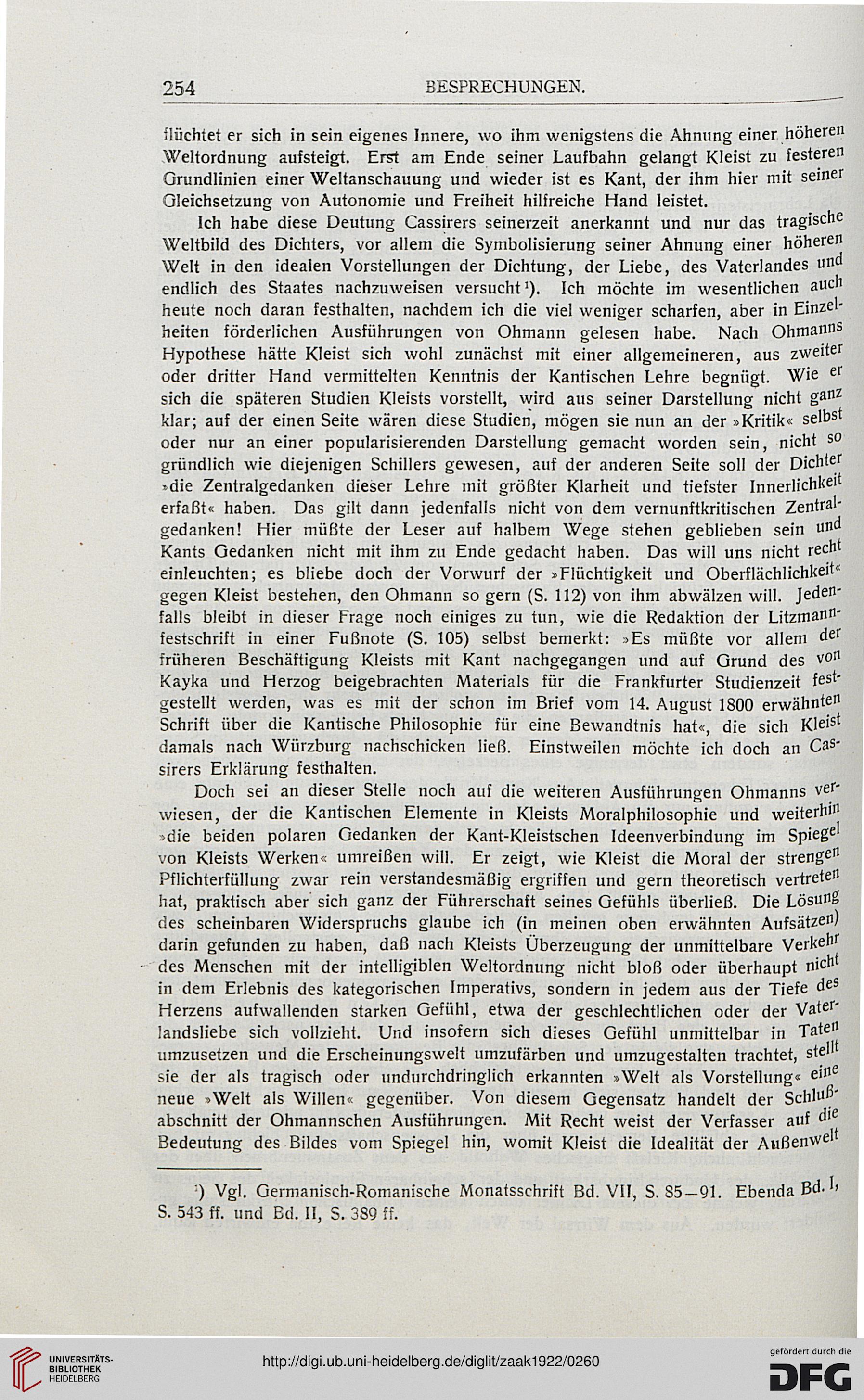254 • BESPRECHUNGEN.
flüchtet er sich in sein eigenes Innere, wo ihm wenigstens die Ahnung einer höheren
Weltordnung aufsteigt. Erst am Ende seiner Laufbahn gelangt Kleist zu festeren
Grundlinien einer Weltanschauung und wieder ist es Kant, der ihm hier mit seiner
Gleichsetzung von Autonomie und Freiheit hilfreiche Hand leistet.
Ich habe diese Deutung Cassirers seinerzeit anerkannt und nur das tragische
Weltbild des Dichters, vor allem die Symbolisierung seiner Ahnung einer höheren
Welt in den idealen Vorstellungen der Dichtung, der Liebe, des Vaterlandes und
endlich des Staates nachzuweisen versucht'). Ich möchte im wesentlichen auch
heute noch daran festhalten, nachdem ich die viel weniger scharfen, aber in Einzel-
heiten förderlichen Ausführungen von Ohmann gelesen habe. Nach Ohmanns
Hypothese hätte Kleist sich wohl zunächst mit einer allgemeineren, aus zweiter
oder dritter Hand vermittelten Kenntnis der Kantischen Lehre begnügt. Wie er
sich die späteren Studien Kleists vorstellt, wird aus seiner Darstellung nicht ganZ
klar; auf der einen Seite wären diese Studien, mögen sie nun an der »Kritik« selbst
oder nur an einer popularisierenden Darstellung gemacht worden sein, nicht so
gründlich wie diejenigen Schillers gewesen, auf der anderen Seite soll der Dicl"er
»die Zentralgedanken dieser Lehre mit größter Klarheit und tiefster Innerlichkeit
erfaßt« haben. Das gilt dann jedenfalls nicht von dem vernunftkritischen Zentral-
gedanken! Hier müßte der Leser auf halbem Wege stehen geblieben sein und
Kants Gedanken nicht mit ihm zu Ende gedacht haben. Das will uns nicht rech'
einleuchten; es bliebe doch der Vorwurf der »Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit4
gegen Kleist bestehen, den Ohmann so gern (S. 112) von ihm abwälzen will. Jeden-
falls bleibt in dieser Frage noch einiges zu tun, wie die Redaktion der Litzmann-
festschrift in einer Fußnote (S. 105) selbst bemerkt: »Es müßte vor allem der
früheren Beschäftigung Kleists mit Kant nachgegangen und auf Grund des von
Kayka und Herzog beigebrachten Materials für die Frankfurter Studienzeit fest-
gestellt werden, was es mit der schon im Brief vom 14. August 1800 erwähnte"
Schrift über die Kantische Philosophie für eine Bewandtnis hat«, die sich KlelS
damals nach Würzburg nachschicken ließ. Einstweilen möchte ich doch an Cas-
sirers Erklärung festhalten.
Doch sei an dieser Stelle noch auf die weiteren Ausführungen Ohmanns ver-
wiesen, der die Kantischen Elemente in Kleists Moralphilosophie und weiterhin
»die beiden polaren Gedanken der Kant-Kleistschen Ideenverbindung im Spiege
von Kleists Werken« umreißen will. Er zeigt, wie Kleist die Moral der strengen
Pflichterfüllung zwar rein verstandesmäßig ergriffen und gern theoretisch vertrete"
hat, praktisch aber sich ganz der Führerschaft seines Gefühls überließ. Die LösunD
des scheinbaren Widerspruchs glaube ich (in meinen oben erwähnten Aufsätzen/
darin gefunden zu haben, daß nach Kleists Überzeugung der unmittelbare Verker>r
des Menschen mit der intelligiblen Weltordnung nicht bloß oder überhaupt nicn
in dem Erlebnis des kategorischen Imperativs, sondern in jedem aus der Tiefe de5
Herzens aufwallenden starken Gefühl, etwa der geschlechtlichen oder der Vater-
landsliebe sich vollzieht. Und insofern sich dieses Gefühl unmittelbar in Täte''
umzusetzen und die Erscheinungswelt umzufärben und umzugestalten trachtet, stel
sie der als tragisch oder undurchdringlich erkannten »Welt als Vorstellung« e'ne
neue »Welt als Willen« gegenüber. Von diesem Gegensatz handelt der Schh'"'
abschnitt der Ohmannschen Ausführungen. Mit Recht weist der Verfasser auf "'e
Bedeutung des Bildes vom Spiegel hin, womit Kleist die Idealität der Außenvve
:) Vgl. Germanisch-Romanische Monatsschrift Bd. VII, S. S5-91. Ebenda ßd-1,
S. 543 ff. und Bd. II, S. 339 ff.
flüchtet er sich in sein eigenes Innere, wo ihm wenigstens die Ahnung einer höheren
Weltordnung aufsteigt. Erst am Ende seiner Laufbahn gelangt Kleist zu festeren
Grundlinien einer Weltanschauung und wieder ist es Kant, der ihm hier mit seiner
Gleichsetzung von Autonomie und Freiheit hilfreiche Hand leistet.
Ich habe diese Deutung Cassirers seinerzeit anerkannt und nur das tragische
Weltbild des Dichters, vor allem die Symbolisierung seiner Ahnung einer höheren
Welt in den idealen Vorstellungen der Dichtung, der Liebe, des Vaterlandes und
endlich des Staates nachzuweisen versucht'). Ich möchte im wesentlichen auch
heute noch daran festhalten, nachdem ich die viel weniger scharfen, aber in Einzel-
heiten förderlichen Ausführungen von Ohmann gelesen habe. Nach Ohmanns
Hypothese hätte Kleist sich wohl zunächst mit einer allgemeineren, aus zweiter
oder dritter Hand vermittelten Kenntnis der Kantischen Lehre begnügt. Wie er
sich die späteren Studien Kleists vorstellt, wird aus seiner Darstellung nicht ganZ
klar; auf der einen Seite wären diese Studien, mögen sie nun an der »Kritik« selbst
oder nur an einer popularisierenden Darstellung gemacht worden sein, nicht so
gründlich wie diejenigen Schillers gewesen, auf der anderen Seite soll der Dicl"er
»die Zentralgedanken dieser Lehre mit größter Klarheit und tiefster Innerlichkeit
erfaßt« haben. Das gilt dann jedenfalls nicht von dem vernunftkritischen Zentral-
gedanken! Hier müßte der Leser auf halbem Wege stehen geblieben sein und
Kants Gedanken nicht mit ihm zu Ende gedacht haben. Das will uns nicht rech'
einleuchten; es bliebe doch der Vorwurf der »Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit4
gegen Kleist bestehen, den Ohmann so gern (S. 112) von ihm abwälzen will. Jeden-
falls bleibt in dieser Frage noch einiges zu tun, wie die Redaktion der Litzmann-
festschrift in einer Fußnote (S. 105) selbst bemerkt: »Es müßte vor allem der
früheren Beschäftigung Kleists mit Kant nachgegangen und auf Grund des von
Kayka und Herzog beigebrachten Materials für die Frankfurter Studienzeit fest-
gestellt werden, was es mit der schon im Brief vom 14. August 1800 erwähnte"
Schrift über die Kantische Philosophie für eine Bewandtnis hat«, die sich KlelS
damals nach Würzburg nachschicken ließ. Einstweilen möchte ich doch an Cas-
sirers Erklärung festhalten.
Doch sei an dieser Stelle noch auf die weiteren Ausführungen Ohmanns ver-
wiesen, der die Kantischen Elemente in Kleists Moralphilosophie und weiterhin
»die beiden polaren Gedanken der Kant-Kleistschen Ideenverbindung im Spiege
von Kleists Werken« umreißen will. Er zeigt, wie Kleist die Moral der strengen
Pflichterfüllung zwar rein verstandesmäßig ergriffen und gern theoretisch vertrete"
hat, praktisch aber sich ganz der Führerschaft seines Gefühls überließ. Die LösunD
des scheinbaren Widerspruchs glaube ich (in meinen oben erwähnten Aufsätzen/
darin gefunden zu haben, daß nach Kleists Überzeugung der unmittelbare Verker>r
des Menschen mit der intelligiblen Weltordnung nicht bloß oder überhaupt nicn
in dem Erlebnis des kategorischen Imperativs, sondern in jedem aus der Tiefe de5
Herzens aufwallenden starken Gefühl, etwa der geschlechtlichen oder der Vater-
landsliebe sich vollzieht. Und insofern sich dieses Gefühl unmittelbar in Täte''
umzusetzen und die Erscheinungswelt umzufärben und umzugestalten trachtet, stel
sie der als tragisch oder undurchdringlich erkannten »Welt als Vorstellung« e'ne
neue »Welt als Willen« gegenüber. Von diesem Gegensatz handelt der Schh'"'
abschnitt der Ohmannschen Ausführungen. Mit Recht weist der Verfasser auf "'e
Bedeutung des Bildes vom Spiegel hin, womit Kleist die Idealität der Außenvve
:) Vgl. Germanisch-Romanische Monatsschrift Bd. VII, S. S5-91. Ebenda ßd-1,
S. 543 ff. und Bd. II, S. 339 ff.