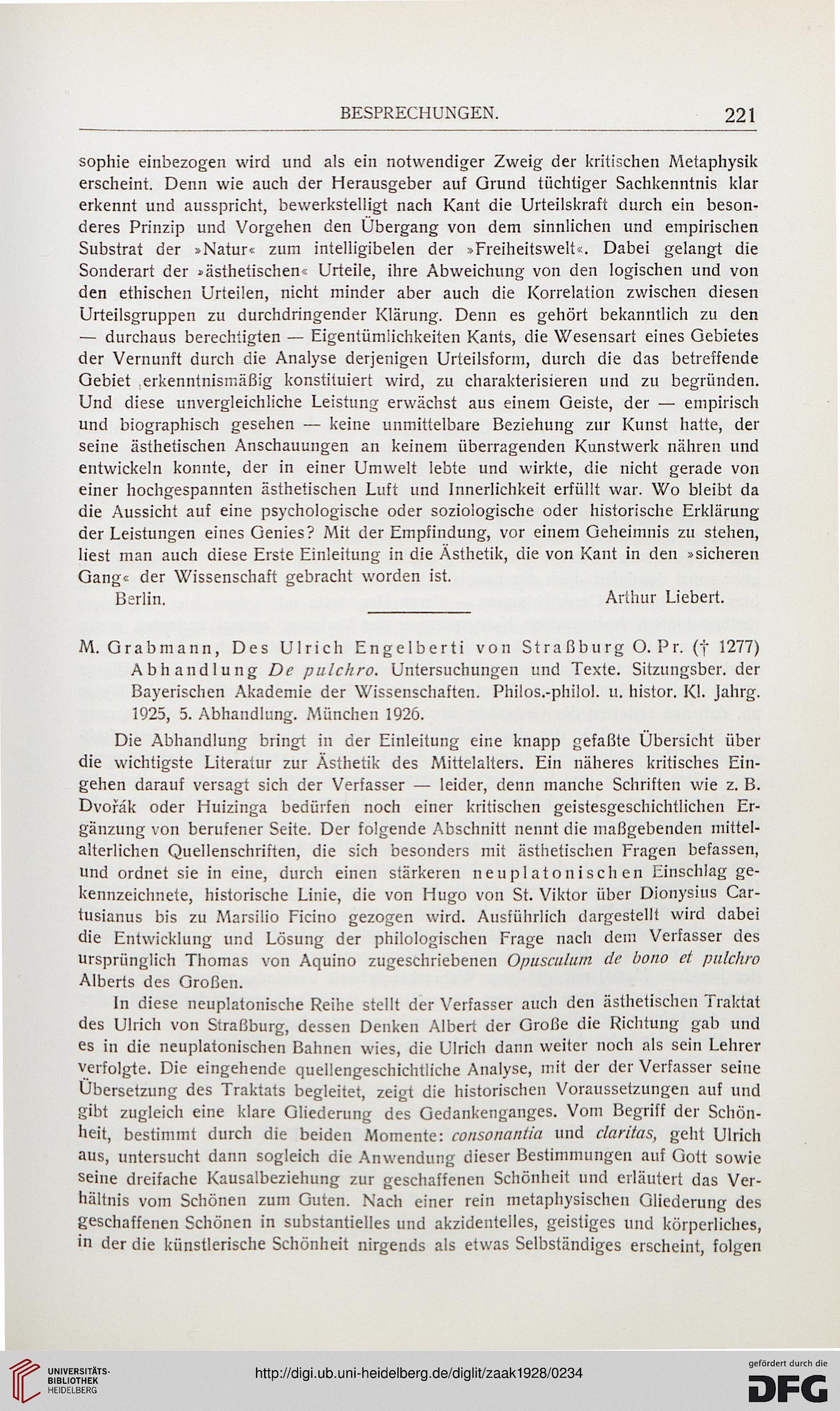BESPRECHUNGEN.
221
sophie einbezogen wird und als ein notwendiger Zweig der kritischen Metaphysik
erscheint. Denn wie auch der Herausgeber auf Grund tüchtiger Sachkenntnis klar
erkennt und ausspricht, bewerkstelligt nach Kant die Urteilskraft durch ein beson-
deres Prinzip und Vorgehen den Übergang von dem sinnlichen und empirischen
Substrat der »Natura zum intelligibelen der »Freiheitswelts. Dabei gelangt die
Sonderart der Ȋsthetischen* Urteile, ihre Abweichung von den logischen und von
den ethischen Urteilen, nicht minder aber auch die Korrelation zwischen diesen
Urteilsgruppen zu durchdringender Klärung. Denn es gehört bekanntlich zu den
— durchaus berechtigten — Eigentümlichkeiten Kants, die Wesensart eines Gebietes
der Vernunft durch die Analyse derjenigen Urteilsform, durch die das betreffende
Gebiet erkenntnismäßig konstituiert wird, zu charakterisieren und zu begründen.
Und diese unvergleichliche Leistung erwächst aus einem Geiste, der — empirisch
und biographisch gesehen — keine unmittelbare Beziehung zur Kunst hatte, der
seine ästhetischen Anschauungen an keinem überragenden Kunstwerk nähren und
entwickeln konnte, der in einer Umwelt lebte und wirkte, die nicht gerade von
einer hochgespannten ästhetischen Luft und Innerlichkeit erfüllt war. Wo bleibt da
die Aussicht auf eine psychologische oder soziologische oder historische Erklärung
der Leistungen eines Genies? Mit der Empfindung, vor einem Geheimnis zu stehen,
liest man auch diese Erste Einleitung in die Ästhetik, die von Kant in den »sicheren
Gange der Wissenschaft gebracht worden ist.
Berlin. Arthur Liebert.
M. Grabmann, Des Ulrich Engelberti von Straßburg O. Pr. (t 1277)
Abhandlung De pulchro. Untersuchungen und Texte. Sitzungsber. der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philos.-philol. lt. histor. Kl. Jahrg.
1925, 5. Abhandlung. München 1926.
Die Abhandlung bringt in der Einleitung eine knapp gefaßte Ubersicht über
die wichtigste Literatur zur Ästhetik des Mittelalters. Ein näheres kritisches Ein-
gehen darauf versagt sich der Verfasser — leider, denn manche Schriften wie z. B.
Dvofäk oder Huizinga bedürfen noch einer kritischen geistesgeschichtlichen Er-
gänzung von berufener Seite. Der folgende Abschnitt nennt die maßgebenden mittel-
alterlichen Quellenschriften, die sich besonders mit ästhetischen Fragen befassen,
und ordnet sie in eine, durch einen stärkeren neuplatonischen Einschlag ge-
kennzeichnete, historische Linie, die von Hugo von St. Viktor über Dionysius Car-
tusianus bis zu Marsilio Ficino gezogen wird. Ausführlich dargestellt wird dabei
die Entwicklung und Lösung der philologischen Frage nach dem Verfasser des
ursprünglich Thomas von Aquino zugeschriebenen Opuscutum de bona et pulchro
Alberts des Großen.
In diese neuplatonische Reihe stellt der Verfasser auch den ästhetischen Traktat
des Ulrich von Straßburg, dessen Denken Albert der Große die Richtung gab und
es in die neuplatonischen Bahnen wies, die Ulrich dann weiter noch als sein Lehrer
verfolgte. Die eingehende quellengeschichtliche Analyse, mit der der Verfasser seine
Übersetzung des Traktats begleitet, zeigt die historischen Voraussetzungen auf und
gibt zugleich eine klare Gliederung des Gedankenganges. Vom Begriff der Schön-
heit, bestimmt durch die beiden Momente: consonantia und claritas, geht Ulrich
aus, untersucht dann sogleich die Anwendung dieser Bestimmungen auf Gott sowie
seine dreifache Kausalbeziehung zur geschaffenen Schönheit und erläutert das Ver-
hältnis vom Schönen zum Guten. Nach einer rein metaphysischen Gliederung des
geschaffenen Schönen in substantielles und akzidentelles, geistiges und körperliches,
in der die künstlerische Schönheit nirgends als etwas Selbständiges erscheint, folgen
221
sophie einbezogen wird und als ein notwendiger Zweig der kritischen Metaphysik
erscheint. Denn wie auch der Herausgeber auf Grund tüchtiger Sachkenntnis klar
erkennt und ausspricht, bewerkstelligt nach Kant die Urteilskraft durch ein beson-
deres Prinzip und Vorgehen den Übergang von dem sinnlichen und empirischen
Substrat der »Natura zum intelligibelen der »Freiheitswelts. Dabei gelangt die
Sonderart der Ȋsthetischen* Urteile, ihre Abweichung von den logischen und von
den ethischen Urteilen, nicht minder aber auch die Korrelation zwischen diesen
Urteilsgruppen zu durchdringender Klärung. Denn es gehört bekanntlich zu den
— durchaus berechtigten — Eigentümlichkeiten Kants, die Wesensart eines Gebietes
der Vernunft durch die Analyse derjenigen Urteilsform, durch die das betreffende
Gebiet erkenntnismäßig konstituiert wird, zu charakterisieren und zu begründen.
Und diese unvergleichliche Leistung erwächst aus einem Geiste, der — empirisch
und biographisch gesehen — keine unmittelbare Beziehung zur Kunst hatte, der
seine ästhetischen Anschauungen an keinem überragenden Kunstwerk nähren und
entwickeln konnte, der in einer Umwelt lebte und wirkte, die nicht gerade von
einer hochgespannten ästhetischen Luft und Innerlichkeit erfüllt war. Wo bleibt da
die Aussicht auf eine psychologische oder soziologische oder historische Erklärung
der Leistungen eines Genies? Mit der Empfindung, vor einem Geheimnis zu stehen,
liest man auch diese Erste Einleitung in die Ästhetik, die von Kant in den »sicheren
Gange der Wissenschaft gebracht worden ist.
Berlin. Arthur Liebert.
M. Grabmann, Des Ulrich Engelberti von Straßburg O. Pr. (t 1277)
Abhandlung De pulchro. Untersuchungen und Texte. Sitzungsber. der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philos.-philol. lt. histor. Kl. Jahrg.
1925, 5. Abhandlung. München 1926.
Die Abhandlung bringt in der Einleitung eine knapp gefaßte Ubersicht über
die wichtigste Literatur zur Ästhetik des Mittelalters. Ein näheres kritisches Ein-
gehen darauf versagt sich der Verfasser — leider, denn manche Schriften wie z. B.
Dvofäk oder Huizinga bedürfen noch einer kritischen geistesgeschichtlichen Er-
gänzung von berufener Seite. Der folgende Abschnitt nennt die maßgebenden mittel-
alterlichen Quellenschriften, die sich besonders mit ästhetischen Fragen befassen,
und ordnet sie in eine, durch einen stärkeren neuplatonischen Einschlag ge-
kennzeichnete, historische Linie, die von Hugo von St. Viktor über Dionysius Car-
tusianus bis zu Marsilio Ficino gezogen wird. Ausführlich dargestellt wird dabei
die Entwicklung und Lösung der philologischen Frage nach dem Verfasser des
ursprünglich Thomas von Aquino zugeschriebenen Opuscutum de bona et pulchro
Alberts des Großen.
In diese neuplatonische Reihe stellt der Verfasser auch den ästhetischen Traktat
des Ulrich von Straßburg, dessen Denken Albert der Große die Richtung gab und
es in die neuplatonischen Bahnen wies, die Ulrich dann weiter noch als sein Lehrer
verfolgte. Die eingehende quellengeschichtliche Analyse, mit der der Verfasser seine
Übersetzung des Traktats begleitet, zeigt die historischen Voraussetzungen auf und
gibt zugleich eine klare Gliederung des Gedankenganges. Vom Begriff der Schön-
heit, bestimmt durch die beiden Momente: consonantia und claritas, geht Ulrich
aus, untersucht dann sogleich die Anwendung dieser Bestimmungen auf Gott sowie
seine dreifache Kausalbeziehung zur geschaffenen Schönheit und erläutert das Ver-
hältnis vom Schönen zum Guten. Nach einer rein metaphysischen Gliederung des
geschaffenen Schönen in substantielles und akzidentelles, geistiges und körperliches,
in der die künstlerische Schönheit nirgends als etwas Selbständiges erscheint, folgen