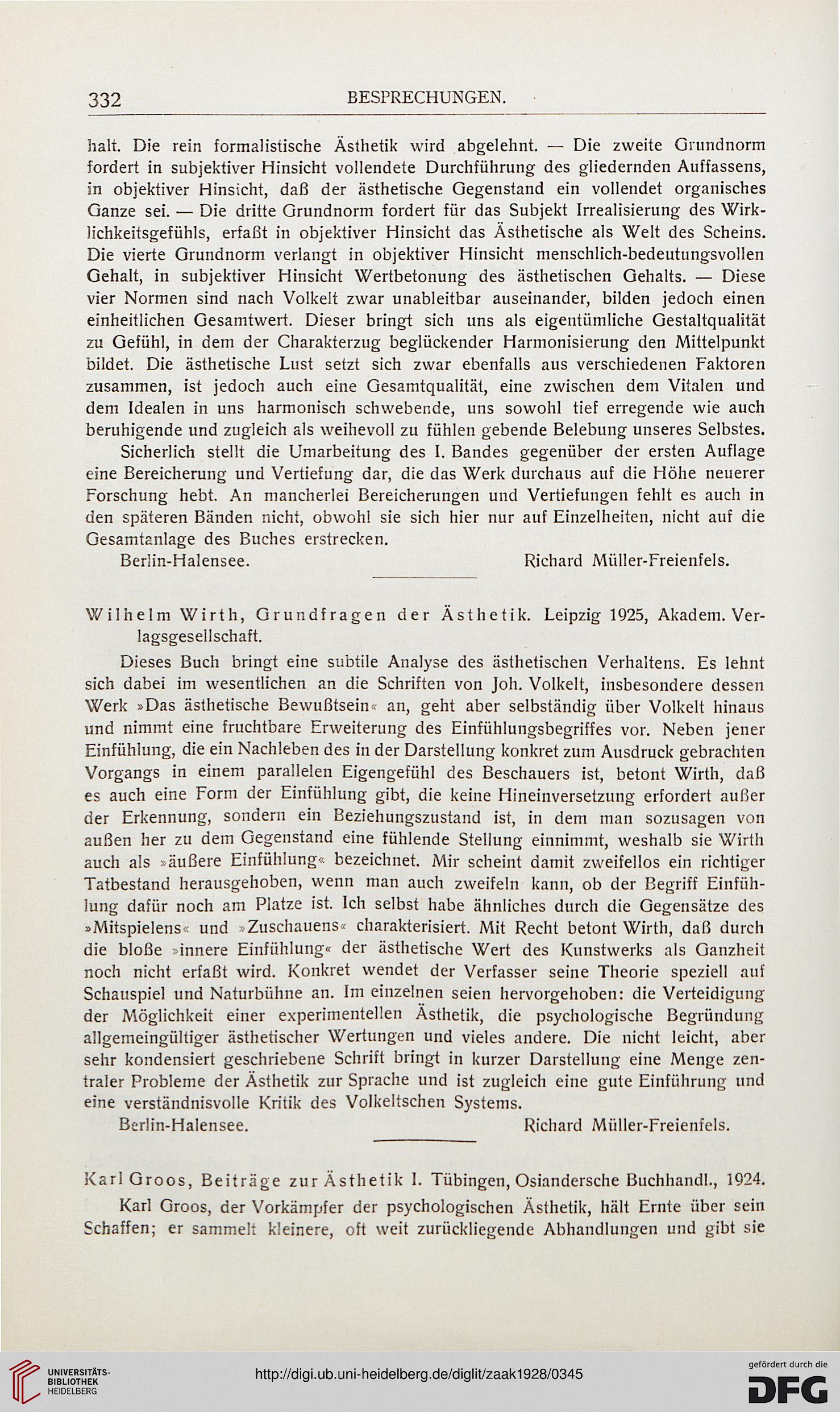332
BESPRECHUNGEN.
halt. Die rein formalistische Ästhetik wird abgelehnt. — Die zweite Grundnorm
fordert in subjektiver Hinsicht vollendete Durchführung des gliedernden Auffassens,
in objektiver Hinsicht, daß der ästhetische Gegenstand ein vollendet organisches
Ganze sei. — Die dritte Grundnorm fordert für das Subjekt Irrealisierung des Wirk-
lichkeitsgefühls, erfaßt in objektiver Hinsicht das Ästhetische als Welt des Scheins.
Die vierte Grundnorm verlangt in objektiver Hinsicht menschlich-bedeutungsvollen
Gehalt, in subjektiver Hinsicht Wertbetonung des ästhetischen Gehalts. — Diese
vier Normen sind nach Volkelt zwar unableitbar auseinander, bilden jedoch einen
einheitlichen Gesamtwert. Dieser bringt sich uns als eigentümliche Gestaltqualität
zu Gefühl, in dem der Charakterzug beglückender Harmonisierung den Mittelpunkt
bildet. Die ästhetische Lust setzt sich zwar ebenfalls aus verschiedenen Faktoren
zusammen, ist jedoch auch eine Gesamtqualität, eine zwischen dem Vitalen und
dem Idealen in uns harmonisch schwebende, uns sowohl tief erregende wie auch
beruhigende und zugleich als weihevoll zu fühlen gebende Belebung unseres Selbstes.
Sicherlich stellt die Umarbeitung des [. Bandes gegenüber der ersten Auflage
eine Bereicherung und Vertiefung dar, die das Werk durchaus auf die Höhe neuerer
Forschung hebt. An mancherlei Bereicherungen und Vertiefungen fehlt es auch in
den späteren Bänden nicht, obwohl sie sich hier nur auf Einzelheiten, nicht auf die
Gesamtanlage des Buches erstrecken.
Berün-Halensee. Richard Müller-Freienfels.
Wilhelm Wirth, Grundfragen der Ästhetik. Leipzig 1925, Akadem. Ver-
lagsgesellschaft.
Dieses Buch bringt eine subtile Analyse des ästhetischen Verhaltens. Es lehnt
sich dabei im wesentlichen an die Schriften von Joh. Volkelt, insbesondere dessen
Werk »Das ästhetische Bewußtsein« an, geht aber selbständig über Volkelt hinaus
und nimmt eine fruchtbare Erweiterung des Einfühlungsbegriffes vor. Neben jener
Einfühlung, die ein Nachleben des in der Darstellung konkret zum Ausdruck gebrachten
Vorgangs in einem parallelen Eigengefühl des Beschauers ist, betont Wirth, daß
es auch eine Form der Einfühlung gibt, die keine Hineinversetzung erfordert außer
der Erkennung, sondern ein Beziehungszustand ist, in dem man sozusagen von
außen her zu dem Gegenstand eine fühlende Stellung einnimmt, weshalb sie Wirth
auch als »äußere Einfühlung« bezeichnet. Mir scheint damit zweifellos ein richtiger
Tatbestand herausgehoben, wenn man auch zweifeln kann, ob der Begriff Einfüh-
lung dafür noch am Platze ist. Ich selbst habe ähnliches durch die Gegensätze des
»Mitspielens : und »Zuschauens. charakterisiert. Mit Recht betont Wirth, daß durch
die bloße »innere Einfühlung« der ästhetische Wert des Kunstwerks als Ganzheit
noch nicht erfaßt wird. Konkret wendet der Verfasser seine Theorie speziell auf
Schauspiel und Naturbühne an. Im einzelnen seien hervorgehoben: die Verteidigung
der Möglichkeit einer experimentellen Ästhetik, die psychologische Begründung
allgemeingültiger ästhetischer Wertungen und vieles andere. Die nicht leicht, aber
sehr kondensiert geschriebene Schrift bringt in kurzer Darstellung eine Menge zen-
traler Probleme der Ästhetik zur Sprache und ist zugleich eine gute Einführung und
eine verständnisvolle Kritik des Volkeltschen Systems.
Berlin-Halensee. Richard Müller-Freienfels.
Karl Groos, Beiträge zur Ästhetik [. Tübingen, Osiandersche Buchhandl., 1924.
Karl Groos, der Vorkämpfer der psychologischen Ästhetik, hält Ernte über sein
Schaffen; er sammelt kleinere, oft weit zurückliegende Abhandlungen und gibt sie
BESPRECHUNGEN.
halt. Die rein formalistische Ästhetik wird abgelehnt. — Die zweite Grundnorm
fordert in subjektiver Hinsicht vollendete Durchführung des gliedernden Auffassens,
in objektiver Hinsicht, daß der ästhetische Gegenstand ein vollendet organisches
Ganze sei. — Die dritte Grundnorm fordert für das Subjekt Irrealisierung des Wirk-
lichkeitsgefühls, erfaßt in objektiver Hinsicht das Ästhetische als Welt des Scheins.
Die vierte Grundnorm verlangt in objektiver Hinsicht menschlich-bedeutungsvollen
Gehalt, in subjektiver Hinsicht Wertbetonung des ästhetischen Gehalts. — Diese
vier Normen sind nach Volkelt zwar unableitbar auseinander, bilden jedoch einen
einheitlichen Gesamtwert. Dieser bringt sich uns als eigentümliche Gestaltqualität
zu Gefühl, in dem der Charakterzug beglückender Harmonisierung den Mittelpunkt
bildet. Die ästhetische Lust setzt sich zwar ebenfalls aus verschiedenen Faktoren
zusammen, ist jedoch auch eine Gesamtqualität, eine zwischen dem Vitalen und
dem Idealen in uns harmonisch schwebende, uns sowohl tief erregende wie auch
beruhigende und zugleich als weihevoll zu fühlen gebende Belebung unseres Selbstes.
Sicherlich stellt die Umarbeitung des [. Bandes gegenüber der ersten Auflage
eine Bereicherung und Vertiefung dar, die das Werk durchaus auf die Höhe neuerer
Forschung hebt. An mancherlei Bereicherungen und Vertiefungen fehlt es auch in
den späteren Bänden nicht, obwohl sie sich hier nur auf Einzelheiten, nicht auf die
Gesamtanlage des Buches erstrecken.
Berün-Halensee. Richard Müller-Freienfels.
Wilhelm Wirth, Grundfragen der Ästhetik. Leipzig 1925, Akadem. Ver-
lagsgesellschaft.
Dieses Buch bringt eine subtile Analyse des ästhetischen Verhaltens. Es lehnt
sich dabei im wesentlichen an die Schriften von Joh. Volkelt, insbesondere dessen
Werk »Das ästhetische Bewußtsein« an, geht aber selbständig über Volkelt hinaus
und nimmt eine fruchtbare Erweiterung des Einfühlungsbegriffes vor. Neben jener
Einfühlung, die ein Nachleben des in der Darstellung konkret zum Ausdruck gebrachten
Vorgangs in einem parallelen Eigengefühl des Beschauers ist, betont Wirth, daß
es auch eine Form der Einfühlung gibt, die keine Hineinversetzung erfordert außer
der Erkennung, sondern ein Beziehungszustand ist, in dem man sozusagen von
außen her zu dem Gegenstand eine fühlende Stellung einnimmt, weshalb sie Wirth
auch als »äußere Einfühlung« bezeichnet. Mir scheint damit zweifellos ein richtiger
Tatbestand herausgehoben, wenn man auch zweifeln kann, ob der Begriff Einfüh-
lung dafür noch am Platze ist. Ich selbst habe ähnliches durch die Gegensätze des
»Mitspielens : und »Zuschauens. charakterisiert. Mit Recht betont Wirth, daß durch
die bloße »innere Einfühlung« der ästhetische Wert des Kunstwerks als Ganzheit
noch nicht erfaßt wird. Konkret wendet der Verfasser seine Theorie speziell auf
Schauspiel und Naturbühne an. Im einzelnen seien hervorgehoben: die Verteidigung
der Möglichkeit einer experimentellen Ästhetik, die psychologische Begründung
allgemeingültiger ästhetischer Wertungen und vieles andere. Die nicht leicht, aber
sehr kondensiert geschriebene Schrift bringt in kurzer Darstellung eine Menge zen-
traler Probleme der Ästhetik zur Sprache und ist zugleich eine gute Einführung und
eine verständnisvolle Kritik des Volkeltschen Systems.
Berlin-Halensee. Richard Müller-Freienfels.
Karl Groos, Beiträge zur Ästhetik [. Tübingen, Osiandersche Buchhandl., 1924.
Karl Groos, der Vorkämpfer der psychologischen Ästhetik, hält Ernte über sein
Schaffen; er sammelt kleinere, oft weit zurückliegende Abhandlungen und gibt sie