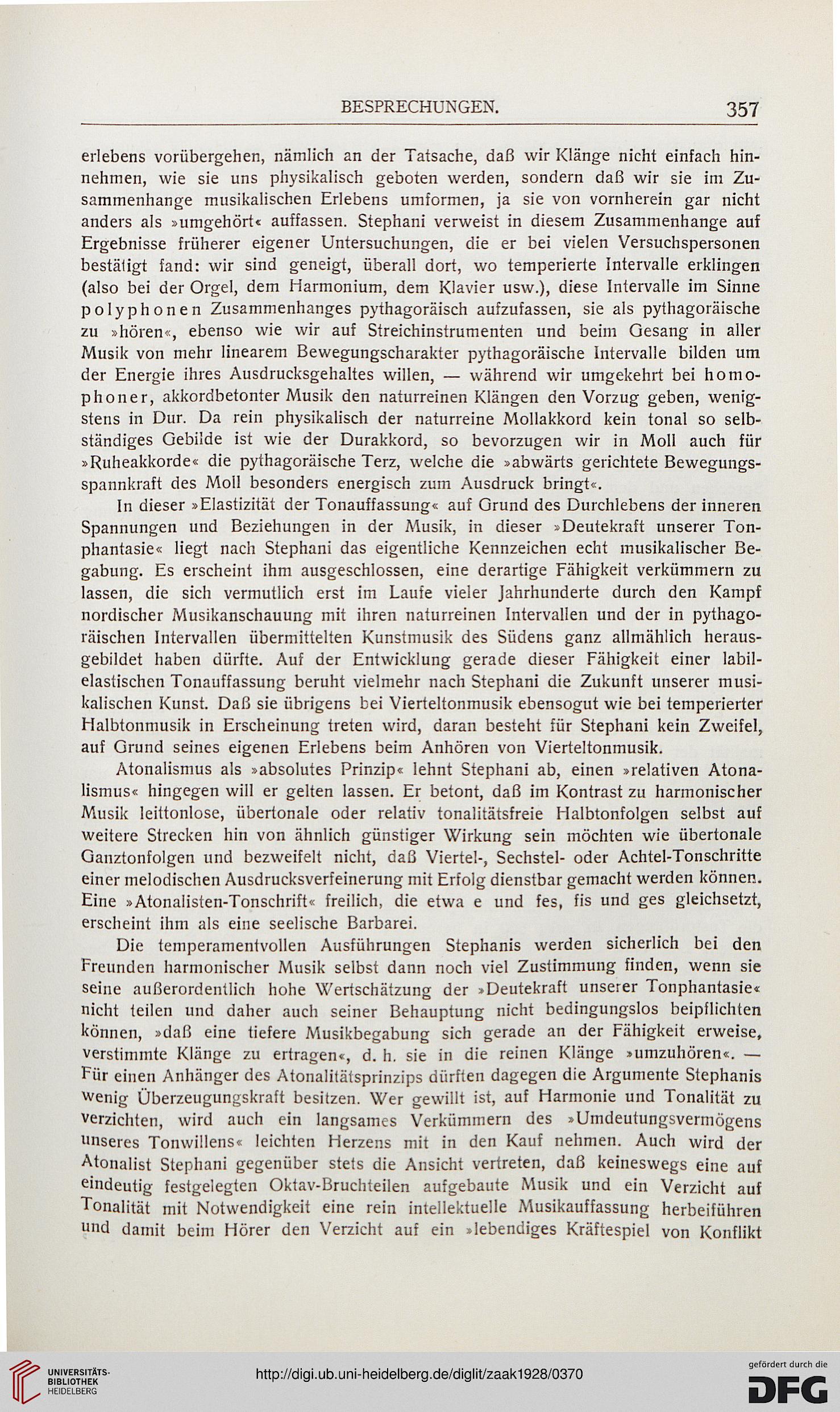BESPRECHUNGEN.
357
erlebens vorübergehen, nämlich an der Tatsache, daß wir Klänge nicht einfach hin-
nehmen, wie sie uns physikalisch geboten werden, sondern daß wir sie im Zu-
sammenhange musikalischen Erlebens umformen, ja sie von vornherein gar nicht
anders als »umgehört« auffassen. Stephani verweist in diesem Zusammenhange auf
Ergebnisse früherer eigener Untersuchungen, die er bei vielen Versuchspersonen
bestätigt fand: wir sind geneigt, überall dort, wo temperierte Intervalle erklingen
(also bei der Orgel, dem Harmonium, dem Klavier usw.), diese Intervalle im Sinne
polyphonen Zusammenhanges pythagoräisch aufzufassen, sie als pythagoräische
zu »hören«, ebenso wie wir auf Streichinstrumenten und beim Gesang in aller
Musik von mehr linearem Bewegungscharakter pythagoräische Intervalle bilden um
der Energie ihres Ausdrucksgehaltes willen, — während wir umgekehrt bei homo-
phoner, akkordbetonter Musik den naturreinen Klängen den Vorzug geben, wenig-
stens in Dur. Da rein physikalisch der naturreine Mollakkord kein tonal so selb-
ständiges Gebilde ist wie der Durakkord, so bevorzugen wir in Moll auch für
»Ruheakkorde« die pythagoräische Terz, welche die »abwärts gerichtete Bewegungs-
spannkraft des Moll besonders energisch zum Ausdruck bringt«.
In dieser »Elastizität der Tonauffassung« auf Grund des Durchlebens der inneren
Spannungen und Beziehungen in der Musik, in dieser »Deutekraft unserer Ton-
phantasie« liegt nach Stephani das eigentliche Kennzeichen echt musikalischer Be-
gabung. Es erscheint ihm ausgeschlossen, eine derartige Fähigkeit verkümmern zu
lassen, die sich vermutlich erst im Laufe vieler Jahrhunderte durch den Kampf
nordischer Musikanschauung mit ihren naturreinen Intervallen und der in pythago-
räischen Intervallen übermittelten Kunstmusik des Südens ganz allmählich heraus-
gebildet haben dürfte. Auf der Entwicklung gerade dieser Fälligkeit einer labil-
elastischen Tonauffassung beruht vielmehr nach Stephani die Zukunft unserer musi-
kalischen Kunst. Daß sie übrigens bei Vierteltonmusik ebensogut wie bei temperierter
Halbtonmusik in Erscheinung treten wird, daran besteht für Stephani kein Zweifel,
auf Grund seines eigenen Erlebens beim Anhören von Vierteltonmusik.
Atonalismus als »absolutes Prinzip« lehnt Stephani ab, einen »relativen Atona-
lismus« hingegen will er gelten lassen. Er betont, daß im Kontrast zu harmonischer
Musik leittonlose, übertonale oder relativ tonalitätsfreie Halbtonfolgen selbst auf
weitere Strecken hin von ähnlich günstiger Wirkung sein möchten wie übertonale
Ganztonfolgen und bezweifelt nicht, daß Viertel-, Sechstel- oder Achtel-Tonschritte
einer melodischen Ausdrucksverfeinerung mit Erfolg dienstbar gemacht werden können.
Eine »Atonalisten-Tonschrift« freilich, die etwa e und fes, fis und ges gleichsetzt,
erscheint ihm als eine seelische Barbarei.
Die temperamentvollen Ausführungen Stephanis werden sicherlich bei den
Freunden harmonischer Musik selbst dann noch viel Zustimmung finden, wenn sie
seine außerordentlich hohe Wertschätzung der »Deutekraft unserer Tonphantasie«
nicht teilen und daher auch seiner Behauptung nicht bedingungslos beipflichten
können, »daß eine tiefere Musikbegabung sich gerade an der Fähigkeit erweise,
verstimmte Klänge zu ertragen«, d. h. sie in die reinen Klänge »umzuhören«. —
Für einen Anhänger des Atonalitätsprinzips dürften dagegen die Argumente Stephanis
Wenig Überzeugungskraft besitzen. Wer gewillt ist, auf Harmonie und Tonalität zu
verzichten, wird auch ein langsames Verkümmern des »Umdeutungsvermögens
unseres Tonwillens« leichten Herzens mit in den Kauf nehmen. Auch wird der
Atonalist Stephani gegenüber stets die Ansicht vertreten, daß keineswegs eine auf
eindeutig festgelegten Oktav-Bruchteilen aufgebaute Musik und ein Verzicht auf
Tonalität mit Notwendigkeit eine rein intellektuelle Musikauffassung herbeiführen
und damit beim Hörer den Verzicht auf ein »lebendiges Kräftespiel von Konflikt
357
erlebens vorübergehen, nämlich an der Tatsache, daß wir Klänge nicht einfach hin-
nehmen, wie sie uns physikalisch geboten werden, sondern daß wir sie im Zu-
sammenhange musikalischen Erlebens umformen, ja sie von vornherein gar nicht
anders als »umgehört« auffassen. Stephani verweist in diesem Zusammenhange auf
Ergebnisse früherer eigener Untersuchungen, die er bei vielen Versuchspersonen
bestätigt fand: wir sind geneigt, überall dort, wo temperierte Intervalle erklingen
(also bei der Orgel, dem Harmonium, dem Klavier usw.), diese Intervalle im Sinne
polyphonen Zusammenhanges pythagoräisch aufzufassen, sie als pythagoräische
zu »hören«, ebenso wie wir auf Streichinstrumenten und beim Gesang in aller
Musik von mehr linearem Bewegungscharakter pythagoräische Intervalle bilden um
der Energie ihres Ausdrucksgehaltes willen, — während wir umgekehrt bei homo-
phoner, akkordbetonter Musik den naturreinen Klängen den Vorzug geben, wenig-
stens in Dur. Da rein physikalisch der naturreine Mollakkord kein tonal so selb-
ständiges Gebilde ist wie der Durakkord, so bevorzugen wir in Moll auch für
»Ruheakkorde« die pythagoräische Terz, welche die »abwärts gerichtete Bewegungs-
spannkraft des Moll besonders energisch zum Ausdruck bringt«.
In dieser »Elastizität der Tonauffassung« auf Grund des Durchlebens der inneren
Spannungen und Beziehungen in der Musik, in dieser »Deutekraft unserer Ton-
phantasie« liegt nach Stephani das eigentliche Kennzeichen echt musikalischer Be-
gabung. Es erscheint ihm ausgeschlossen, eine derartige Fähigkeit verkümmern zu
lassen, die sich vermutlich erst im Laufe vieler Jahrhunderte durch den Kampf
nordischer Musikanschauung mit ihren naturreinen Intervallen und der in pythago-
räischen Intervallen übermittelten Kunstmusik des Südens ganz allmählich heraus-
gebildet haben dürfte. Auf der Entwicklung gerade dieser Fälligkeit einer labil-
elastischen Tonauffassung beruht vielmehr nach Stephani die Zukunft unserer musi-
kalischen Kunst. Daß sie übrigens bei Vierteltonmusik ebensogut wie bei temperierter
Halbtonmusik in Erscheinung treten wird, daran besteht für Stephani kein Zweifel,
auf Grund seines eigenen Erlebens beim Anhören von Vierteltonmusik.
Atonalismus als »absolutes Prinzip« lehnt Stephani ab, einen »relativen Atona-
lismus« hingegen will er gelten lassen. Er betont, daß im Kontrast zu harmonischer
Musik leittonlose, übertonale oder relativ tonalitätsfreie Halbtonfolgen selbst auf
weitere Strecken hin von ähnlich günstiger Wirkung sein möchten wie übertonale
Ganztonfolgen und bezweifelt nicht, daß Viertel-, Sechstel- oder Achtel-Tonschritte
einer melodischen Ausdrucksverfeinerung mit Erfolg dienstbar gemacht werden können.
Eine »Atonalisten-Tonschrift« freilich, die etwa e und fes, fis und ges gleichsetzt,
erscheint ihm als eine seelische Barbarei.
Die temperamentvollen Ausführungen Stephanis werden sicherlich bei den
Freunden harmonischer Musik selbst dann noch viel Zustimmung finden, wenn sie
seine außerordentlich hohe Wertschätzung der »Deutekraft unserer Tonphantasie«
nicht teilen und daher auch seiner Behauptung nicht bedingungslos beipflichten
können, »daß eine tiefere Musikbegabung sich gerade an der Fähigkeit erweise,
verstimmte Klänge zu ertragen«, d. h. sie in die reinen Klänge »umzuhören«. —
Für einen Anhänger des Atonalitätsprinzips dürften dagegen die Argumente Stephanis
Wenig Überzeugungskraft besitzen. Wer gewillt ist, auf Harmonie und Tonalität zu
verzichten, wird auch ein langsames Verkümmern des »Umdeutungsvermögens
unseres Tonwillens« leichten Herzens mit in den Kauf nehmen. Auch wird der
Atonalist Stephani gegenüber stets die Ansicht vertreten, daß keineswegs eine auf
eindeutig festgelegten Oktav-Bruchteilen aufgebaute Musik und ein Verzicht auf
Tonalität mit Notwendigkeit eine rein intellektuelle Musikauffassung herbeiführen
und damit beim Hörer den Verzicht auf ein »lebendiges Kräftespiel von Konflikt