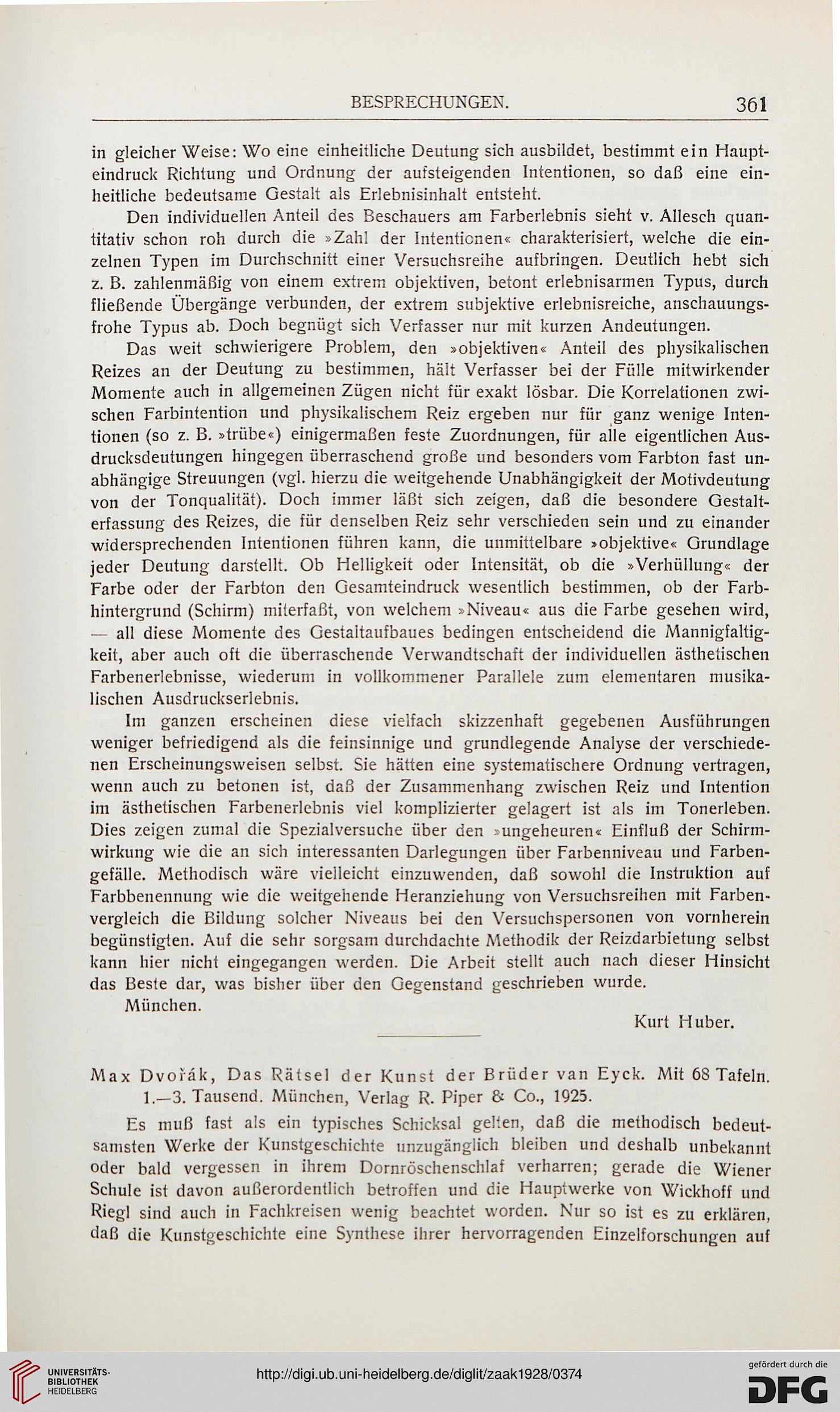BESPRECHUNGEN.
361
in gleicherweise: Wo eine einheitliche Deutung sich ausbildet, bestimmt ein Haupt-
eindruck Richtung und Ordnung der aufsteigenden Intentionen, so daß eine ein-
heitliche bedeutsame Gestalt als Erlebnisinhalt entsteht.
Den individuellen Anteil des Beschauers am Farberlebnis sieht v. Allesch quan-
titativ schon roh durch die »Zahl der Intentionen« charakterisiert, welche die ein-
zelnen Typen im Durchschnitt einer Versuchsreihe aufbringen. Deutlich hebt sich
z. B. zahlenmäßig von einem extrem objektiven, betont erlebnisarmen Typus, durch
fließende Übergänge verbunden, der extrem subjektive erlebnisreiche, anschauungs-
frohe Typus ab. Doch begnügt sich Verfasser nur mit kurzen Andeutungen.
Das weit schwierigere Problem, den »objektiven« Anteil des physikalischen
Reizes an der Deutung zu bestimmen, hält Verfasser bei der Fülle mitwirkender
Momente auch in allgemeinen Zügen nicht für exakt lösbar. Die Korrelationen zwi-
schen Farbintention und physikalischem Reiz ergeben nur für ganz wenige Inten-
tionen (so z. B. »trübe«) einigermaßen feste Zuordnungen, für alle eigentlichen Aus-
drucksdeutungen hingegen überraschend große und besonders vom Farbton fast un-
abhängige Streuungen (vgl. hierzu die weitgehende Unabhängigkeit der Motivdeutung
von der Tonqualität). Doch immer läßt sich zeigen, daß die besondere Gestalt-
erfassung des Reizes, die für denselben Reiz sehr verschieden sein und zu einander
widersprechenden Intentionen führen kann, die unmittelbare »objektive« Grundlage
jeder Deutung darstellt. Ob Helligkeit oder Intensität, ob die »Verhüllung« der
Farbe oder der Farbton den Gesamteindruck wesentlich bestimmen, ob der Farb-
hintergrund (Schirm) miterfaßt, von welchem »Niveau« aus die Farbe gesehen wird,
— all diese Momente des Gestaltaufbaues bedingen entscheidend die Mannigfaltig-
keit, aber auch oft die überraschende Verwandtschaft der individuellen ästhetischen
Farbenerlebnisse, wiederum in vollkommener Parallele zum elementaren musika-
lischen Ausdruckserlebnis.
Im ganzen erscheinen diese vielfach skizzenhaft gegebenen Ausführungen
weniger befriedigend als die feinsinnige und grundlegende Analyse der verschiede-
nen Erscheinungsweisen selbst. Sie hätten eine systematischere Ordnung vertragen,
wenn auch zu betonen ist, daß der Zusammenhang zwischen Reiz und Intention
im ästhetischen Farbenerlebnis viel komplizierter gelagert ist als im Tonerleben.
Dies zeigen zumal die Spezialversuche über den = ungeheuren« Einfluß der Schirm-
wirkung wie die an sich interessanten Darlegungen über Farbenniveau und Farben-
gefälle. Methodisch wäre vielleicht einzuwenden, daß sowohl die Instruktion auf
Farbbenennung wie die weitgehende Heranziehung von Versuchsreihen mit Farben-
vergleich die Bildung solcher Niveaus bei den Versuchspersonen von vornherein
begünstigten. Auf die sehr sorgsam durchdachte Methodik der Reizdarbietung selbst
kann hier nicht eingegangen werden. Die Arbeit stellt auch nach dieser Hinsicht
das Beste dar, was bisher über den Gegenstand geschrieben wurde.
München.
Kurt Huber.
Max Dvoiäk, Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck. Mit 68 Tafeln.
1—3. Tausend. München, Verlag R. Piper & Co., 1925.
Es muß fast als ein typisches Schicksal gelten, daß die methodisch bedeut-
samsten Werke der Kunstgeschichte unzugänglich bleiben und deshalb unbekannt
oder bald vergessen in ihrem Dornröschenschlaf verharren; gerade die Wiener
Schule ist davon außerordentlich betroffen und die Hauptwerke von Wickhoff und
Riegl sind auch in Fachkreisen wenig beachtet worden. Nur so ist es zu erklären,
daß die Kunstgeschichte eine Synthese ihrer hervorragenden Einzelforschungen auf
361
in gleicherweise: Wo eine einheitliche Deutung sich ausbildet, bestimmt ein Haupt-
eindruck Richtung und Ordnung der aufsteigenden Intentionen, so daß eine ein-
heitliche bedeutsame Gestalt als Erlebnisinhalt entsteht.
Den individuellen Anteil des Beschauers am Farberlebnis sieht v. Allesch quan-
titativ schon roh durch die »Zahl der Intentionen« charakterisiert, welche die ein-
zelnen Typen im Durchschnitt einer Versuchsreihe aufbringen. Deutlich hebt sich
z. B. zahlenmäßig von einem extrem objektiven, betont erlebnisarmen Typus, durch
fließende Übergänge verbunden, der extrem subjektive erlebnisreiche, anschauungs-
frohe Typus ab. Doch begnügt sich Verfasser nur mit kurzen Andeutungen.
Das weit schwierigere Problem, den »objektiven« Anteil des physikalischen
Reizes an der Deutung zu bestimmen, hält Verfasser bei der Fülle mitwirkender
Momente auch in allgemeinen Zügen nicht für exakt lösbar. Die Korrelationen zwi-
schen Farbintention und physikalischem Reiz ergeben nur für ganz wenige Inten-
tionen (so z. B. »trübe«) einigermaßen feste Zuordnungen, für alle eigentlichen Aus-
drucksdeutungen hingegen überraschend große und besonders vom Farbton fast un-
abhängige Streuungen (vgl. hierzu die weitgehende Unabhängigkeit der Motivdeutung
von der Tonqualität). Doch immer läßt sich zeigen, daß die besondere Gestalt-
erfassung des Reizes, die für denselben Reiz sehr verschieden sein und zu einander
widersprechenden Intentionen führen kann, die unmittelbare »objektive« Grundlage
jeder Deutung darstellt. Ob Helligkeit oder Intensität, ob die »Verhüllung« der
Farbe oder der Farbton den Gesamteindruck wesentlich bestimmen, ob der Farb-
hintergrund (Schirm) miterfaßt, von welchem »Niveau« aus die Farbe gesehen wird,
— all diese Momente des Gestaltaufbaues bedingen entscheidend die Mannigfaltig-
keit, aber auch oft die überraschende Verwandtschaft der individuellen ästhetischen
Farbenerlebnisse, wiederum in vollkommener Parallele zum elementaren musika-
lischen Ausdruckserlebnis.
Im ganzen erscheinen diese vielfach skizzenhaft gegebenen Ausführungen
weniger befriedigend als die feinsinnige und grundlegende Analyse der verschiede-
nen Erscheinungsweisen selbst. Sie hätten eine systematischere Ordnung vertragen,
wenn auch zu betonen ist, daß der Zusammenhang zwischen Reiz und Intention
im ästhetischen Farbenerlebnis viel komplizierter gelagert ist als im Tonerleben.
Dies zeigen zumal die Spezialversuche über den = ungeheuren« Einfluß der Schirm-
wirkung wie die an sich interessanten Darlegungen über Farbenniveau und Farben-
gefälle. Methodisch wäre vielleicht einzuwenden, daß sowohl die Instruktion auf
Farbbenennung wie die weitgehende Heranziehung von Versuchsreihen mit Farben-
vergleich die Bildung solcher Niveaus bei den Versuchspersonen von vornherein
begünstigten. Auf die sehr sorgsam durchdachte Methodik der Reizdarbietung selbst
kann hier nicht eingegangen werden. Die Arbeit stellt auch nach dieser Hinsicht
das Beste dar, was bisher über den Gegenstand geschrieben wurde.
München.
Kurt Huber.
Max Dvoiäk, Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck. Mit 68 Tafeln.
1—3. Tausend. München, Verlag R. Piper & Co., 1925.
Es muß fast als ein typisches Schicksal gelten, daß die methodisch bedeut-
samsten Werke der Kunstgeschichte unzugänglich bleiben und deshalb unbekannt
oder bald vergessen in ihrem Dornröschenschlaf verharren; gerade die Wiener
Schule ist davon außerordentlich betroffen und die Hauptwerke von Wickhoff und
Riegl sind auch in Fachkreisen wenig beachtet worden. Nur so ist es zu erklären,
daß die Kunstgeschichte eine Synthese ihrer hervorragenden Einzelforschungen auf