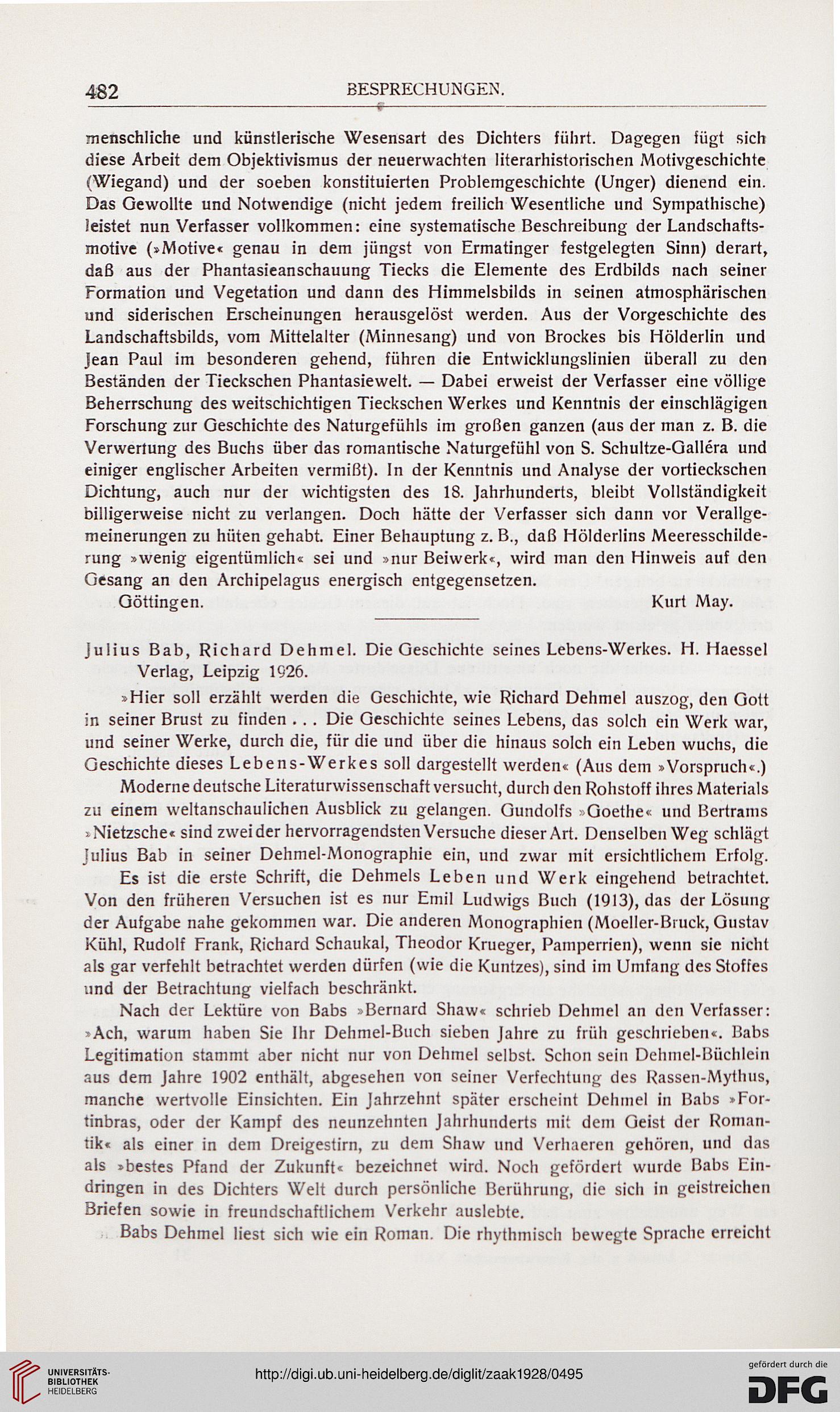482
BESPRECHUNGEN.
menschliche und künstlerische Wesensart des Dichters führt. Dagegen fügt sich
diese Arbeit dem Objektivismus der neuerwachten literarhistorischen Motivgeschichte
(Wiegand) und der soeben konstituierten Problemgeschichte (Unger) dienend ein.
Das Gewollte und Notwendige (nicht jedem freilich Wesentliche und Sympathische)
leistet nun Verfasser vollkommen: eine systematische Beschreibung der Landschafts-
motive (»Motive« genau in dem jüngst von Ermatinger festgelegten Sinn) derart,
daß aus der Phantasieanschauung Tiecks die Elemente des Erdbilds nach seiner
Formation und Vegetation und dann des Himmelsbilds in seinen atmosphärischen
und siderischen Erscheinungen herausgelöst werden. Aus der Vorgeschichte des
Landschaftsbilds, vom Mittelalter (Minnesang) und von Brockes bis Hölderlin und
jean Paul im besonderen gehend, führen die Entwicklungslinien überall zu den
Beständen der Tieckschen Phantasiewelt. — Dabei erweist der Verfasser eine völlige
Beherrschung des weitschichtigen Tieckschen Werkes und Kenntnis der einschlägigen
Forschung zur Geschichte des Naturgefühls im großen ganzen (aus der man z. B. die
Verwertung des Buchs über das romantische Naturgefühl von S. Schultze-Gallera und
einiger englischer Arbeiten vermißt). In der Kenntnis und Analyse der vortieckschen
Dichtung, auch nur der wichtigsten des 18. Jahrhunderts, bleibt Vollständigkeit
billigerweise nicht zu verlangen. Doch hätte der Verfasser sich dann vor Verallge-
meinerungen zu hüten gehabt. Einer Behauptung z. B., daß Hölderlins Meeresschilde-
rung »wenig eigentümlich« sei und »nur Beiwerk«, wird man den Hinweis auf den
Gesang an den Archipelagus energisch entgegensetzen.
Göttingen. Kurt May.
Julius Bab, Richard Dehmel. Die Geschichte seines Lebens-Werkes. H. Haessel
Verlag, Leipzig 1926.
»Hier soll erzählt werden die Geschichte, wie Richard Dehmel auszog, den Gott
in seiner Brust zu finden .. . Die Geschichte seines Lebens, das solch ein Werk war,
und seiner Werke, durch die, für die und über die hinaus solch ein Leben wuchs, die
Geschichte dieses Lebens-Werkes soll dargestellt werden« (Aus dem »Vorspruch«.)
Moderne deutsche Literaturwissenschaft versucht, durch den Rohstoff ihres Materials
zu einem weltanschaulichen Ausblick zu gelangen. Gundolfs Goethe« und Bertrams
i Nietzsche« sind zwei der hervorragendsten Versuche dieser Art. Denselben Weg schlägt
Julius Bab in seiner Dehmel-Monographie ein, und zwar mit ersichtlichem Erfolg.
Es ist die erste Schrift, die Dehmels Leben und Werk eingehend betrachtet.
Von den früheren Versuchen ist es nur Emil Ludwigs Buch (1913), das der Lösung
der Aufgabe nahe gekommen war. Die anderen Monographien (Moeller-Bruck, Gustav
Kühl, Rudolf Frank, Richard Schaukai, Theodor Krueger, Pamperrien), wenn sie nicht
als gar verfehlt betrachtet werden dürfen (wie die Kuntzes), sind im Umfang des Stoffes
und der Betrachtung vielfach beschränkt.
Nach der Lektüre von Babs »Bernard Shaw« schrieb Dehmel an den Verfasser:
»Ach, warum haben Sie Ihr Dehmel-Buch sieben Jahre zu früh geschrieben«. Babs
Legitimation stammt aber nicht nur von Dehmel selbst. Schon sein Dehiuel-Büchlein
aus dem Jahre 1902 enthält, abgesehen von seiner Verfechtung des Rassen-Mythus,
manche wertvolle Einsichten. Ein Jahrzehnt später erscheint Dehmel in Babs »For-
tinbras, oder der Kampf des neunzehnten Jahrhunderts mit dem Geist der Roman-
tik« als einer in dem Dreigestirn, zu dem Shaw und Verhaeren gehören, und das
als »bestes Pfand der Zukunft« bezeichnet wird. Noch gefördert wurde Babs Ein-
dringen in des Dichters Welt durch persönliche Berührung, die sich in geistreichen
Briefen sowie in freundschaftlichem Verkehr auslebte.
Babs Dehmel liest sich wie ein Roman. Die rhythmisch bewegte Sprache erreicht
BESPRECHUNGEN.
menschliche und künstlerische Wesensart des Dichters führt. Dagegen fügt sich
diese Arbeit dem Objektivismus der neuerwachten literarhistorischen Motivgeschichte
(Wiegand) und der soeben konstituierten Problemgeschichte (Unger) dienend ein.
Das Gewollte und Notwendige (nicht jedem freilich Wesentliche und Sympathische)
leistet nun Verfasser vollkommen: eine systematische Beschreibung der Landschafts-
motive (»Motive« genau in dem jüngst von Ermatinger festgelegten Sinn) derart,
daß aus der Phantasieanschauung Tiecks die Elemente des Erdbilds nach seiner
Formation und Vegetation und dann des Himmelsbilds in seinen atmosphärischen
und siderischen Erscheinungen herausgelöst werden. Aus der Vorgeschichte des
Landschaftsbilds, vom Mittelalter (Minnesang) und von Brockes bis Hölderlin und
jean Paul im besonderen gehend, führen die Entwicklungslinien überall zu den
Beständen der Tieckschen Phantasiewelt. — Dabei erweist der Verfasser eine völlige
Beherrschung des weitschichtigen Tieckschen Werkes und Kenntnis der einschlägigen
Forschung zur Geschichte des Naturgefühls im großen ganzen (aus der man z. B. die
Verwertung des Buchs über das romantische Naturgefühl von S. Schultze-Gallera und
einiger englischer Arbeiten vermißt). In der Kenntnis und Analyse der vortieckschen
Dichtung, auch nur der wichtigsten des 18. Jahrhunderts, bleibt Vollständigkeit
billigerweise nicht zu verlangen. Doch hätte der Verfasser sich dann vor Verallge-
meinerungen zu hüten gehabt. Einer Behauptung z. B., daß Hölderlins Meeresschilde-
rung »wenig eigentümlich« sei und »nur Beiwerk«, wird man den Hinweis auf den
Gesang an den Archipelagus energisch entgegensetzen.
Göttingen. Kurt May.
Julius Bab, Richard Dehmel. Die Geschichte seines Lebens-Werkes. H. Haessel
Verlag, Leipzig 1926.
»Hier soll erzählt werden die Geschichte, wie Richard Dehmel auszog, den Gott
in seiner Brust zu finden .. . Die Geschichte seines Lebens, das solch ein Werk war,
und seiner Werke, durch die, für die und über die hinaus solch ein Leben wuchs, die
Geschichte dieses Lebens-Werkes soll dargestellt werden« (Aus dem »Vorspruch«.)
Moderne deutsche Literaturwissenschaft versucht, durch den Rohstoff ihres Materials
zu einem weltanschaulichen Ausblick zu gelangen. Gundolfs Goethe« und Bertrams
i Nietzsche« sind zwei der hervorragendsten Versuche dieser Art. Denselben Weg schlägt
Julius Bab in seiner Dehmel-Monographie ein, und zwar mit ersichtlichem Erfolg.
Es ist die erste Schrift, die Dehmels Leben und Werk eingehend betrachtet.
Von den früheren Versuchen ist es nur Emil Ludwigs Buch (1913), das der Lösung
der Aufgabe nahe gekommen war. Die anderen Monographien (Moeller-Bruck, Gustav
Kühl, Rudolf Frank, Richard Schaukai, Theodor Krueger, Pamperrien), wenn sie nicht
als gar verfehlt betrachtet werden dürfen (wie die Kuntzes), sind im Umfang des Stoffes
und der Betrachtung vielfach beschränkt.
Nach der Lektüre von Babs »Bernard Shaw« schrieb Dehmel an den Verfasser:
»Ach, warum haben Sie Ihr Dehmel-Buch sieben Jahre zu früh geschrieben«. Babs
Legitimation stammt aber nicht nur von Dehmel selbst. Schon sein Dehiuel-Büchlein
aus dem Jahre 1902 enthält, abgesehen von seiner Verfechtung des Rassen-Mythus,
manche wertvolle Einsichten. Ein Jahrzehnt später erscheint Dehmel in Babs »For-
tinbras, oder der Kampf des neunzehnten Jahrhunderts mit dem Geist der Roman-
tik« als einer in dem Dreigestirn, zu dem Shaw und Verhaeren gehören, und das
als »bestes Pfand der Zukunft« bezeichnet wird. Noch gefördert wurde Babs Ein-
dringen in des Dichters Welt durch persönliche Berührung, die sich in geistreichen
Briefen sowie in freundschaftlichem Verkehr auslebte.
Babs Dehmel liest sich wie ein Roman. Die rhythmisch bewegte Sprache erreicht