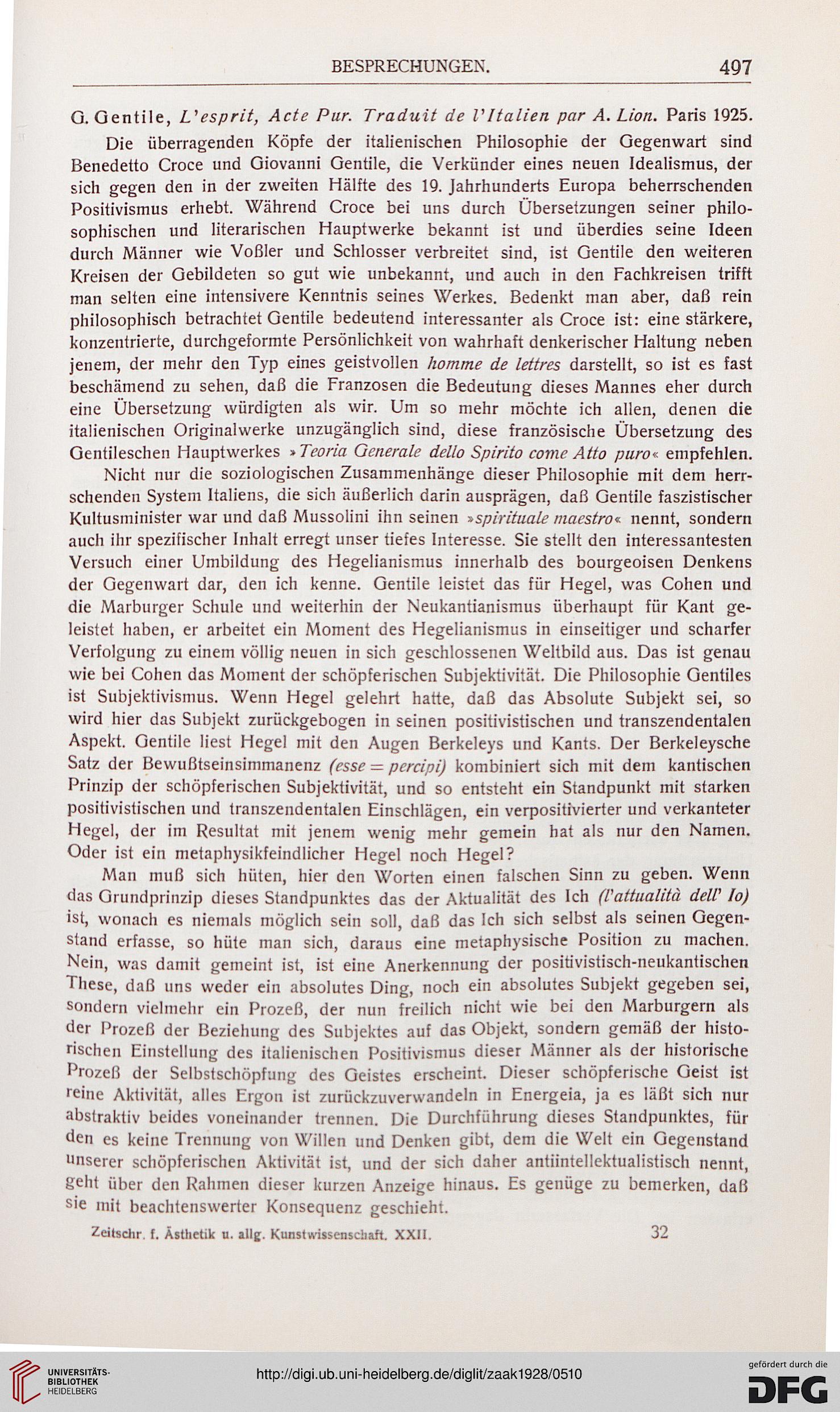BESPRECHUNGEN.
497
G. Gentile, Vesprit, Acte Pur. Traduit de VItalien par A. Lion. Paris 1925.
Die überragenden Köpfe der italienischen Philosophie der Gegenwart sind
Benedetto Croce und Giovanni Gentile, die Verkünder eines neuen Idealismus, der
sich gegen den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Europa beherrschenden
Positivismus erhebt. Während Croce bei uns durch Übersetzungen seiner philo-
sophischen und literarischen Hauptwerke bekannt ist und überdies seine Ideen
durch Männer wie Voßler und Schlosser verbreitet sind, ist Gentile den weiteren
Kreisen der Gebildeten so gut wie unbekannt, und auch in den Fachkreisen trifft
man selten eine intensivere Kenntnis seines Werkes. Bedenkt man aber, daß rein
philosophisch betrachtet Gentile bedeutend interessanter als Croce ist: eine stärkere,
konzentrierte, durchgeformte Persönlichkeit von wahrhaft denkerischer Haltung neben
jenem, der mehr den Typ eines geistvollen komme de lettres darstellt, so ist es fast
beschämend zu sehen, daß die Franzosen die Bedeutung dieses Mannes eher durch
eine Übersetzung würdigten als wir. Um so mehr möchte ich allen, denen die
italienischen Originalwerke unzugänglich sind, diese französische Übersetzung des
Gentileschen Hauptwerkes *Teoria Generale dello Spirito comc Atto puro« empfehlen.
Nicht nur die soziologischen Zusammenhänge dieser Philosophie mit dem herr-
schenden System Italiens, die sich äußerlich darin ausprägen, daß Gentile faszistischer
Kultusminister war und daß Mussolini ihn seinen *spirituale macstro* nennt, sondern
auch ihr spezifischer Inhalt erregt unser tiefes Interesse. Sie stellt den interessantesten
Versuch einer Umbildung des Hegelianismus innerhalb des bourgeoisen Denkens
der Gegenwart dar, den ich kenne. Gentile leistet das für Hegel, was Cohen und
die Marburger Schule und weiterhin der Neukantianismus überhaupt für Kant ge-
leistet haben, er arbeitet ein Moment des Hegelianismus in einseitiger und scharfer
Verfolgung zu einem völlig neuen in sich geschlossenen Weltbild aus. Das ist genau
wie bei Cohen das Moment der schöpferischen Subjektivität. Die Philosophie Gentiles
ist Subjektivismus. Wenn Hegel gelehrt hatte, daß das Absolute Subjekt sei, so
wird hier das Subjekt zurückgebogen in seinen positivistischen und transzendentalen
Aspekt. Gentile liest Hegel mit den Augen Berkeleys und Kants. Der Berkeleysche
Satz der Bewußtseinsimmanenz (esse — percipi) kombiniert sich mit dem kantischen
Prinzip der schöpferischen Subjektivität, und so entsteht ein Standpunkt mit starken
positivistischen und transzendentalen Einschlägen, ein verpositivierter und verkanteter
Hegel, der im Resultat mit jenem wenig mehr gemein hat als nur den Namen.
Oder ist ein metaphysikfeindlicher Hegel noch Hegel?
Man muß sich hüten, hier den Worten einen falschen Sinn zu geben. Wenn
das Grundprinzip dieses Standpunktes das der Aktualität des Ich (l'attualitä delü lo)
ist, wonach es niemals möglich sein soll, daß das Ich sich selbst als seinen Gegen-
stand erfasse, so hüte man sich, daraus eine metaphysische Position zu machen.
Nein, was damit gemeint ist, ist eine Anerkennung der positivistisch-neukantischen
These, daß uns weder ein absolutes Ding, noch ein absolutes Subjekt gegeben sei,
sondern vielmehr ein Prozeß, der nun freilich nicht wie bei den Marburgern als
der Prozeß der Beziehung des Subjektes auf das Objekt, sondern gemäß der histo-
rischen Einstellung des italienischen Positivismus dieser Männer als der historische
Prozeß der Selbstschöpfung des Geistes erscheint. Dieser schöpferische Geist ist
reine Aktivität, alles Ergon ist zurückzuverwandeln in Energeia, ja es läßt sich nur
abstraktiv beides voneinander trennen. Die Durchführung dieses Standpunktes, für
den es keine Trennung von Willen und Denken gibt, dem die Welt ein Gegenstand
unserer schöpferischen Aktivität ist, und der sich daher antiintellektualistisch nennt,
geht über den Rahmen dieser kurzen Anzeige hinaus. Es genüge zu bemerken, daß
sie mit beachtenswerter Konsequenz geschieht.
Zeitschr f. Ästhetik u. illg. Kunstwissenschaft. XXII. 32
497
G. Gentile, Vesprit, Acte Pur. Traduit de VItalien par A. Lion. Paris 1925.
Die überragenden Köpfe der italienischen Philosophie der Gegenwart sind
Benedetto Croce und Giovanni Gentile, die Verkünder eines neuen Idealismus, der
sich gegen den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Europa beherrschenden
Positivismus erhebt. Während Croce bei uns durch Übersetzungen seiner philo-
sophischen und literarischen Hauptwerke bekannt ist und überdies seine Ideen
durch Männer wie Voßler und Schlosser verbreitet sind, ist Gentile den weiteren
Kreisen der Gebildeten so gut wie unbekannt, und auch in den Fachkreisen trifft
man selten eine intensivere Kenntnis seines Werkes. Bedenkt man aber, daß rein
philosophisch betrachtet Gentile bedeutend interessanter als Croce ist: eine stärkere,
konzentrierte, durchgeformte Persönlichkeit von wahrhaft denkerischer Haltung neben
jenem, der mehr den Typ eines geistvollen komme de lettres darstellt, so ist es fast
beschämend zu sehen, daß die Franzosen die Bedeutung dieses Mannes eher durch
eine Übersetzung würdigten als wir. Um so mehr möchte ich allen, denen die
italienischen Originalwerke unzugänglich sind, diese französische Übersetzung des
Gentileschen Hauptwerkes *Teoria Generale dello Spirito comc Atto puro« empfehlen.
Nicht nur die soziologischen Zusammenhänge dieser Philosophie mit dem herr-
schenden System Italiens, die sich äußerlich darin ausprägen, daß Gentile faszistischer
Kultusminister war und daß Mussolini ihn seinen *spirituale macstro* nennt, sondern
auch ihr spezifischer Inhalt erregt unser tiefes Interesse. Sie stellt den interessantesten
Versuch einer Umbildung des Hegelianismus innerhalb des bourgeoisen Denkens
der Gegenwart dar, den ich kenne. Gentile leistet das für Hegel, was Cohen und
die Marburger Schule und weiterhin der Neukantianismus überhaupt für Kant ge-
leistet haben, er arbeitet ein Moment des Hegelianismus in einseitiger und scharfer
Verfolgung zu einem völlig neuen in sich geschlossenen Weltbild aus. Das ist genau
wie bei Cohen das Moment der schöpferischen Subjektivität. Die Philosophie Gentiles
ist Subjektivismus. Wenn Hegel gelehrt hatte, daß das Absolute Subjekt sei, so
wird hier das Subjekt zurückgebogen in seinen positivistischen und transzendentalen
Aspekt. Gentile liest Hegel mit den Augen Berkeleys und Kants. Der Berkeleysche
Satz der Bewußtseinsimmanenz (esse — percipi) kombiniert sich mit dem kantischen
Prinzip der schöpferischen Subjektivität, und so entsteht ein Standpunkt mit starken
positivistischen und transzendentalen Einschlägen, ein verpositivierter und verkanteter
Hegel, der im Resultat mit jenem wenig mehr gemein hat als nur den Namen.
Oder ist ein metaphysikfeindlicher Hegel noch Hegel?
Man muß sich hüten, hier den Worten einen falschen Sinn zu geben. Wenn
das Grundprinzip dieses Standpunktes das der Aktualität des Ich (l'attualitä delü lo)
ist, wonach es niemals möglich sein soll, daß das Ich sich selbst als seinen Gegen-
stand erfasse, so hüte man sich, daraus eine metaphysische Position zu machen.
Nein, was damit gemeint ist, ist eine Anerkennung der positivistisch-neukantischen
These, daß uns weder ein absolutes Ding, noch ein absolutes Subjekt gegeben sei,
sondern vielmehr ein Prozeß, der nun freilich nicht wie bei den Marburgern als
der Prozeß der Beziehung des Subjektes auf das Objekt, sondern gemäß der histo-
rischen Einstellung des italienischen Positivismus dieser Männer als der historische
Prozeß der Selbstschöpfung des Geistes erscheint. Dieser schöpferische Geist ist
reine Aktivität, alles Ergon ist zurückzuverwandeln in Energeia, ja es läßt sich nur
abstraktiv beides voneinander trennen. Die Durchführung dieses Standpunktes, für
den es keine Trennung von Willen und Denken gibt, dem die Welt ein Gegenstand
unserer schöpferischen Aktivität ist, und der sich daher antiintellektualistisch nennt,
geht über den Rahmen dieser kurzen Anzeige hinaus. Es genüge zu bemerken, daß
sie mit beachtenswerter Konsequenz geschieht.
Zeitschr f. Ästhetik u. illg. Kunstwissenschaft. XXII. 32