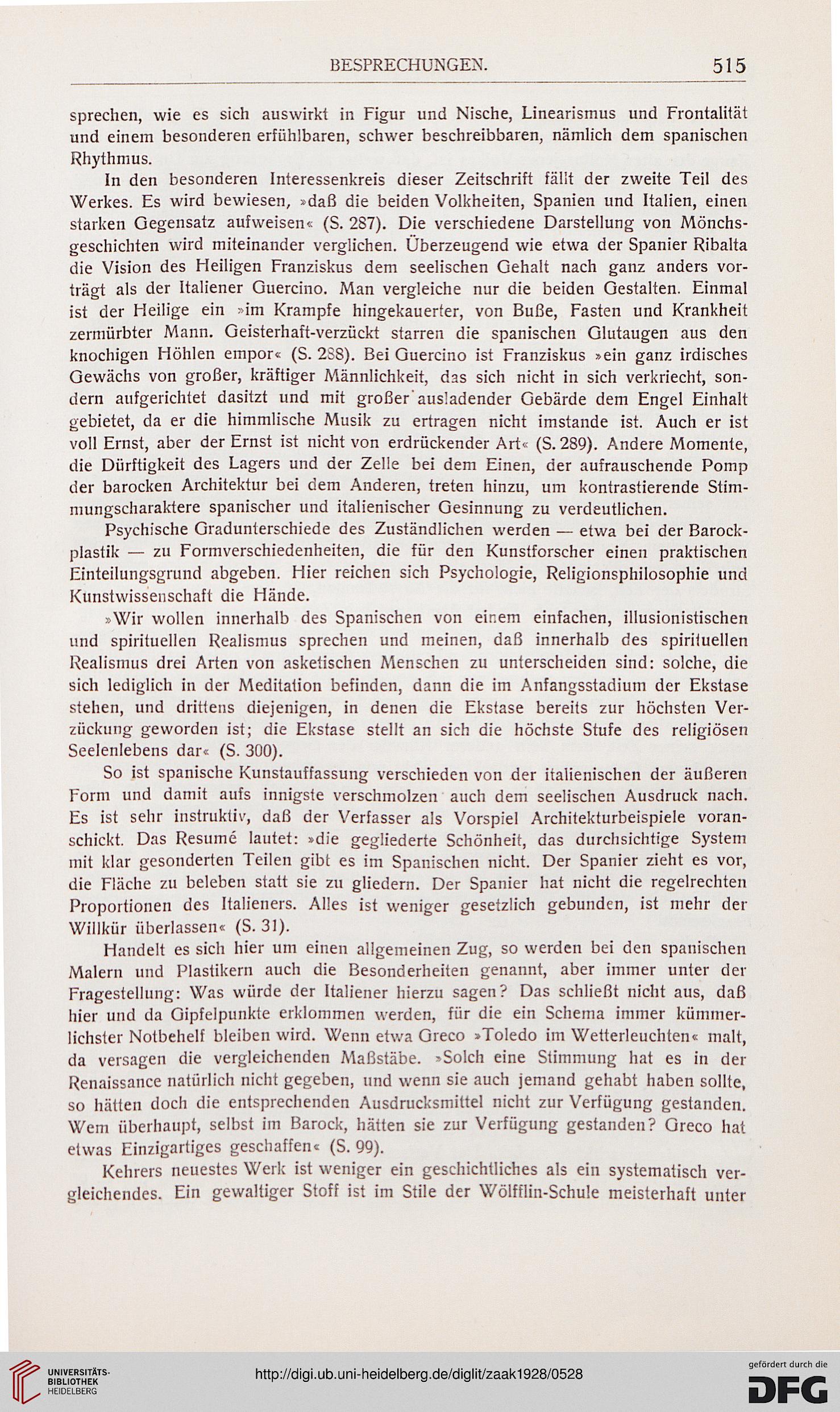BESPRECHUNGEN.
515
sprechen, wie es sich auswirkt in Figur und Nische, Linearismus und Frontalität
und einem besonderen erfühlbaren, schwer beschreibbaren, nämlich dem spanischen
Rhythmus.
In den besonderen Interessenkreis dieser Zeitschrift fällt der zweite Teil des
Werkes. Es wird bewiesen, »daß die beiden Volkheiten, Spanien und Italien, einen
starken Gegensatz aufweisen« (S. 287). Die verschiedene Darstellung von Mönchs-
geschichten wird miteinander verglichen. Überzeugend wie etwa der Spanier Ribalta
die Vision des Heiligen Franziskus dem seelischen Gehalt nach ganz anders vor-
trägt als der Italiener Guercino. Man vergleiche nur die beiden Gestalten. Einmal
ist der Heilige ein »im Krämpfe hingekauerter, von Buße, Fasten und Krankheit
zermürbter Mann. Geisterhaft-verzückt starren die spanischen Glutaugen aus den
knochigen Höhlen empor* (S. 2S8). Bei Guercino ist Franziskus »ein ganz irdisches
Gewächs von großer, kräftiger Männlichkeit, das sich nicht in sich verkriecht, son-
dern aufgerichtet dasitzt und mit großer'ausladender Gebärde dem Engel Einhalt
gebietet, da er die himmlische Musik zu ertragen nicht imstande ist. Auch er ist
voll Ernst, aber der Ernst ist nicht von erdrückender Art« (S. 289). Andere Momente,
die Dürftigkeit des Lagers und der Zelle bei dem Einen, der aufrauschende Pomp
der barocken Architektur bei dem Anderen, treten hinzu, um kontrastierende Stim-
mungscharaktere spanischer und italienischer Gesinnung zu verdeutlichen.
Psychische Gradunterschiede des Zuständlichen werden — etwa bei der Barock-
plastik — zu Formverschiedenheiten, die für den Kunstforscher einen praktischen
Einteilungsgrund abgeben. Hier reichen sich Psychologie, Religionsphilosophie und
Kunstwissenschaft die Hände.
»Wir wollen innerhalb des Spanischen von einem einfachen, illusionistischen
und spirituellen Realismus sprechen und meinen, daß innerhalb des spiriluellen
Realismus drei Arten von asketischen Menschen zu unterscheiden sind: solche, die
sich lediglich In der Meditation befinden, dann die im Anfangsstadium der Ekstase
stehen, und drittens diejenigen, in denen die Ekstase bereits zur höchsten Ver-
zückung geworden ist; die Ekstase stellt an sich die höchste Stufe des religiösen
Seelenlebens dar« (S. 300).
So ist spanische Kunstauffassung verschieden von der italienischen der äußeren
Form und damit aufs innigste verschmolzen auch dem seelischen Ausdruck nach.
Es ist sehr instruktiv, daß der Verfasser als Vorspiel Architekturbeispiele voran-
schickt. Das Resume lautet: »die gegliederte Schönheit, das durchsichtige System
mit klar gesonderten Teilen gibt es im Spanischen nicht. Der Spanier zieht es vor,
die Fläche zu beleben statt sie zu gliedern. Der Spanier hat nicht die regelrechten
Proportionen des Italieners. Alles ist weniger gesetzlich gebunden, ist mehr der
Willkür überlassen« (S. 31).
Handelt es sich hier um einen allgemeinen Zug, so werden bei den spanischen
Malern und Plastikern auch die Besonderheiten genannt, aber immer unter der
Fragestellung: Was würde der Italiener hierzu sagen? Das schließt nicht aus, daß
hier und da Gipfelpunkte erklommen werden, für die ein Schema immer kümmer-
lichster Notbehelf bleiben wird. Wenn etwa Greco »Toledo im Wetterleuchten« malt,
da versagen die vergleichenden Alaßstäbe. »Solch eine Stimmung hat es in der
Renaissance natürlich nicht gegeben, und wenn sie auch jemand gehabt haben sollte,
so hätten doch die entsprechenden Ausdrucksmittel nicht zur Verfügung gestanden.
Wem überhaupt, selbst im Barock, hätten sie zur Verfügung gestanden? Greco hat
etwas Einzigartiges geschaffen« (S. 99).
Kehrers neuestes Werk ist weniger ein geschichtliches als ein systematisch ver-
gleichendes. Ein gewaltiger Stoff ist im Stile der Wölfflin-Schule meisterhaft unter
515
sprechen, wie es sich auswirkt in Figur und Nische, Linearismus und Frontalität
und einem besonderen erfühlbaren, schwer beschreibbaren, nämlich dem spanischen
Rhythmus.
In den besonderen Interessenkreis dieser Zeitschrift fällt der zweite Teil des
Werkes. Es wird bewiesen, »daß die beiden Volkheiten, Spanien und Italien, einen
starken Gegensatz aufweisen« (S. 287). Die verschiedene Darstellung von Mönchs-
geschichten wird miteinander verglichen. Überzeugend wie etwa der Spanier Ribalta
die Vision des Heiligen Franziskus dem seelischen Gehalt nach ganz anders vor-
trägt als der Italiener Guercino. Man vergleiche nur die beiden Gestalten. Einmal
ist der Heilige ein »im Krämpfe hingekauerter, von Buße, Fasten und Krankheit
zermürbter Mann. Geisterhaft-verzückt starren die spanischen Glutaugen aus den
knochigen Höhlen empor* (S. 2S8). Bei Guercino ist Franziskus »ein ganz irdisches
Gewächs von großer, kräftiger Männlichkeit, das sich nicht in sich verkriecht, son-
dern aufgerichtet dasitzt und mit großer'ausladender Gebärde dem Engel Einhalt
gebietet, da er die himmlische Musik zu ertragen nicht imstande ist. Auch er ist
voll Ernst, aber der Ernst ist nicht von erdrückender Art« (S. 289). Andere Momente,
die Dürftigkeit des Lagers und der Zelle bei dem Einen, der aufrauschende Pomp
der barocken Architektur bei dem Anderen, treten hinzu, um kontrastierende Stim-
mungscharaktere spanischer und italienischer Gesinnung zu verdeutlichen.
Psychische Gradunterschiede des Zuständlichen werden — etwa bei der Barock-
plastik — zu Formverschiedenheiten, die für den Kunstforscher einen praktischen
Einteilungsgrund abgeben. Hier reichen sich Psychologie, Religionsphilosophie und
Kunstwissenschaft die Hände.
»Wir wollen innerhalb des Spanischen von einem einfachen, illusionistischen
und spirituellen Realismus sprechen und meinen, daß innerhalb des spiriluellen
Realismus drei Arten von asketischen Menschen zu unterscheiden sind: solche, die
sich lediglich In der Meditation befinden, dann die im Anfangsstadium der Ekstase
stehen, und drittens diejenigen, in denen die Ekstase bereits zur höchsten Ver-
zückung geworden ist; die Ekstase stellt an sich die höchste Stufe des religiösen
Seelenlebens dar« (S. 300).
So ist spanische Kunstauffassung verschieden von der italienischen der äußeren
Form und damit aufs innigste verschmolzen auch dem seelischen Ausdruck nach.
Es ist sehr instruktiv, daß der Verfasser als Vorspiel Architekturbeispiele voran-
schickt. Das Resume lautet: »die gegliederte Schönheit, das durchsichtige System
mit klar gesonderten Teilen gibt es im Spanischen nicht. Der Spanier zieht es vor,
die Fläche zu beleben statt sie zu gliedern. Der Spanier hat nicht die regelrechten
Proportionen des Italieners. Alles ist weniger gesetzlich gebunden, ist mehr der
Willkür überlassen« (S. 31).
Handelt es sich hier um einen allgemeinen Zug, so werden bei den spanischen
Malern und Plastikern auch die Besonderheiten genannt, aber immer unter der
Fragestellung: Was würde der Italiener hierzu sagen? Das schließt nicht aus, daß
hier und da Gipfelpunkte erklommen werden, für die ein Schema immer kümmer-
lichster Notbehelf bleiben wird. Wenn etwa Greco »Toledo im Wetterleuchten« malt,
da versagen die vergleichenden Alaßstäbe. »Solch eine Stimmung hat es in der
Renaissance natürlich nicht gegeben, und wenn sie auch jemand gehabt haben sollte,
so hätten doch die entsprechenden Ausdrucksmittel nicht zur Verfügung gestanden.
Wem überhaupt, selbst im Barock, hätten sie zur Verfügung gestanden? Greco hat
etwas Einzigartiges geschaffen« (S. 99).
Kehrers neuestes Werk ist weniger ein geschichtliches als ein systematisch ver-
gleichendes. Ein gewaltiger Stoff ist im Stile der Wölfflin-Schule meisterhaft unter