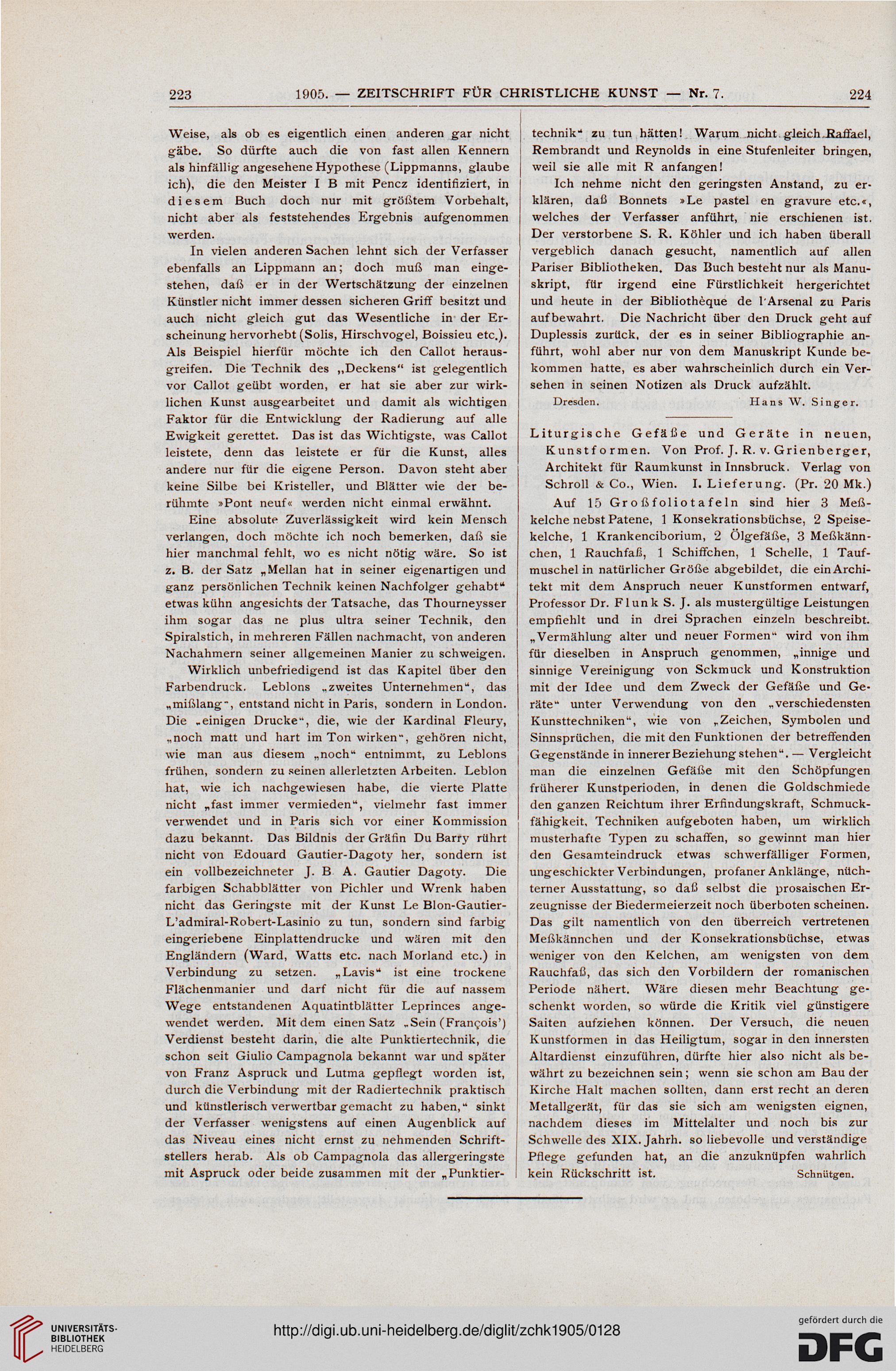223
1905. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 7.
224
Weise, als ob es eigentlich einen anderen gar nicht
gäbe. So dürfte auch die von fast allen Kennern
als hinfällig angesehene Hypothese (Lippmanns, glaube
ich), die den Meister I B mit Pencz identifiziert, in
diesem Buch doch nur mit größtem Vorbehalt,
nicht aber als feststehendes Ergebnis aufgenommen
werden.
In vielen anderen Sachen lehnt sich der Verfasser
ebenfalls an Lippmann an; doch muß man einge-
stehen, daß er in der Wertschätzung der einzelnen
Künstler nicht immer dessen sicheren Griff besitzt und
auch nicht gleich gut das Wesentliche in der Er-
scheinunghervorhebt (Solis, Hirschvogel, Boissieu etc.).
Als Beispiel hierfür möchte ich den Callot heraus-
greifen. Die Technik des „Deckens" ist gelegentlich
vor Callot geübt worden, er hat sie aber zur wirk-
lichen Kunst ausgearbeitet und damit als wichtigen
Faktor für die Entwicklung der Radierung auf alle
Ewigkeit gerettet. Das ist das Wichtigste, was Callot
leistete, denn das leistete er für die Kunst, alles
andere nur für die eigene Person. Davon steht aber
keine Silbe bei Kristeller, und Blätter wie der be-
rühmte »Pont neuf« werden nicht einmal erwähnt.
Eine absolute Zuverlässigkeit wird kein Mensch
verlangen, doch möchte ich noch bemerken, daß sie
hier manchmal fehlt, wo es nicht nötig wäre. So ist
z, B. der Satz „Mellan hat in seiner eigenartigen und
ganz persönlichen Technik keinen Nachfolger gehabt"
etwas kühn angesichts der Tatsache, das Thourneysser
ihm sogar das ne plus ultra seiner Technik, den
Spiralstich, in mehreren Fällen nachmacht, von anderen
Nachahmern seiner allgemeinen Manier zu schweigen.
Wirklich unbefriedigend ist das Kapitel über den
Farbendruck. Lebions „zweites Unternehmen", das
„mißlang", entstand nicht in Paris, sondern in London.
Die .einigen Drucke", die, wie der Kardinal Fleury,
„noch matt und hart im Ton wirken", gehören nicht,
wie man aus diesem „noch" entnimmt, zu Lebions
frühen, sondern zu seinen allerletzten Arbeiten. Lebion
hat, wie ich nachgewiesen habe, die vierte Platte
nicht „fast immer vermieden", vielmehr fast immer
verwendet und in Paris sich vor einer Kommission
dazu bekannt. Das Bildnis der Gräfin Du Barry rührt
nicht von Edouard Gautier-Dagoty her, sondern ist
ein vollbezeichneter J. B A. Gautier Dagoty. Die
farbigen Schabblätter von Pichler und Wrenk haben
nicht das Geringste mit der Kunst Le Blon-Gautier-
L'admiral-Robert-Lasinio zu tun, sondern sind farbig
eingeriebene Einplattendrucke und wären mit den
Engländern (Ward, Watts etc. nach Morland etc.) in
Verbindung zu setzen. „Lavis" ist eine trockene
Flächenmanier und darf nicht für die auf nassem
Wege entstandenen Aquatintblätter Leprinces ange-
wendet werden. Mit dem einen Satz „Sein (Francois'J
Verdienst besteht darin, die alte Punktiertechnik, die
schon seit Giulio Campagnola bekannt war und später
von Franz Aspruck und Lutma gepflegt worden ist,
durch die Verbindung mit der Radiertechnik praktisch
und künstlerisch verwertbar gemacht zu haben," sinkt
der Verfasser wenigstens auf einen Augenblick auf
das Niveau eines nicht ernst zu nehmenden Schrift-
stellers herab. Als ob Campagnola das allergeringste
mit Aspruck oder beide zusammen mit der „Punktier-
j technik" zu tun hätten! Warum nicht gleich .ßaffael,
Rembrandt und Reynolds in eine Stufenleiter bringen,
weil sie alle mit R anfangen!
Ich nehme nicht den geringsten Anstand, zu er-
klären, daß Bonnets »Le pastel en gravure etc.«,
welches der Verfasser anführt, nie erschienen ist.
Der verstorbene S. R. Köhler und ich haben überall
vergeblich danach gesucht, namentlich auf allen
Pariser Bibliotheken. Das Buch besteht nur als Manu-
skript, für irgend eine Fürstlichkeit hergerichtet
und heute in der Bibliotheque de l'Arsenal zu Paris
aufbewahrt. Die Nachricht über den Druck geht auf
Duplessis zurück, der es in seiner Bibliographie an-
führt, wohl aber nur von dem Manuskript Kunde be-
kommen hatte, es aber wahrscheinlich durch ein Ver-
sehen in seinen Notizen als Druck aufzählt.
Dresden. Hans W. Singer.
Liturgische Gefäße und Geräte in neuen,
Kunstformen. Von Prof. J. R. v. Grienberger,
Architekt für Raumkunst in Innsbruck. Verlag von
Schroll & Co., Wien. I. Lieferung. (Pr. 20 Mk.)
Auf 15 Gr o ß foliot afein sind hier 3 Meß-
kelche nebst Patene, 1 Konsekrationsbüchse, 2 Speise-
kelche, 1 Krankenciborium, 2 Ölgefäße, 3 Meßkänn-
chen, 1 Rauchfafi, 1 Schiffchen, 1 Schelle, 1 Tauf-
muschel in natürlicher Größe abgebildet, die einArchi-
tekt mit dem Anspruch neuer Kunstformen entwarf,
Professor Dr. Fl unk S. J. als mustergültige Leistungen
empfiehlt und in drei Sprachen einzeln beschreibt.
„Vermählung alter und neuer Formen" wird von ihm
für dieselben in Anspruch genommen, „innige und
sinnige Vereinigung von Sckmuck und Konstruktion
mit der Idee und dem Zweck der Gefäße und Ge-
räte" unter Verwendung von den „verschiedensten
Kunsttechniken", wie von „Zeichen, Symbolen und
Sinnsprüchen, die mit den Funktionen der betreffenden
Gegenstände in innerer Beziehung stehen". — Vergleicht
man die einzelnen Gefäße mit den Schöpfungen
früherer Kunstperioden, in denen die Goldschmiede
den ganzen Reichtum ihrer Erfindungskraft, Schmuck-
fähigkeit, Techniken aufgeboten haben, um wirklich
musterhafte Typen zu schaffen, so gewinnt man hier
den Gesamteindruck etwas schwerfälliger Formen,
ungeschickter Verbindungen, profaner Anklänge, nüch-
terner Ausstattung, so daß selbst die prosaischen Er-
zeugnisse der Biedermeierzeit noch überboten scheinen.
Das gilt namentlich von den überreich vertretenen
Meßkännchen und der Konsekrationsbüchse, etwas
weniger von den Kelchen, am wenigsten von dem
Rauchfaß, das sich den Vorbildern der romanischen
Periode nähert. Wäre diesen mehr Beachtung ge-
schenkt worden, so würde die Kritik viel günstigere
Saiten aufziehen können. Der Versuch, die neuen
Kunstformen in das Heiligtum, sogar in den innersten
Altardienst einzuführen, dürfte hier also nicht als be-
währt zu bezeichnen sein; wenn sie schon am Bau der
Kirche Halt machen sollten, dann erst recht an deren
Metallgerät, für das sie sich am wenigsten eignen,
nachdem dieses im Mittelalter und noch bis zur
Schwelle des XIX. Jahrh. so liebevolle und verständige
Pflege gefunden hat, an die anzuknüpfen wahrlich
kein Rückschritt ist. Schnütgen.
1905. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 7.
224
Weise, als ob es eigentlich einen anderen gar nicht
gäbe. So dürfte auch die von fast allen Kennern
als hinfällig angesehene Hypothese (Lippmanns, glaube
ich), die den Meister I B mit Pencz identifiziert, in
diesem Buch doch nur mit größtem Vorbehalt,
nicht aber als feststehendes Ergebnis aufgenommen
werden.
In vielen anderen Sachen lehnt sich der Verfasser
ebenfalls an Lippmann an; doch muß man einge-
stehen, daß er in der Wertschätzung der einzelnen
Künstler nicht immer dessen sicheren Griff besitzt und
auch nicht gleich gut das Wesentliche in der Er-
scheinunghervorhebt (Solis, Hirschvogel, Boissieu etc.).
Als Beispiel hierfür möchte ich den Callot heraus-
greifen. Die Technik des „Deckens" ist gelegentlich
vor Callot geübt worden, er hat sie aber zur wirk-
lichen Kunst ausgearbeitet und damit als wichtigen
Faktor für die Entwicklung der Radierung auf alle
Ewigkeit gerettet. Das ist das Wichtigste, was Callot
leistete, denn das leistete er für die Kunst, alles
andere nur für die eigene Person. Davon steht aber
keine Silbe bei Kristeller, und Blätter wie der be-
rühmte »Pont neuf« werden nicht einmal erwähnt.
Eine absolute Zuverlässigkeit wird kein Mensch
verlangen, doch möchte ich noch bemerken, daß sie
hier manchmal fehlt, wo es nicht nötig wäre. So ist
z, B. der Satz „Mellan hat in seiner eigenartigen und
ganz persönlichen Technik keinen Nachfolger gehabt"
etwas kühn angesichts der Tatsache, das Thourneysser
ihm sogar das ne plus ultra seiner Technik, den
Spiralstich, in mehreren Fällen nachmacht, von anderen
Nachahmern seiner allgemeinen Manier zu schweigen.
Wirklich unbefriedigend ist das Kapitel über den
Farbendruck. Lebions „zweites Unternehmen", das
„mißlang", entstand nicht in Paris, sondern in London.
Die .einigen Drucke", die, wie der Kardinal Fleury,
„noch matt und hart im Ton wirken", gehören nicht,
wie man aus diesem „noch" entnimmt, zu Lebions
frühen, sondern zu seinen allerletzten Arbeiten. Lebion
hat, wie ich nachgewiesen habe, die vierte Platte
nicht „fast immer vermieden", vielmehr fast immer
verwendet und in Paris sich vor einer Kommission
dazu bekannt. Das Bildnis der Gräfin Du Barry rührt
nicht von Edouard Gautier-Dagoty her, sondern ist
ein vollbezeichneter J. B A. Gautier Dagoty. Die
farbigen Schabblätter von Pichler und Wrenk haben
nicht das Geringste mit der Kunst Le Blon-Gautier-
L'admiral-Robert-Lasinio zu tun, sondern sind farbig
eingeriebene Einplattendrucke und wären mit den
Engländern (Ward, Watts etc. nach Morland etc.) in
Verbindung zu setzen. „Lavis" ist eine trockene
Flächenmanier und darf nicht für die auf nassem
Wege entstandenen Aquatintblätter Leprinces ange-
wendet werden. Mit dem einen Satz „Sein (Francois'J
Verdienst besteht darin, die alte Punktiertechnik, die
schon seit Giulio Campagnola bekannt war und später
von Franz Aspruck und Lutma gepflegt worden ist,
durch die Verbindung mit der Radiertechnik praktisch
und künstlerisch verwertbar gemacht zu haben," sinkt
der Verfasser wenigstens auf einen Augenblick auf
das Niveau eines nicht ernst zu nehmenden Schrift-
stellers herab. Als ob Campagnola das allergeringste
mit Aspruck oder beide zusammen mit der „Punktier-
j technik" zu tun hätten! Warum nicht gleich .ßaffael,
Rembrandt und Reynolds in eine Stufenleiter bringen,
weil sie alle mit R anfangen!
Ich nehme nicht den geringsten Anstand, zu er-
klären, daß Bonnets »Le pastel en gravure etc.«,
welches der Verfasser anführt, nie erschienen ist.
Der verstorbene S. R. Köhler und ich haben überall
vergeblich danach gesucht, namentlich auf allen
Pariser Bibliotheken. Das Buch besteht nur als Manu-
skript, für irgend eine Fürstlichkeit hergerichtet
und heute in der Bibliotheque de l'Arsenal zu Paris
aufbewahrt. Die Nachricht über den Druck geht auf
Duplessis zurück, der es in seiner Bibliographie an-
führt, wohl aber nur von dem Manuskript Kunde be-
kommen hatte, es aber wahrscheinlich durch ein Ver-
sehen in seinen Notizen als Druck aufzählt.
Dresden. Hans W. Singer.
Liturgische Gefäße und Geräte in neuen,
Kunstformen. Von Prof. J. R. v. Grienberger,
Architekt für Raumkunst in Innsbruck. Verlag von
Schroll & Co., Wien. I. Lieferung. (Pr. 20 Mk.)
Auf 15 Gr o ß foliot afein sind hier 3 Meß-
kelche nebst Patene, 1 Konsekrationsbüchse, 2 Speise-
kelche, 1 Krankenciborium, 2 Ölgefäße, 3 Meßkänn-
chen, 1 Rauchfafi, 1 Schiffchen, 1 Schelle, 1 Tauf-
muschel in natürlicher Größe abgebildet, die einArchi-
tekt mit dem Anspruch neuer Kunstformen entwarf,
Professor Dr. Fl unk S. J. als mustergültige Leistungen
empfiehlt und in drei Sprachen einzeln beschreibt.
„Vermählung alter und neuer Formen" wird von ihm
für dieselben in Anspruch genommen, „innige und
sinnige Vereinigung von Sckmuck und Konstruktion
mit der Idee und dem Zweck der Gefäße und Ge-
räte" unter Verwendung von den „verschiedensten
Kunsttechniken", wie von „Zeichen, Symbolen und
Sinnsprüchen, die mit den Funktionen der betreffenden
Gegenstände in innerer Beziehung stehen". — Vergleicht
man die einzelnen Gefäße mit den Schöpfungen
früherer Kunstperioden, in denen die Goldschmiede
den ganzen Reichtum ihrer Erfindungskraft, Schmuck-
fähigkeit, Techniken aufgeboten haben, um wirklich
musterhafte Typen zu schaffen, so gewinnt man hier
den Gesamteindruck etwas schwerfälliger Formen,
ungeschickter Verbindungen, profaner Anklänge, nüch-
terner Ausstattung, so daß selbst die prosaischen Er-
zeugnisse der Biedermeierzeit noch überboten scheinen.
Das gilt namentlich von den überreich vertretenen
Meßkännchen und der Konsekrationsbüchse, etwas
weniger von den Kelchen, am wenigsten von dem
Rauchfaß, das sich den Vorbildern der romanischen
Periode nähert. Wäre diesen mehr Beachtung ge-
schenkt worden, so würde die Kritik viel günstigere
Saiten aufziehen können. Der Versuch, die neuen
Kunstformen in das Heiligtum, sogar in den innersten
Altardienst einzuführen, dürfte hier also nicht als be-
währt zu bezeichnen sein; wenn sie schon am Bau der
Kirche Halt machen sollten, dann erst recht an deren
Metallgerät, für das sie sich am wenigsten eignen,
nachdem dieses im Mittelalter und noch bis zur
Schwelle des XIX. Jahrh. so liebevolle und verständige
Pflege gefunden hat, an die anzuknüpfen wahrlich
kein Rückschritt ist. Schnütgen.