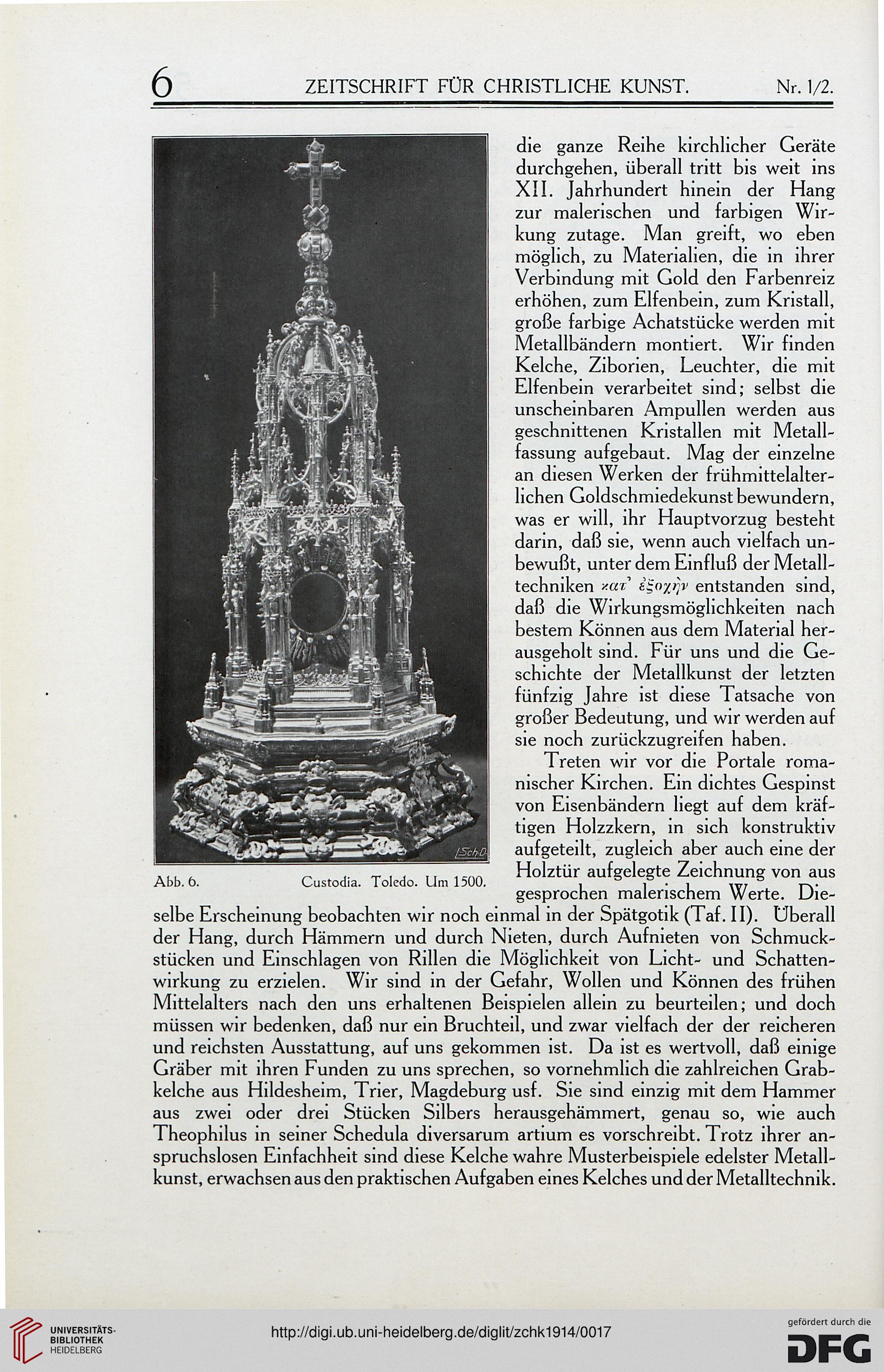ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 1/2.
die ganze Reihe kirchlicher Geräte
durchgehen, überall tritt bis weit ins
XII. Jahrhundert hinein der Hang
zur malerischen und farbigen Wir-
kung zutage. Man greift, wo eben
möglich, zu Materialien, die in ihrer
Verbindung mit Gold den Farbenreiz
erhöhen, zum Elfenbein, zum Kristall,
große farbige Achatstücke werden mit
Metallbändern montiert. Wir finden
Kelche, Ziborien, Leuchter, die mit
Elfenbein verarbeitet sind; selbst die
unscheinbaren Ampullen werden aus
geschnittenen Kristallen mit Metall-
fassung aufgebaut. Mag der einzelne
an diesen Werken der frühmittelalter-
lichen Goldschmiedekunst bewundern,
was er will, ihr Hauptvorzug besteht
darin, daß sie, wenn auch vielfach un-
bewußt, unter dem Einfluß der Metall-
techniken *ar i'ioy^v entstanden sind,
daß die Wirkungsmöglichkeiten nach
bestem Können aus dem Material her-
ausgeholt sind. Für uns und die Ge-
schichte der Metallkunst der letzten
fünfzig Jahre ist diese Tatsache von
großer Bedeutung, und wir werden auf
sie noch zurückzugreifen haben.
Treten wir vor die Portale roma-
nischer Kirchen. Ein dichtes Gespinst
von Eisenbändern hegt auf dem kräf-
tigen Holzzkern, in sich konstruktiv
aufgeteilt, zugleich aber auch eine der
Holztür aufgelegte Zeichnung von aus
gesprochen malerischem Werte. Die-
selbe Erscheinung beobachten wir noch einmal in der Spätgotik (Taf. II). Überall
der Hang, durch Hämmern und durch Nieten, durch Aufnieten von Schmuck-
stücken und Einschlagen von Rillen die Möglichkeit von Licht- und Schatten-
wirkung zu erzielen. Wir sind in der Gefahr, Wollen und Können des frühen
Mittelalters nach den uns erhaltenen Beispielen allein zu beurteilen; und doch
müssen wir bedenken, daß nur ein Bruchteil, und zwar vielfach der der reicheren
und reichsten Ausstattung, auf uns gekommen ist. Da ist es wertvoll, daß einige
Gräber mit ihren Funden zu uns sprechen, so vornehmlich die zahlreichen Grab-
kelche aus Hildesheim, Trier, Magdeburg usf. Sie sind einzig mit dem Hammer
aus zwei oder drei Stücken Silbers herausgehämmert, genau so, wie auch
Theophilus in seiner Schedula diversarum artium es vorschreibt. Trotz ihrer an-
spruchslosen Einfachheit sind diese Kelche wahre Musterbeispiele edelster Metall-
kunst, erwachsen aus den praktischen Aufgaben eines Kelches und der Metalltechnik.
z
>£$
Ml! v|Ä hF ■
i ,-4L l
p^^^igf—L^^^^
t_.._ jp
■&£v8K!^?? Sä^Ell
Abb. ö.
Custodia. Toledo. Um 1500.
Nr. 1/2.
die ganze Reihe kirchlicher Geräte
durchgehen, überall tritt bis weit ins
XII. Jahrhundert hinein der Hang
zur malerischen und farbigen Wir-
kung zutage. Man greift, wo eben
möglich, zu Materialien, die in ihrer
Verbindung mit Gold den Farbenreiz
erhöhen, zum Elfenbein, zum Kristall,
große farbige Achatstücke werden mit
Metallbändern montiert. Wir finden
Kelche, Ziborien, Leuchter, die mit
Elfenbein verarbeitet sind; selbst die
unscheinbaren Ampullen werden aus
geschnittenen Kristallen mit Metall-
fassung aufgebaut. Mag der einzelne
an diesen Werken der frühmittelalter-
lichen Goldschmiedekunst bewundern,
was er will, ihr Hauptvorzug besteht
darin, daß sie, wenn auch vielfach un-
bewußt, unter dem Einfluß der Metall-
techniken *ar i'ioy^v entstanden sind,
daß die Wirkungsmöglichkeiten nach
bestem Können aus dem Material her-
ausgeholt sind. Für uns und die Ge-
schichte der Metallkunst der letzten
fünfzig Jahre ist diese Tatsache von
großer Bedeutung, und wir werden auf
sie noch zurückzugreifen haben.
Treten wir vor die Portale roma-
nischer Kirchen. Ein dichtes Gespinst
von Eisenbändern hegt auf dem kräf-
tigen Holzzkern, in sich konstruktiv
aufgeteilt, zugleich aber auch eine der
Holztür aufgelegte Zeichnung von aus
gesprochen malerischem Werte. Die-
selbe Erscheinung beobachten wir noch einmal in der Spätgotik (Taf. II). Überall
der Hang, durch Hämmern und durch Nieten, durch Aufnieten von Schmuck-
stücken und Einschlagen von Rillen die Möglichkeit von Licht- und Schatten-
wirkung zu erzielen. Wir sind in der Gefahr, Wollen und Können des frühen
Mittelalters nach den uns erhaltenen Beispielen allein zu beurteilen; und doch
müssen wir bedenken, daß nur ein Bruchteil, und zwar vielfach der der reicheren
und reichsten Ausstattung, auf uns gekommen ist. Da ist es wertvoll, daß einige
Gräber mit ihren Funden zu uns sprechen, so vornehmlich die zahlreichen Grab-
kelche aus Hildesheim, Trier, Magdeburg usf. Sie sind einzig mit dem Hammer
aus zwei oder drei Stücken Silbers herausgehämmert, genau so, wie auch
Theophilus in seiner Schedula diversarum artium es vorschreibt. Trotz ihrer an-
spruchslosen Einfachheit sind diese Kelche wahre Musterbeispiele edelster Metall-
kunst, erwachsen aus den praktischen Aufgaben eines Kelches und der Metalltechnik.
z
>£$
Ml! v|Ä hF ■
i ,-4L l
p^^^igf—L^^^^
t_.._ jp
■&£v8K!^?? Sä^Ell
Abb. ö.
Custodia. Toledo. Um 1500.