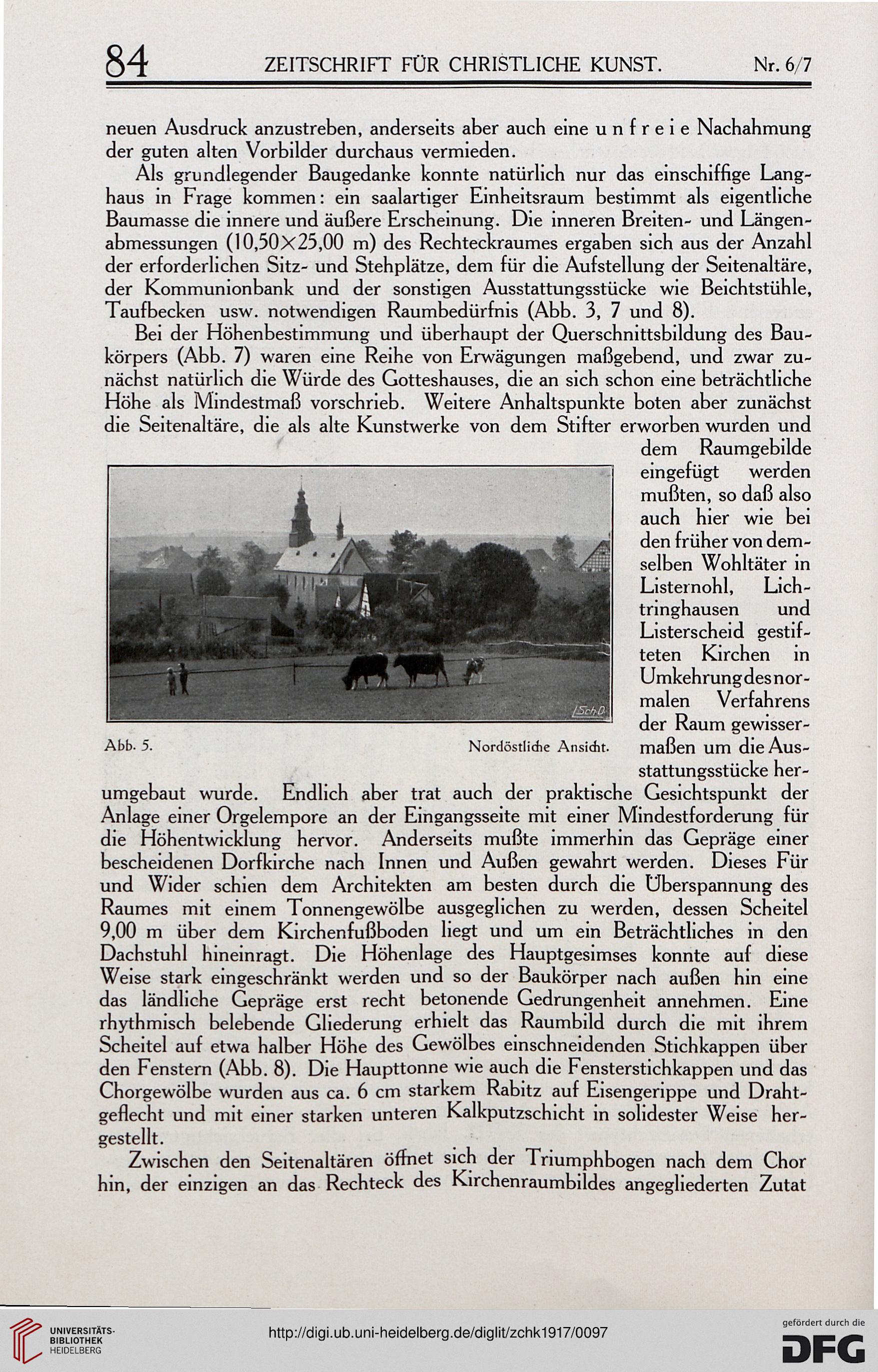84
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 6/7
neuen Ausdruck anzustreben, anderseits aber auch eine unfreie Nachahmung
der guten alten Vorbilder durchaus vermieden.
Als grundlegender Baugedanke konnte natürlich nur das einschiffige Lang-
haus in Frage kommen: ein saalartiger Einheitsraum bestimmt als eigentliche
Baumasse die innere und äußere Erscheinung. Die inneren Breiten- und Längen-
abmessungen (10,50X25,00 m) des Rechteckraumes ergaben sich aus der Anzahl
der erforderlichen Sitz- und Stehplätze, dem für die Aufstellung der Seitenaltäre,
der Kommunionbank und der sonstigen Ausstattungsstücke wie Beichtstühle,
Taufbecken usw. notwendigen Raumbedürfnis (Abb. 3, 7 und 8).
Bei der Höhenbestimmung und überhaupt der Querschnittsbildung des Bau-
körpers (Abb. 7) waren eine Reihe von Erwägungen maßgebend, und zwar zu-
nächst natürlich die Würde des Gotteshauses, die an sich schon eine beträchtliche
Höhe als Mindestmaß vorschrieb. Weitere Anhaltspunkte boten aber zunächst
die Seitenaltäre, die als alte Kunstwerke von dem Stifter erworben wurden und
dem Raumgebilde
eingefügt werden
mußten, so daß also
auch hier wie bei
den früher von dem-
selben Wohltäter in
Lister nohl, Lich-
tringhausen und
Listerscheid gestif-
teten Kirchen in
Umkehrungdesnor-
malen Verfahrens
der Raum gewisser-
maßen um die Aus-
stattungsstücke her-
umgebaut wurde. Endlich aber trat auch der praktische Gesichtspunkt der
Anlage einer Orgelempore an der Eingangsseite mit einer Mindestforderung für
die Höhentwicklung hervor. Anderseits mußte immerhin das Gepräge einer
bescheidenen Dorfkirche nach Innen und Außen gewahrt werden. Dieses Für
und Wider schien dem Architekten am besten durch die Überspannung des
Raumes mit einem Tonnengewölbe ausgeglichen zu werden, dessen Scheitel
9,00 m über dem Kirchenfußboden hegt und um ein Beträchtliches in den
Dachstuhl hineinragt. Die Höhenlage des Hauptgesimses konnte auf diese
Weise stark eingeschränkt werden und so der Baukörper nach außen hin eine
das ländliche Gepräge erst recht betonende Gedrungenheit annehmen. Eine
rhythmisch belebende Gliederung erhielt das Raumbild durch die mit ihrem
Scheitel auf etwa halber Höhe des Gewölbes einschneidenden Stichkappen über
den Fenstern (Abb. 8). Die Haupttonne wie auch die Fensterstichkappen und das
Chorgewölbe wurden aus ca. 6 cm starkem Rabitz auf Eisengerippe und Draht-
geflecht und mit einer starken unteren Kalkputzschicht in solidester Weise her-
gestellt.
Zwischen den Seitenaltären öffnet sich der Triumphbogen nach dem Chor
hin, der einzigen an das Rechteck des Kirchenraumbildes angegliederten Zutat
Abb. 5.
Nordöstliche Ansicht.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 6/7
neuen Ausdruck anzustreben, anderseits aber auch eine unfreie Nachahmung
der guten alten Vorbilder durchaus vermieden.
Als grundlegender Baugedanke konnte natürlich nur das einschiffige Lang-
haus in Frage kommen: ein saalartiger Einheitsraum bestimmt als eigentliche
Baumasse die innere und äußere Erscheinung. Die inneren Breiten- und Längen-
abmessungen (10,50X25,00 m) des Rechteckraumes ergaben sich aus der Anzahl
der erforderlichen Sitz- und Stehplätze, dem für die Aufstellung der Seitenaltäre,
der Kommunionbank und der sonstigen Ausstattungsstücke wie Beichtstühle,
Taufbecken usw. notwendigen Raumbedürfnis (Abb. 3, 7 und 8).
Bei der Höhenbestimmung und überhaupt der Querschnittsbildung des Bau-
körpers (Abb. 7) waren eine Reihe von Erwägungen maßgebend, und zwar zu-
nächst natürlich die Würde des Gotteshauses, die an sich schon eine beträchtliche
Höhe als Mindestmaß vorschrieb. Weitere Anhaltspunkte boten aber zunächst
die Seitenaltäre, die als alte Kunstwerke von dem Stifter erworben wurden und
dem Raumgebilde
eingefügt werden
mußten, so daß also
auch hier wie bei
den früher von dem-
selben Wohltäter in
Lister nohl, Lich-
tringhausen und
Listerscheid gestif-
teten Kirchen in
Umkehrungdesnor-
malen Verfahrens
der Raum gewisser-
maßen um die Aus-
stattungsstücke her-
umgebaut wurde. Endlich aber trat auch der praktische Gesichtspunkt der
Anlage einer Orgelempore an der Eingangsseite mit einer Mindestforderung für
die Höhentwicklung hervor. Anderseits mußte immerhin das Gepräge einer
bescheidenen Dorfkirche nach Innen und Außen gewahrt werden. Dieses Für
und Wider schien dem Architekten am besten durch die Überspannung des
Raumes mit einem Tonnengewölbe ausgeglichen zu werden, dessen Scheitel
9,00 m über dem Kirchenfußboden hegt und um ein Beträchtliches in den
Dachstuhl hineinragt. Die Höhenlage des Hauptgesimses konnte auf diese
Weise stark eingeschränkt werden und so der Baukörper nach außen hin eine
das ländliche Gepräge erst recht betonende Gedrungenheit annehmen. Eine
rhythmisch belebende Gliederung erhielt das Raumbild durch die mit ihrem
Scheitel auf etwa halber Höhe des Gewölbes einschneidenden Stichkappen über
den Fenstern (Abb. 8). Die Haupttonne wie auch die Fensterstichkappen und das
Chorgewölbe wurden aus ca. 6 cm starkem Rabitz auf Eisengerippe und Draht-
geflecht und mit einer starken unteren Kalkputzschicht in solidester Weise her-
gestellt.
Zwischen den Seitenaltären öffnet sich der Triumphbogen nach dem Chor
hin, der einzigen an das Rechteck des Kirchenraumbildes angegliederten Zutat
Abb. 5.
Nordöstliche Ansicht.