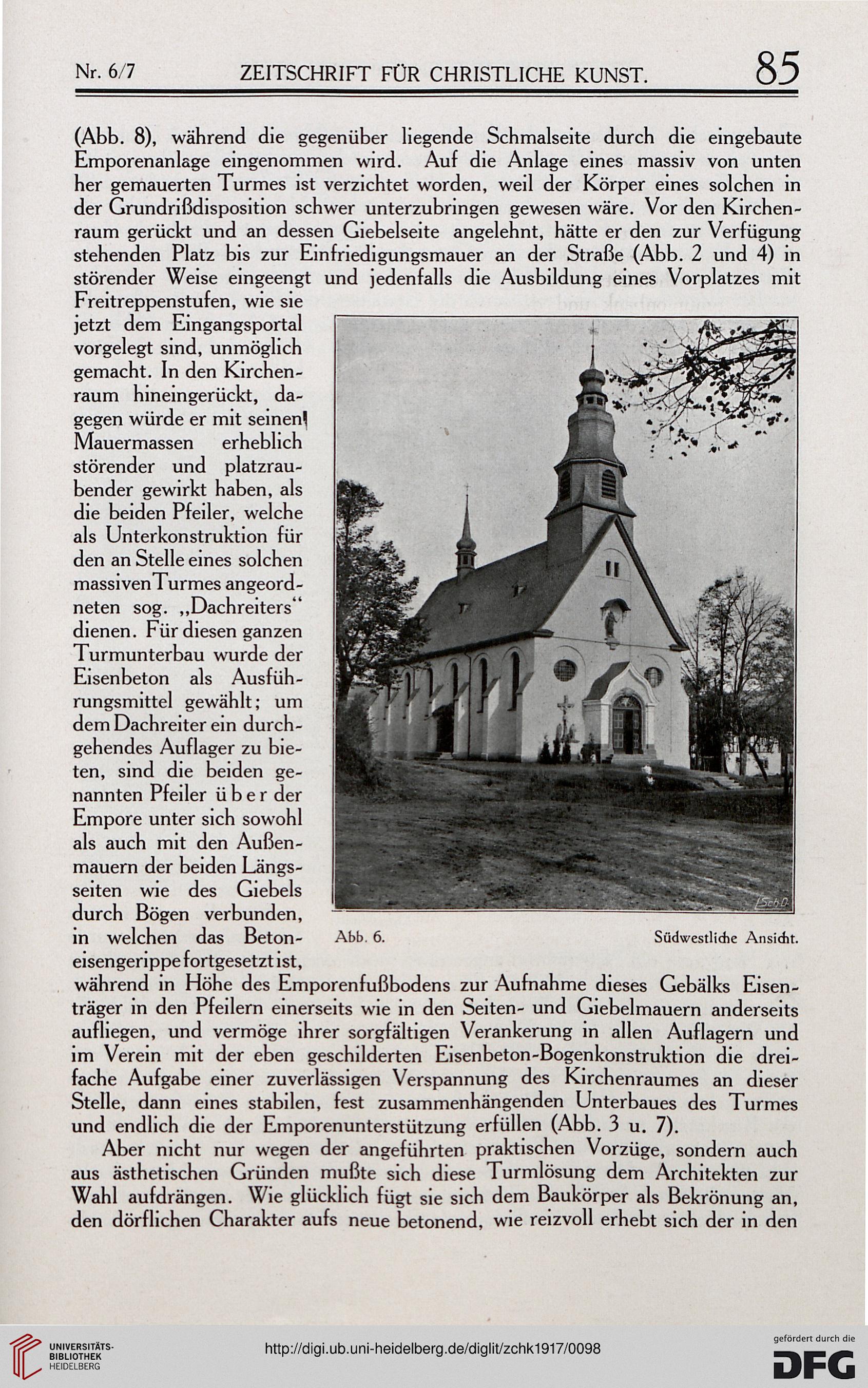Nr. 6/7
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
85
(Abb. 8), während die gegenüber liegende Schmalseite durch die eingebaute
Emporenanlage eingenommen wird. Auf die Anlage eines massiv von unten
her gemauerten Turmes ist verzichtet worden, weil der Körper eines solchen in
der Grundrißdisposition schwer unterzubringen gewesen wäre. Vor den Kirchen-
raum gerückt und an dessen Giebelseite angelehnt, hätte er den zur Verfügung
stehenden Platz bis zur Einfriedigungsmauer an der Straße (Abb. 2 und 4) in
störender Weise eingeengt und jedenfalls die Ausbildung eines Vorplatzes mit
Freitreppenstufen, wie sie
jetzt dem Eingangsportal
vorgelegt sind, unmöglich
gemacht. In den Kirchen-
raum hineingerückt, da-
gegen würde er mit seinen^
Mauermassen erheblich
störender und platzrau-
bender gewirkt haben, als
die beiden Pfeiler, welche
als Unterkonstruktion für
den an Stelle eines solchen
massiven Turmes angeord-
neten sog. „Dachreiters"
dienen. Für diesen ganzen
Turmunterbau wurde der
Eisenbeton als Ausfüh-
rungsmittel gewählt; um
dem Dachreiter ein durch-
gehendes Auflager zu bie-
ten, sind die beiden ge-
nannten Pfeiler über der
Empore unter sich sowohl
als auch mit den Außen-
mauern der beiden Längs-
seiten wie des Giebels
durch Bögen verbunden,
in welchen das Beton-
eisengerippe fortgesetzt ist,
während in Höhe des Emporenfußbodens zur Aufnahme dieses Gebälks Eisen-
träger in den Pfeilern einerseits wie in den Seiten- und Giebelmauern anderseits
aufliegen, und vermöge ihrer sorgfältigen Verankerung in allen Auflagern und
im Verein mit der eben geschilderten Eisenbeton-Bogenkonstruktion die drei-
fache Aufgabe einer zuverlässigen Verspannung des Kirchenraumes an dieser
Stelle, dann eines stabilen, fest zusammenhängenden Unterbaues des Turmes
und endlich die der Emporenunterstützung erfüllen (Abb. 3 u. 7).
Aber nicht nur wegen der angeführten praktischen Vorzüge, sondern auch
aus ästhetischen Gründen mußte sich diese Turmlösung dem Architekten zur
Wahl aufdrängen. Wie glücklich fügt sie sich dem Baukörper als Bekrönung an,
den dörflichen Charakter aufs neue betonend, wie reizvoll erhebt sich der in den
Abb. 6.
Südwestliche Ansicht.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
85
(Abb. 8), während die gegenüber liegende Schmalseite durch die eingebaute
Emporenanlage eingenommen wird. Auf die Anlage eines massiv von unten
her gemauerten Turmes ist verzichtet worden, weil der Körper eines solchen in
der Grundrißdisposition schwer unterzubringen gewesen wäre. Vor den Kirchen-
raum gerückt und an dessen Giebelseite angelehnt, hätte er den zur Verfügung
stehenden Platz bis zur Einfriedigungsmauer an der Straße (Abb. 2 und 4) in
störender Weise eingeengt und jedenfalls die Ausbildung eines Vorplatzes mit
Freitreppenstufen, wie sie
jetzt dem Eingangsportal
vorgelegt sind, unmöglich
gemacht. In den Kirchen-
raum hineingerückt, da-
gegen würde er mit seinen^
Mauermassen erheblich
störender und platzrau-
bender gewirkt haben, als
die beiden Pfeiler, welche
als Unterkonstruktion für
den an Stelle eines solchen
massiven Turmes angeord-
neten sog. „Dachreiters"
dienen. Für diesen ganzen
Turmunterbau wurde der
Eisenbeton als Ausfüh-
rungsmittel gewählt; um
dem Dachreiter ein durch-
gehendes Auflager zu bie-
ten, sind die beiden ge-
nannten Pfeiler über der
Empore unter sich sowohl
als auch mit den Außen-
mauern der beiden Längs-
seiten wie des Giebels
durch Bögen verbunden,
in welchen das Beton-
eisengerippe fortgesetzt ist,
während in Höhe des Emporenfußbodens zur Aufnahme dieses Gebälks Eisen-
träger in den Pfeilern einerseits wie in den Seiten- und Giebelmauern anderseits
aufliegen, und vermöge ihrer sorgfältigen Verankerung in allen Auflagern und
im Verein mit der eben geschilderten Eisenbeton-Bogenkonstruktion die drei-
fache Aufgabe einer zuverlässigen Verspannung des Kirchenraumes an dieser
Stelle, dann eines stabilen, fest zusammenhängenden Unterbaues des Turmes
und endlich die der Emporenunterstützung erfüllen (Abb. 3 u. 7).
Aber nicht nur wegen der angeführten praktischen Vorzüge, sondern auch
aus ästhetischen Gründen mußte sich diese Turmlösung dem Architekten zur
Wahl aufdrängen. Wie glücklich fügt sie sich dem Baukörper als Bekrönung an,
den dörflichen Charakter aufs neue betonend, wie reizvoll erhebt sich der in den
Abb. 6.
Südwestliche Ansicht.