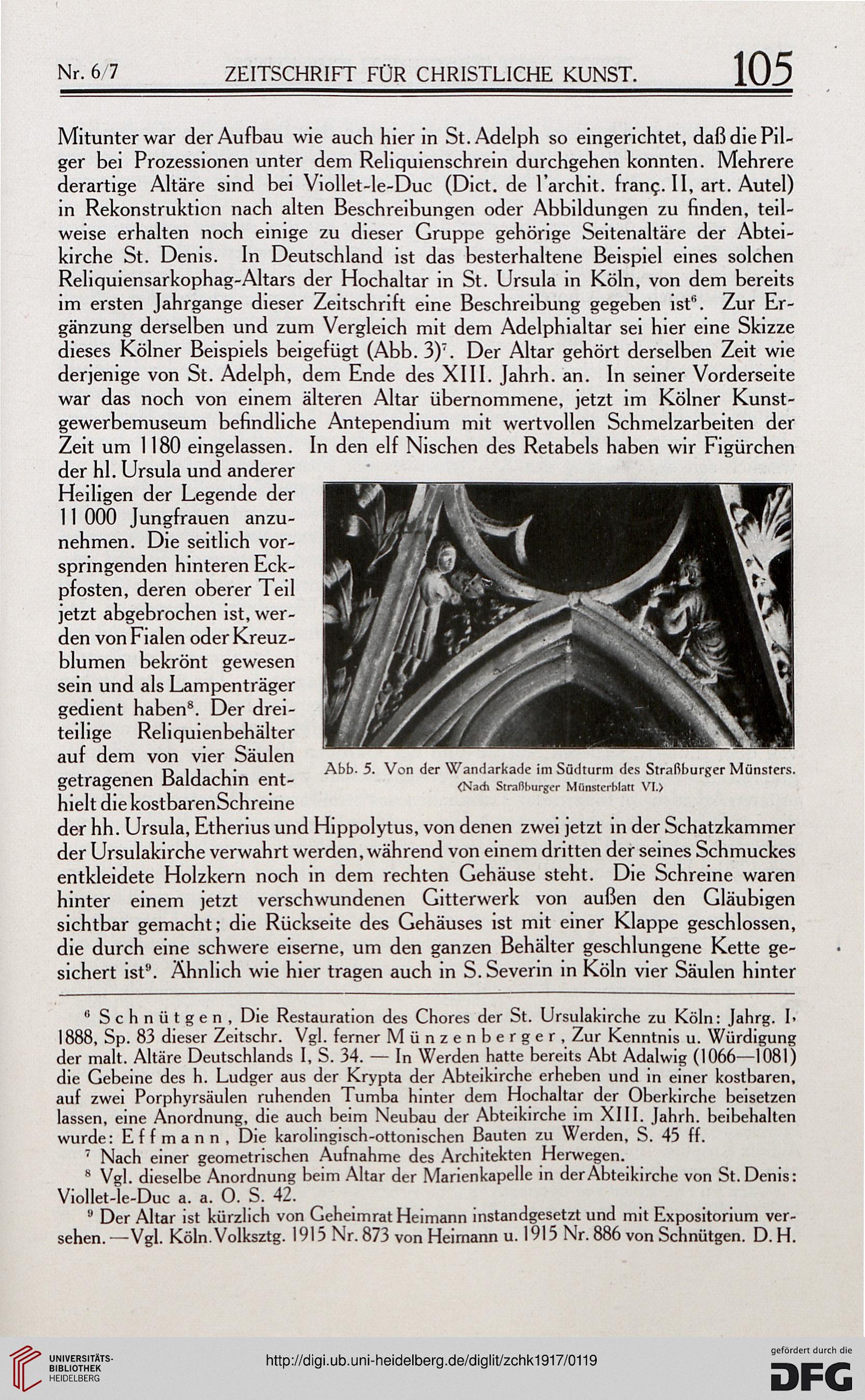Nr. 6/7
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
105
Mitunter war der Aufbau wie auch hier in St. Adelph so eingerichtet, daß die Pil-
ger bei Prozessionen unter dem Reliquienschrein durchgehen konnten. Mehrere
derartige Altäre sind bei Viollet-le-Duc (Dict. de l'archit. franc. II, art. Autel)
in Rekonstruktion nach alten Beschreibungen oder Abbildungen zu finden, teil-
weise erhalten noch einige zu dieser Gruppe gehörige Seitenaltäre der Abtei-
kirche St. Denis. In Deutschland ist das besterhaltene Beispiel eines solchen
Reliquiensarkophag-Altars der Hochaltar in St. Ursula in Köln, von dem bereits
im ersten Jahrgange dieser Zeitschrift eine Beschreibung gegeben ist*. Zur Er-
gänzung derselben und zum Vergleich mit dem Adelphialtar sei hier eine Skizze
dieses Kölner Beispiels beigefügt (Abb. 3)7. Der Altar gehört derselben Zeit wie
derjenige von St. Adelph, dem Ende des XIII. Jahrh. an. In seiner Vorderseite
war das noch von einem älteren Altar übernommene, jetzt im Kölner Kunst-
gewerbemuseum befindliche Antependium mit wertvollen Schmelzarbeiten der
Zeit um 1180 eingelassen. In den elf Nischen des Retabels haben wir Figürchen
der hl. Ursula und anderer
Heiligen der Legende der
11 000 Jungfrauen anzu-
nehmen. Die seitlich vor-
springenden hinteren Eck-
pfosten, deren oberer Teil
jetzt abgebrochen ist, wer-
den von Fialen oder Kreuz-
blumen bekrönt gewesen
sein und als Lampenträger
gedient haben8. Der drei-
teilige Reliquienbehälter
auf dem von vier Säulen
getragenen Baldachin ent-
hielt die kostbarenSchreine
der hh. Ursula, Ethenus und Hippolytus, von denen zwei jetzt in der Schatzkammer
der Ursulakirche verwahrt werden, während von einem dritten der seines Schmuckes
entkleidete Holzkern noch in dem rechten Gehäuse steht. Die Schreine waren
hinter einem jetzt verschwundenen Gitterwerk von außen den Gläubigen
sichtbar gemacht; die Rückseite des Gehäuses ist mit einer Klappe geschlossen,
die durch eine schwere eiserne, um den ganzen Behälter geschlungene Kette ge-
sichert ist9. Ähnlich wie hier tragen auch in S. Sevenn in Köln vier Säulen hinter
u Schnütgen, Die Restauration des Chores der St. Ursulakirche zu Köln: Jahrg. \<
1888, Sp. 83 dieser Zeitschr. Vgl. ferner Münzenberger, Zur Kenntnis u. Würdigung
der malt. Altäre Deutschlands I, S. 34. — In Werden hatte bereits Abt Adalwig (1066—1081)
die Gebeine des h. Ludger aus der Krypta der Abteikirche erheben und in einer kostbaren,
auf zwei Porphyrsäulen ruhenden Tumba hinter dem Hochaltar der Oberkirche beisetzen
lassen, eine Anordnung, die auch beim Neubau der Abteikirche im XIII. Jahrh. beibehalten
wurde: Effmann, Die karolingisch-ottonischen Bauten zu Werden, S. 45 ff.
T Nach einer geometrischen Aufnahme des Architekten Herwegen.
8 Vgl. dieselbe Anordnung beim Altar der Marienkapelle in der Abteikirche von St. Denis:
Viollet-le-Duc a. a. O. S. 42.
u Der Altar ist kürzlich von Geheimrat Heimann instandgesetzt und mit Expositorium ver-
sehen. —Vgl. Köln. Volksztg. 1915 Nr. 873 von Heimann u. 1915 Nr. 886 von Schnütgen. D. H.
Abb. 5. Von der Wandarkade im Südturm des Straßburger Münsters.
<Na<h Straßburgcr MOnstcrblatt VI.)
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
105
Mitunter war der Aufbau wie auch hier in St. Adelph so eingerichtet, daß die Pil-
ger bei Prozessionen unter dem Reliquienschrein durchgehen konnten. Mehrere
derartige Altäre sind bei Viollet-le-Duc (Dict. de l'archit. franc. II, art. Autel)
in Rekonstruktion nach alten Beschreibungen oder Abbildungen zu finden, teil-
weise erhalten noch einige zu dieser Gruppe gehörige Seitenaltäre der Abtei-
kirche St. Denis. In Deutschland ist das besterhaltene Beispiel eines solchen
Reliquiensarkophag-Altars der Hochaltar in St. Ursula in Köln, von dem bereits
im ersten Jahrgange dieser Zeitschrift eine Beschreibung gegeben ist*. Zur Er-
gänzung derselben und zum Vergleich mit dem Adelphialtar sei hier eine Skizze
dieses Kölner Beispiels beigefügt (Abb. 3)7. Der Altar gehört derselben Zeit wie
derjenige von St. Adelph, dem Ende des XIII. Jahrh. an. In seiner Vorderseite
war das noch von einem älteren Altar übernommene, jetzt im Kölner Kunst-
gewerbemuseum befindliche Antependium mit wertvollen Schmelzarbeiten der
Zeit um 1180 eingelassen. In den elf Nischen des Retabels haben wir Figürchen
der hl. Ursula und anderer
Heiligen der Legende der
11 000 Jungfrauen anzu-
nehmen. Die seitlich vor-
springenden hinteren Eck-
pfosten, deren oberer Teil
jetzt abgebrochen ist, wer-
den von Fialen oder Kreuz-
blumen bekrönt gewesen
sein und als Lampenträger
gedient haben8. Der drei-
teilige Reliquienbehälter
auf dem von vier Säulen
getragenen Baldachin ent-
hielt die kostbarenSchreine
der hh. Ursula, Ethenus und Hippolytus, von denen zwei jetzt in der Schatzkammer
der Ursulakirche verwahrt werden, während von einem dritten der seines Schmuckes
entkleidete Holzkern noch in dem rechten Gehäuse steht. Die Schreine waren
hinter einem jetzt verschwundenen Gitterwerk von außen den Gläubigen
sichtbar gemacht; die Rückseite des Gehäuses ist mit einer Klappe geschlossen,
die durch eine schwere eiserne, um den ganzen Behälter geschlungene Kette ge-
sichert ist9. Ähnlich wie hier tragen auch in S. Sevenn in Köln vier Säulen hinter
u Schnütgen, Die Restauration des Chores der St. Ursulakirche zu Köln: Jahrg. \<
1888, Sp. 83 dieser Zeitschr. Vgl. ferner Münzenberger, Zur Kenntnis u. Würdigung
der malt. Altäre Deutschlands I, S. 34. — In Werden hatte bereits Abt Adalwig (1066—1081)
die Gebeine des h. Ludger aus der Krypta der Abteikirche erheben und in einer kostbaren,
auf zwei Porphyrsäulen ruhenden Tumba hinter dem Hochaltar der Oberkirche beisetzen
lassen, eine Anordnung, die auch beim Neubau der Abteikirche im XIII. Jahrh. beibehalten
wurde: Effmann, Die karolingisch-ottonischen Bauten zu Werden, S. 45 ff.
T Nach einer geometrischen Aufnahme des Architekten Herwegen.
8 Vgl. dieselbe Anordnung beim Altar der Marienkapelle in der Abteikirche von St. Denis:
Viollet-le-Duc a. a. O. S. 42.
u Der Altar ist kürzlich von Geheimrat Heimann instandgesetzt und mit Expositorium ver-
sehen. —Vgl. Köln. Volksztg. 1915 Nr. 873 von Heimann u. 1915 Nr. 886 von Schnütgen. D. H.
Abb. 5. Von der Wandarkade im Südturm des Straßburger Münsters.
<Na<h Straßburgcr MOnstcrblatt VI.)