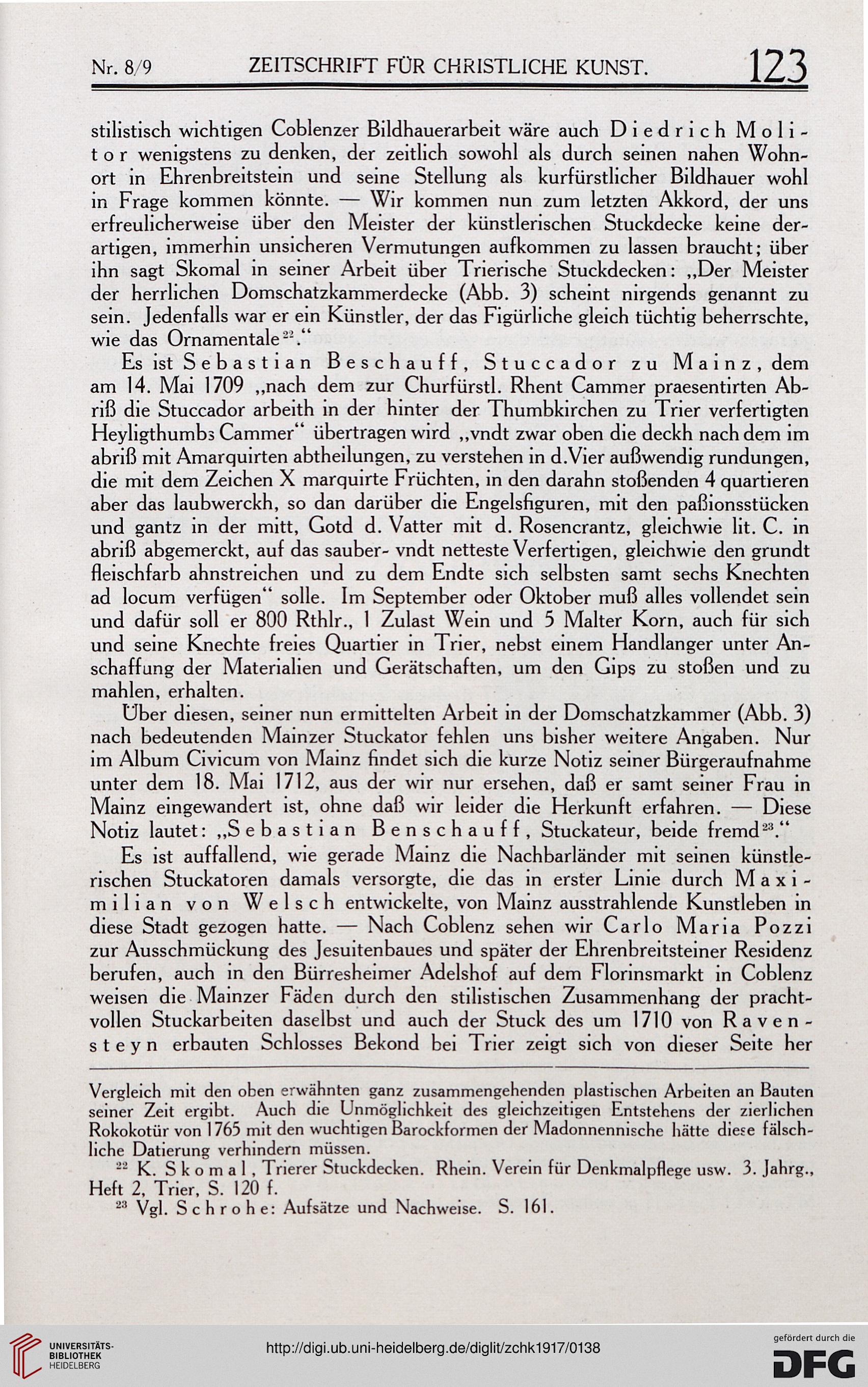Nr. 8 9 ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. 23
stilistisch wichtigen Coblenzer Bildhauerarbeit wäre auch Diedrich Moli-
tor wenigstens zu denken, der zeitlich sowohl als durch seinen nahen Wohn-
ort in Ehrenbreitstein und seine Stellung als kurfürstlicher Bildhauer wohl
in Frage kommen könnte. — Wir kommen nun zum letzten Akkord, der uns
erfreulicherweise über den Meister der künstlerischen Stuckdecke keine der-
artigen, immerhin unsicheren Vermutungen aufkommen zu lassen braucht; über
ihn sagt Skomal in seiner Arbeit über Trierische Stuckdecken: „Der Meister
der herrlichen Domschatzkammerdecke (Abb. 3) scheint nirgends genannt zu
sein. Jedenfalls war er ein Künstler, der das Figürliche gleich tüchtig beherrschte,
wie das Ornamentale22."
Es ist Sebastian Beschauff, Stuccador zu Mainz, dem
am 14. Mai 1709 „nach dem zur Churfürstl. Rhent Cammer praesentirten Ab-
riß die Stuccador arbeith in der hinter der Thumbkirchen zu Trier verfertigten
Heyligthumbs Cammer" übertragen wird „vndt zwar oben die deckh nach dem im
abriß mit Amarquirten abtheilungen, zu verstehen in d.Vier außwendig rundungen,
die mit dem Zeichen X marquirte Früchten, in den darahn stoßenden 4 quartieren
aber das laubwerckh, so dan darüber die Engelsfiguren, mit den paßionsstücken
und gantz in der mitt, Gotd d. Vatter mit d. Rosencrantz, gleichwie lit. C. in
abriß abgemerckt, auf das sauber- vndt netteste Verfertigen, gleichwie den grundt
fleischfarb ahnstreichen und zu dem Endte sich selbsten samt sechs Knechten
ad locum verfügen" solle. Im September oder Oktober muß alles vollendet sein
und dafür soll er 800 Rthlr., 1 Zulast Wein und 5 Malter Korn, auch für sich
und seine Knechte freies Quartier in Trier, nebst einem Handlanger unter An-
schaffung der Materialien und Gerätschaften, um den Gips zu stoßen und zu
mahlen, erhalten.
Über diesen, seiner nun ermittelten Arbeit in der Domschatzkammer (Abb. 3)
nach bedeutenden Mainzer Stuckator fehlen uns bisher weitere Angaben. Nur
im Album Ovicum von Mainz findet sich die kurze Notiz seiner Bürgeraufnahme
unter dem 18. Mai 1712, aus der wir nur ersehen, daß er samt seiner Frau in
Mainz eingewandert ist, ohne daß wir leider die Herkunft erfahren. — Diese
Notiz lautet: „Sebastian Benschauff, Stuckateur, beide fremd23."
Es ist auffallend, wie gerade Mainz die Nachbarländer mit seinen künstle-
rischen Stuckatoren damals versorgte, die das in erster Linie durch Maxi-
milian von Welsch entwickelte, von Mainz ausstrahlende Kunstleben in
diese Stadt gezogen hatte. — Nach Coblenz sehen wir Carlo Maria Pozzi
zur Ausschmückung des Jesuitenbaues und später der Ehrenbreitsteiner Residenz
berufen, auch in den Bürresheimer Adelshof auf dem Florinsmarkt in Coblenz
weisen die Mainzer Fäden durch den stilistischen Zusammenhang der pracht-
vollen Stuckarbeiten daselbst und auch der Stuck des um 1710 von Raven-
s t e y n erbauten Schlosses Bekond bei Trier zeigt sich von dieser Seite her
Vergleich mit den oben erwähnten ganz zusammengehenden plastischen Arbeiten an Bauten
seiner Zeit ergibt. Auch die Unmöglichkeit des gleichzeitigen Entstehens der zierlichen
Rokokotür von 1765 mit den wuchtigen Barockformen der Madonnennische hätte diese fälsch-
liche Datierung verhindern müssen.
22 K. Skomal, Trierer Stuckdecken. Rhein. Verein für Denkmalpflege usw. 3. Jahrg.,
Heft 2, Trier, S. 120 f.
23 Vgl. Seh rohe: Aufsätze und Nachweise. S. 161.
stilistisch wichtigen Coblenzer Bildhauerarbeit wäre auch Diedrich Moli-
tor wenigstens zu denken, der zeitlich sowohl als durch seinen nahen Wohn-
ort in Ehrenbreitstein und seine Stellung als kurfürstlicher Bildhauer wohl
in Frage kommen könnte. — Wir kommen nun zum letzten Akkord, der uns
erfreulicherweise über den Meister der künstlerischen Stuckdecke keine der-
artigen, immerhin unsicheren Vermutungen aufkommen zu lassen braucht; über
ihn sagt Skomal in seiner Arbeit über Trierische Stuckdecken: „Der Meister
der herrlichen Domschatzkammerdecke (Abb. 3) scheint nirgends genannt zu
sein. Jedenfalls war er ein Künstler, der das Figürliche gleich tüchtig beherrschte,
wie das Ornamentale22."
Es ist Sebastian Beschauff, Stuccador zu Mainz, dem
am 14. Mai 1709 „nach dem zur Churfürstl. Rhent Cammer praesentirten Ab-
riß die Stuccador arbeith in der hinter der Thumbkirchen zu Trier verfertigten
Heyligthumbs Cammer" übertragen wird „vndt zwar oben die deckh nach dem im
abriß mit Amarquirten abtheilungen, zu verstehen in d.Vier außwendig rundungen,
die mit dem Zeichen X marquirte Früchten, in den darahn stoßenden 4 quartieren
aber das laubwerckh, so dan darüber die Engelsfiguren, mit den paßionsstücken
und gantz in der mitt, Gotd d. Vatter mit d. Rosencrantz, gleichwie lit. C. in
abriß abgemerckt, auf das sauber- vndt netteste Verfertigen, gleichwie den grundt
fleischfarb ahnstreichen und zu dem Endte sich selbsten samt sechs Knechten
ad locum verfügen" solle. Im September oder Oktober muß alles vollendet sein
und dafür soll er 800 Rthlr., 1 Zulast Wein und 5 Malter Korn, auch für sich
und seine Knechte freies Quartier in Trier, nebst einem Handlanger unter An-
schaffung der Materialien und Gerätschaften, um den Gips zu stoßen und zu
mahlen, erhalten.
Über diesen, seiner nun ermittelten Arbeit in der Domschatzkammer (Abb. 3)
nach bedeutenden Mainzer Stuckator fehlen uns bisher weitere Angaben. Nur
im Album Ovicum von Mainz findet sich die kurze Notiz seiner Bürgeraufnahme
unter dem 18. Mai 1712, aus der wir nur ersehen, daß er samt seiner Frau in
Mainz eingewandert ist, ohne daß wir leider die Herkunft erfahren. — Diese
Notiz lautet: „Sebastian Benschauff, Stuckateur, beide fremd23."
Es ist auffallend, wie gerade Mainz die Nachbarländer mit seinen künstle-
rischen Stuckatoren damals versorgte, die das in erster Linie durch Maxi-
milian von Welsch entwickelte, von Mainz ausstrahlende Kunstleben in
diese Stadt gezogen hatte. — Nach Coblenz sehen wir Carlo Maria Pozzi
zur Ausschmückung des Jesuitenbaues und später der Ehrenbreitsteiner Residenz
berufen, auch in den Bürresheimer Adelshof auf dem Florinsmarkt in Coblenz
weisen die Mainzer Fäden durch den stilistischen Zusammenhang der pracht-
vollen Stuckarbeiten daselbst und auch der Stuck des um 1710 von Raven-
s t e y n erbauten Schlosses Bekond bei Trier zeigt sich von dieser Seite her
Vergleich mit den oben erwähnten ganz zusammengehenden plastischen Arbeiten an Bauten
seiner Zeit ergibt. Auch die Unmöglichkeit des gleichzeitigen Entstehens der zierlichen
Rokokotür von 1765 mit den wuchtigen Barockformen der Madonnennische hätte diese fälsch-
liche Datierung verhindern müssen.
22 K. Skomal, Trierer Stuckdecken. Rhein. Verein für Denkmalpflege usw. 3. Jahrg.,
Heft 2, Trier, S. 120 f.
23 Vgl. Seh rohe: Aufsätze und Nachweise. S. 161.