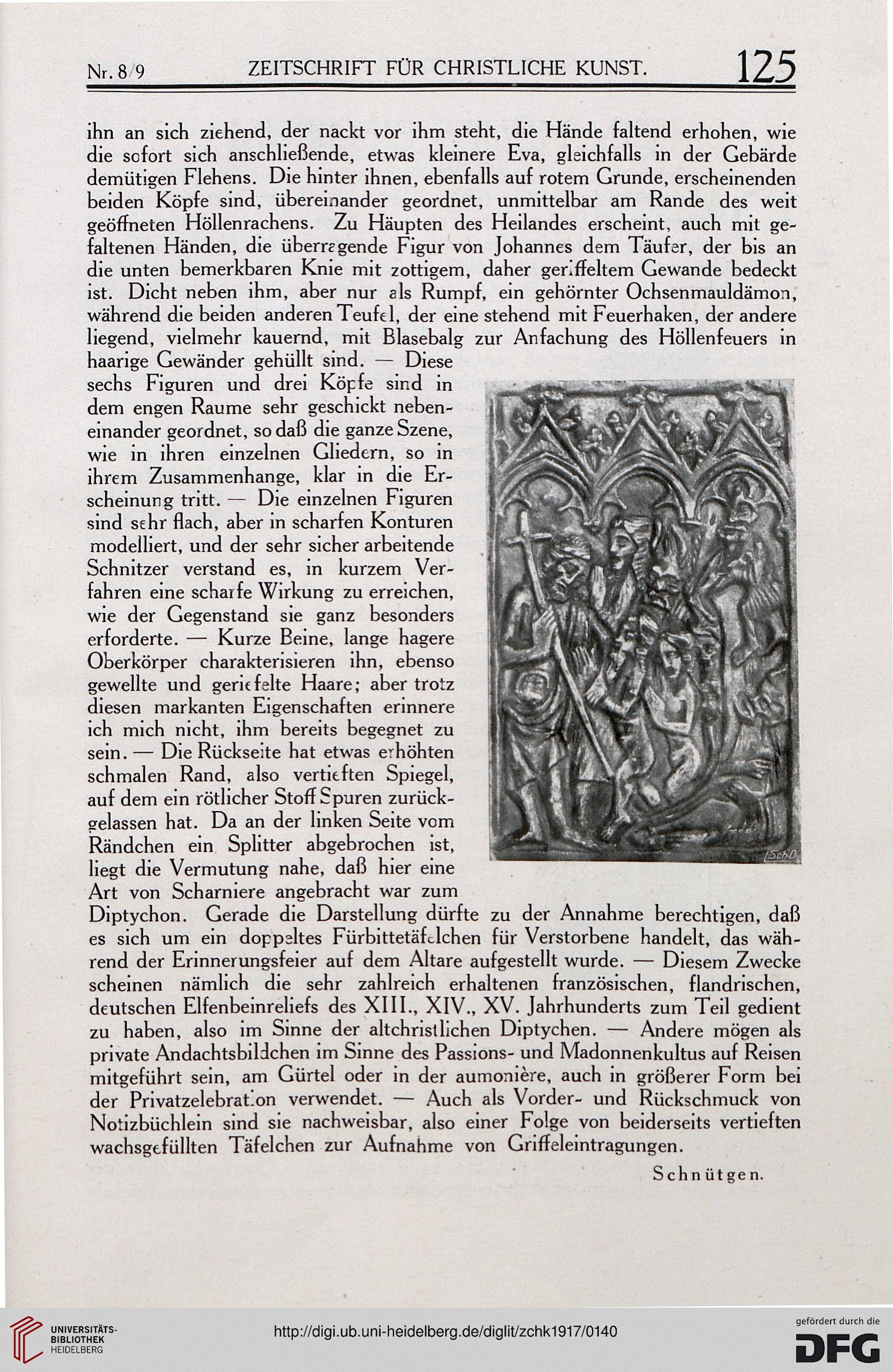Nr. 8 9
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
125
ihn an sich ziehend, der nackt vor ihm steht, die Hände faltend erhohen, wie
die sofort sich anschließende, etwas kleinere Eva, gleichfalls in der Gebärde
demütigen Flehens. Die hinter ihnen, ebenfalls auf rotem Grunde, erscheinenden
beiden Köpfe sind, übereinander geordnet, unmittelbar am Rande des weit
geöffneten Höllenrachens. Zu Häupten des Heilandes erscheint, auch mit ge-
faltenen Händen, die überregende Figur von Johannes dem Täufer, der bis an
die unten bemerkbaren Knie mit zottigem, daher geriffeltem Gewände bedeckt
ist. Dicht neben ihm, aber nur als Rumpf, ein gehörnter Ochsenmauldämon,
während die beiden anderen Teufel, der eine stehend mit Feuerhaken, der andere
liegend, vielmehr kauernd, mit Blasebalg zur Anfachung des Höllenfeuers in
haarige Gewänder gehüllt sind. — Diese
sechs Figuren und drei Köpfe sind in
dem engen Räume sehr geschickt neben-
einander geordnet, so daß die ganze Szene,
wie in ihren einzelnen Gliedern, so in
ihrem Zusammenhange, klar in die Er-
scheinung tritt. — Die einzelnen Figuren
sind sehr flach, aber in scharfen Konturen
modelliert, und der sehr sicher arbeitende
Schnitzer verstand es, in kurzem Ver-
fahren eine scharfe Wirkung zu erreichen,
wie der Gegenstand sie ganz besonders
erforderte. — Kurze Beine, lange hagere
Oberkörper charakterisieren ihn, ebenso
gewellte und geriefelte Haare; aber trotz
diesen markanten Eigenschaften erinnere
ich mich nicht, ihm bereits begegnet zu
sein. — Die Rückseite hat etwas erhöhten
schmalen Rand, also vertieften Spiegel,
auf dem ein rötlicher Stoff Spuren zurück-
gelassen hat. Da an der linken Seite vom
Rändchen ein Splitter abgebrochen ist,
liegt die Vermutung nahe, daß hier eine
Art von Scharniere angebracht war zum
Diptychon. Gerade die Darstellung dürfte zu der Annahme berechtigen, daß
es sich um ein doppsltes Fürbittetäfclchen für Verstorbene handelt, das wäh-
rend der Erinnerungsfeier auf dem Altare aufgestellt wurde. — Diesem Zwecke
scheinen nämlich die sehr zahlreich erhaltenen französischen, flandrischen,
deutschen Elfenbeinreliefs des XIII., XIV., XV. Jahrhunderts zum Teil gedient
zu haben, also im Sinne der altchristlichen Diptychen. — Andere mögen als
private AndachtsbiHchen im Sinne des Passions- und Madonnenkultus auf Reisen
mitgeführt sein, am Gürtel oder in der aumoniere, auch in größerer Form bei
der Privatzelebratlon verwendet. — Auch als Vorder- und Rückschmuck von
Notizbüchlein sind sie nachweisbar, also einer Folge von beiderseits vertieften
wachsgtfüllten Täfeichen zur Aufnahme von Griffeleintragungen.
Sehn üt ge n.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
125
ihn an sich ziehend, der nackt vor ihm steht, die Hände faltend erhohen, wie
die sofort sich anschließende, etwas kleinere Eva, gleichfalls in der Gebärde
demütigen Flehens. Die hinter ihnen, ebenfalls auf rotem Grunde, erscheinenden
beiden Köpfe sind, übereinander geordnet, unmittelbar am Rande des weit
geöffneten Höllenrachens. Zu Häupten des Heilandes erscheint, auch mit ge-
faltenen Händen, die überregende Figur von Johannes dem Täufer, der bis an
die unten bemerkbaren Knie mit zottigem, daher geriffeltem Gewände bedeckt
ist. Dicht neben ihm, aber nur als Rumpf, ein gehörnter Ochsenmauldämon,
während die beiden anderen Teufel, der eine stehend mit Feuerhaken, der andere
liegend, vielmehr kauernd, mit Blasebalg zur Anfachung des Höllenfeuers in
haarige Gewänder gehüllt sind. — Diese
sechs Figuren und drei Köpfe sind in
dem engen Räume sehr geschickt neben-
einander geordnet, so daß die ganze Szene,
wie in ihren einzelnen Gliedern, so in
ihrem Zusammenhange, klar in die Er-
scheinung tritt. — Die einzelnen Figuren
sind sehr flach, aber in scharfen Konturen
modelliert, und der sehr sicher arbeitende
Schnitzer verstand es, in kurzem Ver-
fahren eine scharfe Wirkung zu erreichen,
wie der Gegenstand sie ganz besonders
erforderte. — Kurze Beine, lange hagere
Oberkörper charakterisieren ihn, ebenso
gewellte und geriefelte Haare; aber trotz
diesen markanten Eigenschaften erinnere
ich mich nicht, ihm bereits begegnet zu
sein. — Die Rückseite hat etwas erhöhten
schmalen Rand, also vertieften Spiegel,
auf dem ein rötlicher Stoff Spuren zurück-
gelassen hat. Da an der linken Seite vom
Rändchen ein Splitter abgebrochen ist,
liegt die Vermutung nahe, daß hier eine
Art von Scharniere angebracht war zum
Diptychon. Gerade die Darstellung dürfte zu der Annahme berechtigen, daß
es sich um ein doppsltes Fürbittetäfclchen für Verstorbene handelt, das wäh-
rend der Erinnerungsfeier auf dem Altare aufgestellt wurde. — Diesem Zwecke
scheinen nämlich die sehr zahlreich erhaltenen französischen, flandrischen,
deutschen Elfenbeinreliefs des XIII., XIV., XV. Jahrhunderts zum Teil gedient
zu haben, also im Sinne der altchristlichen Diptychen. — Andere mögen als
private AndachtsbiHchen im Sinne des Passions- und Madonnenkultus auf Reisen
mitgeführt sein, am Gürtel oder in der aumoniere, auch in größerer Form bei
der Privatzelebratlon verwendet. — Auch als Vorder- und Rückschmuck von
Notizbüchlein sind sie nachweisbar, also einer Folge von beiderseits vertieften
wachsgtfüllten Täfeichen zur Aufnahme von Griffeleintragungen.
Sehn üt ge n.