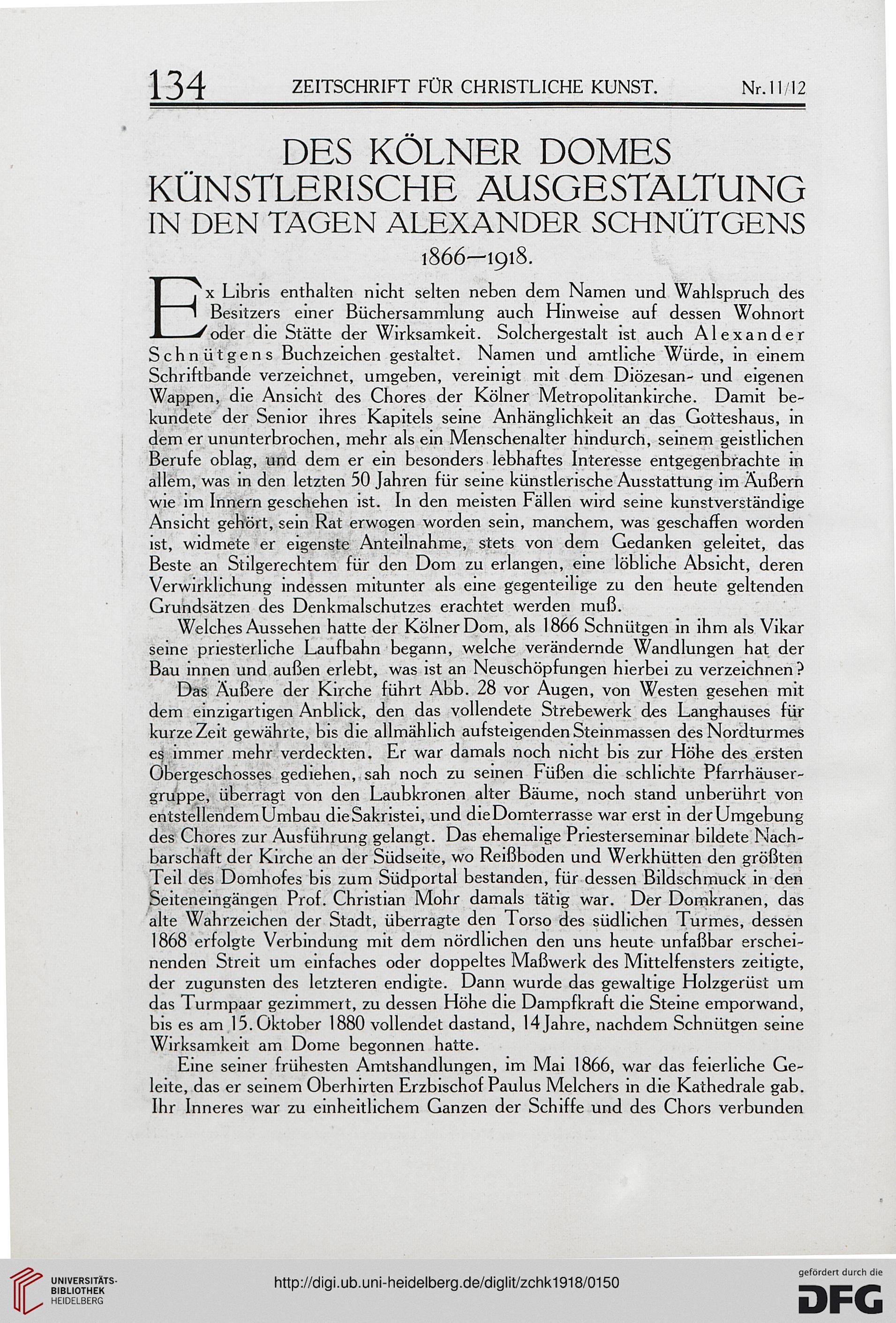E
34 ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 11 12
DES KÖLNER DOMES
KÜNSTLERISCHE AUSGESTALTUNG
IN DEN TAGEN ALEXANDER SCHNÜTGENS
1866-1918.
x Libris enthalten nicht selten neben dem Namen und Wahlspruch des
Besitzers einer Büchersammlung auch Hinweise auf dessen Wohnort
oder die Stätte der Wirksamkeit. Solchergestalt ist auch Alexander
Schnütgens Buchzeichen gestaltet. Namen und amtliche Würde, in einem
Schriftbande verzeichnet, umgeben, vereinigt mit dem Diözesan- und eigenen
Wappen, die Ansicht des Chores der Kölner Metropohtankirche. Damit be-
kundete der Senior ihres Kapitels seine Anhänglichkeit an das Gotteshaus, in
dem er ununterbrochen, mehr als ein Menschenalter hindurch, seinem geistlichen
Berufe oblag, und dem er ein besonders lebhaftes Interesse entgegenbrachte in
allem, was in den letzten 50 Jahren für seine künstlerische Ausstattung im Äußern
wie im Innern geschehen ist. In den meisten Fällen wird seine kunstverständige
Ansicht gehört, sein Rat erwogen worden sein, manchem, was geschaffen worden
ist, widmete er eigenste Anteilnahme, stets von dem Gedanken geleitet, das
Beste an Stilgerechtem für den Dom zu erlangen, eine löbliche Absicht, deren
Verwirklichung indessen mitunter als eine gegenteilige zu den heute geltenden
Grundsätzen des Denkmalschutzes erachtet werden muß.
Welches Aussehen hatte der Kölner Dom, als 1866 Schnütgen in ihm als Vikar
seine priesterliche Laufbahn begann, welche verändernde Wandlungen hat der
Bau innen und außen erlebt, was ist an Neuschöpfungen hierbei zu verzeichnen?
Das Äußere der Kirche führt Abb. 28 vor Augen, von Westen gesehen mit
dem einzigartigen Anblick, den das vollendete Strebewerk des Langhauses für
kurze Zeit gewährte, bis die allmählich aufsteigenden Steinmassen des Nordturmes
es immer mehr verdeckten. Er war damals noch nicht bis zur Höhe des ersten
Obergeschosses gediehen, sah noch zu seinen Füßen die schlichte Pfarrhäuser-
grüppe, überragt von den Laubkronen alter Bäume, noch stand unberührt von
entstellendem Umbau die Sakristei, und die Domterrasse war erst in der Umgebung
des Chores zur Ausführung gelangt. Das ehemalige Priesterseminar bildete Nach-
barschaft der Kirche an der Südseite, wo Reißboden und Werkhütten den größten
Teil des Domhofes bis zum Südportal bestanden, für dessen Bildschmuck in den
Seiteneingängen Prof. Christian Mohr damals tätig war. Der Domkranen, das
alte Wahrzeichen der Stadt, überragte den Torso des südlichen Turmes, dessen
1868 erfolgte Verbindung mit dem nördlichen den uns heute unfaßbar erschei-
nenden Streit um einfaches oder doppeltes Maßwerk des Mittelfensters zeitigte,
der zugunsten des letzteren endigte. Dann wurde das gewaltige Holzgerüst um
das Turmpaar gezimmert, zu dessen Höhe die Dampfkraft die Steine emporwand,
bis es am 15. Oktober 1880 vollendet dastand, 14Jahre, nachdem Schnütgen seine
Wirksamkeit am Dome begonnen hatte.
Eine seiner frühesten Amtshandlungen, im Mai 1866, war das feierliche Ge-
leite, das er seinem Oberhirten Erzbischof Paulus Melchers in die Kathedrale gab.
Ihr Inneres war zu einheitlichem Ganzen der Schiffe und des Chors verbunden
34 ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 11 12
DES KÖLNER DOMES
KÜNSTLERISCHE AUSGESTALTUNG
IN DEN TAGEN ALEXANDER SCHNÜTGENS
1866-1918.
x Libris enthalten nicht selten neben dem Namen und Wahlspruch des
Besitzers einer Büchersammlung auch Hinweise auf dessen Wohnort
oder die Stätte der Wirksamkeit. Solchergestalt ist auch Alexander
Schnütgens Buchzeichen gestaltet. Namen und amtliche Würde, in einem
Schriftbande verzeichnet, umgeben, vereinigt mit dem Diözesan- und eigenen
Wappen, die Ansicht des Chores der Kölner Metropohtankirche. Damit be-
kundete der Senior ihres Kapitels seine Anhänglichkeit an das Gotteshaus, in
dem er ununterbrochen, mehr als ein Menschenalter hindurch, seinem geistlichen
Berufe oblag, und dem er ein besonders lebhaftes Interesse entgegenbrachte in
allem, was in den letzten 50 Jahren für seine künstlerische Ausstattung im Äußern
wie im Innern geschehen ist. In den meisten Fällen wird seine kunstverständige
Ansicht gehört, sein Rat erwogen worden sein, manchem, was geschaffen worden
ist, widmete er eigenste Anteilnahme, stets von dem Gedanken geleitet, das
Beste an Stilgerechtem für den Dom zu erlangen, eine löbliche Absicht, deren
Verwirklichung indessen mitunter als eine gegenteilige zu den heute geltenden
Grundsätzen des Denkmalschutzes erachtet werden muß.
Welches Aussehen hatte der Kölner Dom, als 1866 Schnütgen in ihm als Vikar
seine priesterliche Laufbahn begann, welche verändernde Wandlungen hat der
Bau innen und außen erlebt, was ist an Neuschöpfungen hierbei zu verzeichnen?
Das Äußere der Kirche führt Abb. 28 vor Augen, von Westen gesehen mit
dem einzigartigen Anblick, den das vollendete Strebewerk des Langhauses für
kurze Zeit gewährte, bis die allmählich aufsteigenden Steinmassen des Nordturmes
es immer mehr verdeckten. Er war damals noch nicht bis zur Höhe des ersten
Obergeschosses gediehen, sah noch zu seinen Füßen die schlichte Pfarrhäuser-
grüppe, überragt von den Laubkronen alter Bäume, noch stand unberührt von
entstellendem Umbau die Sakristei, und die Domterrasse war erst in der Umgebung
des Chores zur Ausführung gelangt. Das ehemalige Priesterseminar bildete Nach-
barschaft der Kirche an der Südseite, wo Reißboden und Werkhütten den größten
Teil des Domhofes bis zum Südportal bestanden, für dessen Bildschmuck in den
Seiteneingängen Prof. Christian Mohr damals tätig war. Der Domkranen, das
alte Wahrzeichen der Stadt, überragte den Torso des südlichen Turmes, dessen
1868 erfolgte Verbindung mit dem nördlichen den uns heute unfaßbar erschei-
nenden Streit um einfaches oder doppeltes Maßwerk des Mittelfensters zeitigte,
der zugunsten des letzteren endigte. Dann wurde das gewaltige Holzgerüst um
das Turmpaar gezimmert, zu dessen Höhe die Dampfkraft die Steine emporwand,
bis es am 15. Oktober 1880 vollendet dastand, 14Jahre, nachdem Schnütgen seine
Wirksamkeit am Dome begonnen hatte.
Eine seiner frühesten Amtshandlungen, im Mai 1866, war das feierliche Ge-
leite, das er seinem Oberhirten Erzbischof Paulus Melchers in die Kathedrale gab.
Ihr Inneres war zu einheitlichem Ganzen der Schiffe und des Chors verbunden