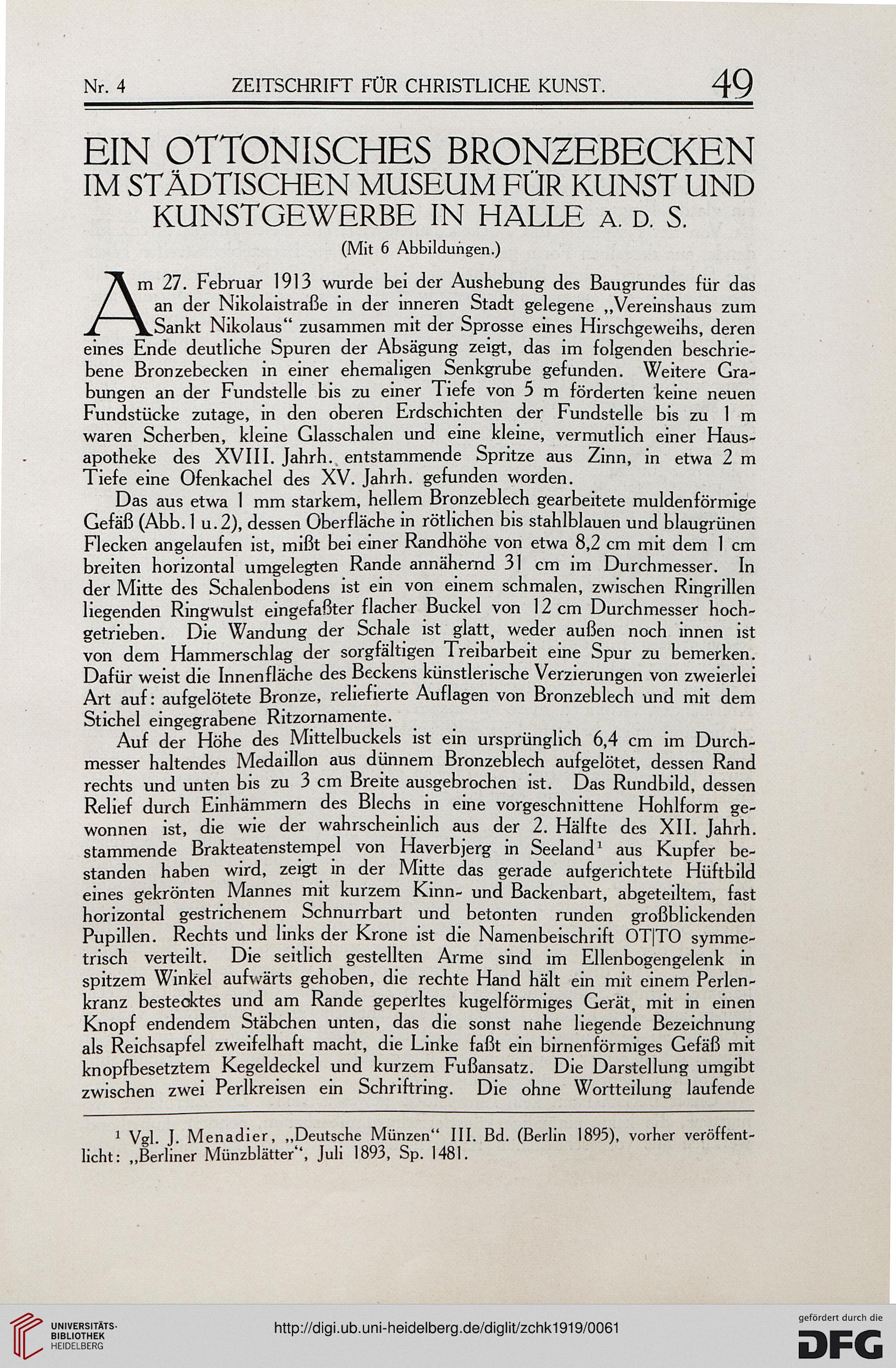Nr. 4 ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. 49
EIN OTTONISCHES BRONZEBECKEN
IM STÄDTISCHEN MUSEUM FÜR KUNST UND
KUNSTGEWERBE IN HALLE a. d. S.
(Mit 6 Abbildungen.)
~\ m 27. Februar 1913 wurde bei der Aushebung des Baugrundes für das
/ \ an der Nikolaistraße in der inneren Stadt gelegene „Vereinshaus zum
±_ \.Sankt Nikolaus" zusammen mit der Sprosse eines Hirschgeweihs, deren
eines Ende deutliehe Spuren der Absägung zeigt, das im folgenden beschrie-
bene Bronzebecken in einer ehemaligen Senkgrube gefunden. Weitere Gra-
bungen an der Fundstelle bis zu einer Tiefe von 5 m förderten keine neuen
Fundstücke zutage, in den oberen Erdschichten der Fundstelle bis zu 1 m
waren Scherben, kleine Glasschalen und eine kleine, vermutlich einer Haus-
apotheke des XVIII. Jahrh. entstammende Spritze aus Zinn, in etwa 2 m
Tiefe eine Ofenkachel des XV. Jahrh. gefunden worden.
Das aus etwa 1 mm starkem, hellem Bronzeblech gearbeitete muldenförmige
Gefäß (Abb. 1 u.2), dessen Oberfläche in rötlichen bis stahlblauen und blaugrünen
Flecken angelaufen ist, mißt bei einer Randhöhe von etwa 8,2 cm mit dem 1 cm
breiten horizontal umgelegten Rande annähernd 31 cm im Durchmesser. In
der Mitte des Schalenbodens ist ein von einem schmalen, zwischen Ringrillen
liegenden Ringwulst eingefaßter flacher Buckel von 12 cm Durchmesser hoch-
getrieben. Die Wandung der Schale ist glatt, weder außen noch innen ist
von dem Hammerschlag der sorgfältigen Treibarbeit eine Spur zu bemerken.
Dafür weist die Innenfläche des Beckens künstlerische Verzierungen von zweierlei
Art auf: aufgelötete Bronze, rehefierte Auflagen von Bronzeblech und mit dem
Stichel eingegrabene Ritzornamente.
Auf der Höhe des Mittelbuckels ist ein ursprünglich 6,4 cm im Durch-
messer haltendes Medaillon aus dünnem Bronzeblech aufgelötet, dessen Rand
rechts und unten bis zu 3 cm Breite ausgebrochen ist. Das Rundbild, dessen
Relief durch Einhämmern des Blechs in eine vorgeschnittene Hohlform ge-
wonnen ist, die wie der wahrscheinlich aus der 2. Hälfte des XII. Jahrh.
stammende Brakteatenstempel von Haverbjerg in Seeland1 aus Kupfer be-
standen haben wird, zeigt in der Mitte das gerade aufgerichtete Hüftbild
eines gekrönten Mannes mit kurzem Kinn- und Backenbart, abgeteiltem, fast
horizontal gestrichenem Schnurrbart und betonten runden großblickenden
Pupillen. Rechts und links der Krone ist die Namenbeischrift OT|TO symme-
trisch verteilt. Die seitlich gestellten Arme sind im Ellenbogengelenk in
spitzem Winkel aufwärts gehoben, die rechte Hand hält ein mit einem Perlen-
kranz bestecktes und am Rande geperltes kugelförmiges Gerät, mit in einen
Knopf endendem Stäbchen unten, das die sonst nahe liegende Bezeichnung
als Reichsapfel zweifelhaft macht, die Linke faßt ein birnenförmiges Gefäß mit
knöpf besetztem Kegeldeckel und kurzem Fußansatz. Die Darstellung umgibt
zwischen zwei Perlkreisen ein Schriftring. Die ohne Wortteilung laufende
1 Vgl J Menadier, „Deutsche Münzen" III. Bd. (Berlin 1895), vorher veröf
;: „Berliner Münzblätter", Juli 1893, Sp. 1481.
EIN OTTONISCHES BRONZEBECKEN
IM STÄDTISCHEN MUSEUM FÜR KUNST UND
KUNSTGEWERBE IN HALLE a. d. S.
(Mit 6 Abbildungen.)
~\ m 27. Februar 1913 wurde bei der Aushebung des Baugrundes für das
/ \ an der Nikolaistraße in der inneren Stadt gelegene „Vereinshaus zum
±_ \.Sankt Nikolaus" zusammen mit der Sprosse eines Hirschgeweihs, deren
eines Ende deutliehe Spuren der Absägung zeigt, das im folgenden beschrie-
bene Bronzebecken in einer ehemaligen Senkgrube gefunden. Weitere Gra-
bungen an der Fundstelle bis zu einer Tiefe von 5 m förderten keine neuen
Fundstücke zutage, in den oberen Erdschichten der Fundstelle bis zu 1 m
waren Scherben, kleine Glasschalen und eine kleine, vermutlich einer Haus-
apotheke des XVIII. Jahrh. entstammende Spritze aus Zinn, in etwa 2 m
Tiefe eine Ofenkachel des XV. Jahrh. gefunden worden.
Das aus etwa 1 mm starkem, hellem Bronzeblech gearbeitete muldenförmige
Gefäß (Abb. 1 u.2), dessen Oberfläche in rötlichen bis stahlblauen und blaugrünen
Flecken angelaufen ist, mißt bei einer Randhöhe von etwa 8,2 cm mit dem 1 cm
breiten horizontal umgelegten Rande annähernd 31 cm im Durchmesser. In
der Mitte des Schalenbodens ist ein von einem schmalen, zwischen Ringrillen
liegenden Ringwulst eingefaßter flacher Buckel von 12 cm Durchmesser hoch-
getrieben. Die Wandung der Schale ist glatt, weder außen noch innen ist
von dem Hammerschlag der sorgfältigen Treibarbeit eine Spur zu bemerken.
Dafür weist die Innenfläche des Beckens künstlerische Verzierungen von zweierlei
Art auf: aufgelötete Bronze, rehefierte Auflagen von Bronzeblech und mit dem
Stichel eingegrabene Ritzornamente.
Auf der Höhe des Mittelbuckels ist ein ursprünglich 6,4 cm im Durch-
messer haltendes Medaillon aus dünnem Bronzeblech aufgelötet, dessen Rand
rechts und unten bis zu 3 cm Breite ausgebrochen ist. Das Rundbild, dessen
Relief durch Einhämmern des Blechs in eine vorgeschnittene Hohlform ge-
wonnen ist, die wie der wahrscheinlich aus der 2. Hälfte des XII. Jahrh.
stammende Brakteatenstempel von Haverbjerg in Seeland1 aus Kupfer be-
standen haben wird, zeigt in der Mitte das gerade aufgerichtete Hüftbild
eines gekrönten Mannes mit kurzem Kinn- und Backenbart, abgeteiltem, fast
horizontal gestrichenem Schnurrbart und betonten runden großblickenden
Pupillen. Rechts und links der Krone ist die Namenbeischrift OT|TO symme-
trisch verteilt. Die seitlich gestellten Arme sind im Ellenbogengelenk in
spitzem Winkel aufwärts gehoben, die rechte Hand hält ein mit einem Perlen-
kranz bestecktes und am Rande geperltes kugelförmiges Gerät, mit in einen
Knopf endendem Stäbchen unten, das die sonst nahe liegende Bezeichnung
als Reichsapfel zweifelhaft macht, die Linke faßt ein birnenförmiges Gefäß mit
knöpf besetztem Kegeldeckel und kurzem Fußansatz. Die Darstellung umgibt
zwischen zwei Perlkreisen ein Schriftring. Die ohne Wortteilung laufende
1 Vgl J Menadier, „Deutsche Münzen" III. Bd. (Berlin 1895), vorher veröf
;: „Berliner Münzblätter", Juli 1893, Sp. 1481.