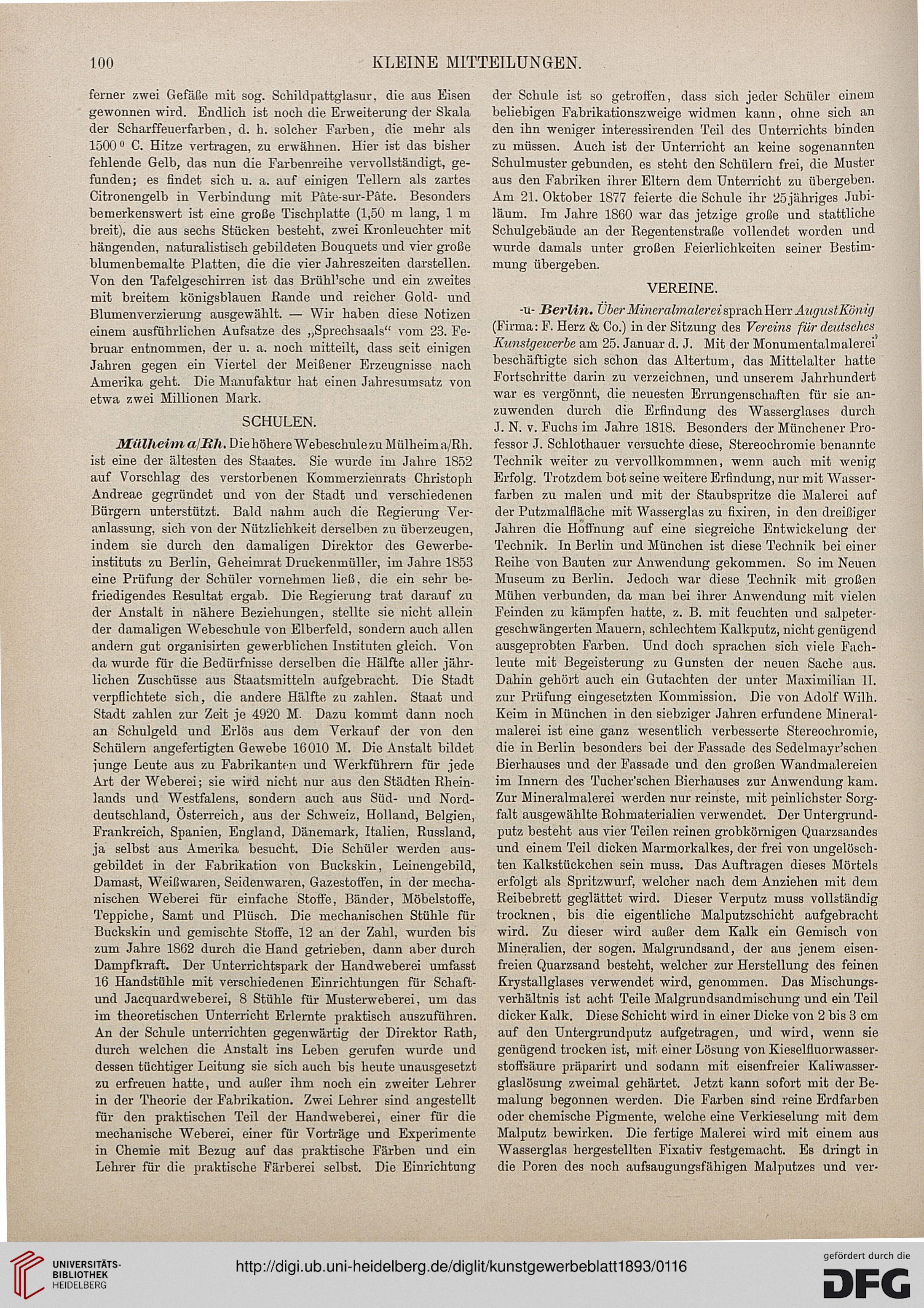100
KLEINE MITTEILUNGEN.
femer zwei Gefäße mit sog. Schildpattglasur, die aus Eisen
gewonnen wird. Endlieh ist noch die Erweiterung der Skala
der Seharffeuerfarben, d. h. solcher Farben, die mehr als
1500 ° C. Hitze vertragen, zu erwähnen. Hier ist das bisher
fehlende Gelb, das nun die Farbenreihe vervollständigt, ge-
funden; es findet sich u. a. auf einigen Tellern als zartes
Citronengelb in Verbindung mit Päte-sur-Päte. Besonders
bemerkenswert ist eine große Tischplatte (1,50 m lang, 1 m
breit), die aus sechs Stücken besteht, zwei Kronleuchter mit
hängenden, naturalistisch gebildeten Bouquets und vier große
blumenbemalte Platten, die die vier Jahreszeiten darstellen.
Von den Tafelgeschirren ist das Brühl'sche und ein zweites
mit breitem königsblauen Bande und reicher Gold- und
Blumenverzierung ausgewählt. — Wir haben diese Notizen
einem ausführlichen Aufsatze des „Sprechsaals" vom 23. Fe-
bruar entnommen, der u. a. noch mitteilt, dass seit einigen
Jahren gegen ein Viertel der Meißener Erzeugnisse nach
Amerika geht. Die Manufaktur hat einen Jahresumsatz von
etwa zwei Millionen Mark.
SCHULEN.
Mülheim a/Mh. Die höhere Webeschule zu Mülheim a/Rh.
ist eine der ältesten des Staates. Sie wurde im Jahre 1852
auf Vorsehlag des verstorbenen Kommerzienrats Christoph
Andreae gegründet und von der Stadt und verschiedenen
Bürgern unterstützt. Bald nahm auch die Regierung Ver-
anlassung, sieh von der Nützlichkeit derselben zu überzeugen,
indem sie durch den damaligen Direktor des Gewerbe-
instituts zu Berlin, Geheimrat Druckenmüller, im Jahre 1853
eine Prüfung der Schüler vornehmen ließ, die ein sehr be-
friedigendes Resultat ergab. Die Regierung trat darauf zu
der Anstalt in nähere Beziehungen, stellte sie nicht allein
der damaligen Webeschule von Elberfeld, sondern auch allen
andern gut organisirten gewerblichen Instituten gleich. Von
da wurde für die Bedürfnisse derselben die Hälfte aller jähr-
lichen Zuschüsse aus Staatsmitteln aufgebracht. Die Stadt
verpflichtete sich, die andere Hälfte zu zahlen. Staat und
Stadt zahlen zur Zeit je 4920 M. Dazu kommt dann noch
an Schulgeld und Erlös aus dem Verkauf der von den
Schülern angefertigten Gewebe 16010 M. Die Anstalt bildet
junge Leute aus zu Fabrikanten und Werkführem für jede
Art der Weberei; sie wird nicht nur aus den Städten Rhein-
lands und Westfalens, sondern auch aus Süd- und Nord-
deutschland, Österreich, aus der Schweiz, Holland, Belgien,
Frankreich, Spanien, England, Dänemark, Italien, Russland,
ja selbst aus Amerika besucht. Die Schüler werden aus-
gebildet in der Fabrikation von Buckskin, Leinengebild,
Damast, Weißwaren, Seidenwaren, Gazestoffen, in der mecha-
nischen Weberei für einfache Stoffe, Bänder, Möbelstoffe,
Teppiche, Samt und Plüsch. Die mechanischen Stühle für
Buckskin und gemischte Stoffe, 12 an der Zahl, wurden bis
zum Jahre 1862 durch die Hand getrieben, dann aber durch
Dampfkraft. Der Unterrichtspark der Handweberei umfasst
16 Handstühle mit verschiedenen Einrichtungen für Schaft-
und Jacquardweberei, 8 Stühle für Musterweberei, um das
im theoretischen Unterricht Erlernte praktisch auszuführen.
An der Schule unterrichten gegenwärtig der Direktor Rath,
durch welchen die Anstalt ins Leben gerufen wurde und
dessen tüchtiger Leitung sie sich auch bis heute unausgesetzt
zu erfreuen hatte, und außer ihm noch ein zweiter Lehrer
in der Theorie der Fabrikation. Zwei Lehrer sind angestellt
für den praktischen Teil der Handweberei, einer für die
mechanische Weberei, einer für Vorträge und Experimente
in Chemie mit Bezug auf das praktische Färben und ein
Lehrer für die praktische Färberei selbst. Die Einrichtung
der Schule ist so getroffen, dass sich jeder Schüler einem
beliebigen Fabrikationszweige widmen kann, ohne sich an
den ihn weniger interessirenden Teil des Unterrichts binden
zu müssen. Auch ist der Unterricht an keine sogenannten
Schulmuster gebunden, es steht den Schülern frei, die Muster
aus den Fabriken ihrer Eltern dem Unterricht zu übergeben.
Am 21. Oktober 1877 feierte die Schule ihr 25jähriges Jubi-
läum. Im Jahre 1860 war das jetzige große und stattliche
Schulgebäude an der Regentenstraße vollendet worden und
wurde damals unter großen Feierlichkeiten seiner Bestim-
mung übergeben.
VEREINE.
-u- Berlin, über Miner■almalereis-pi'&ch.KeriAugttstKönig
(Firma: F. Herz & Co.) in der Sitzung des Vereins für deutsches
Kunstgewerbe am 25. Januar d. J. Mit der Monumentalmalerei
beschäftigte sich schon das Altertum, das Mittelalter hatte
Fortschritte darin zu verzeichnen, und unserem Jahrhundert
war es vergönnt, die neuesten Errungenschaften für sie an-
zuwenden durch die Erfindung des Wasserglases durch
J. N. v. Fuchs im Jahre 1818. Besonders der Münchener Pro-
fessor J. Schlothauer versuchte diese, Stereochromie benannte
Technik weiter zu vervollkommnen, wenn auch mit wenig
Erfolg. Trotzdem bot seine weitere Erfindung, nur mit Wasser-
farben zu malen und mit der Staubspritze die Malerei auf
der Putzmalfläche mit Wasserglas zu fixiren, in den dreißiger
Jahren die Hoffnung auf eine siegreiche Entwickelung der
Technik. In Berlin und München ist diese Technik bei einer
Reihe von Bauten zur Anwendung gekommen. So im Neuen
Museum zu Berlin. Jedoch war diese Technik mit großen
Mühen verbunden, da man bei ihrer Anwendung mit vielen
Feinden zu kämpfen hatte, z. B. mit feuchten und salpeter-
geschwängerten Mauern, schlechtem Kalkputz, nicht genügend
ausgeprobten Farben. Und doch sprachen sich viele Fach-
leute mit Begeisterung zu Gunsten der neuen Sache aus.
Dahin gehört auch ein Gutachten der unter Maximilian II.
zur Prüfung eingesetzten Kommission. Die von Adolf Wilh.
Keim in München in den siebziger Jahren erfundene Mineral-
malerei ist eine ganz wesentlich verbesserte Stereochromie,
die in Berlin besonders bei der Fassade des Sedelmayr'schen
Bierhauses und der Fassade und den großen Wandmalereien
im Innern des Tucher'schen Bierhauses zur Anwendung kam.
Zur Mineralmalerei werden nur reinste, mit peinlichster Sorg-
falt ausgewählte Rohmaterialien verwendet. Der Untergrund-
putz besteht aus vier Teilen reinen grobkörnigen Quarzsandes
und einem Teil dicken Marmorkalkes, der frei von ungelösch-
ten Kalkstückchen sein muss. Das Auftragen dieses Mörtels
erfolgt als Spritzwurf, welcher nach dem Anziehen mit dem
Reibebrett geglättet wird. Dieser Verputz muss vollständig
trocknen, bis die eigentliche Malputzschicht aufgebracht
wird. Zu dieser wird außer dem Kalk ein Gemisch von
Mineralien, der sogen. Malgrundsand, der aus jenem eisen-
freien Quarzsand besteht, welcher zur Herstellung des feinen
Krystallglases verwendet wird, genommen. Das Mischungs-
verhältnis ist acht. Teile Malgrundsandmischung und ein Teil
dicker Kalk. Diese Schicht wird in einer Dicke von 2 bis 3 cm
auf den Untergrundputz aufgetragen, und wird, wenn sie
genügend trocken ist, mit einer Lösung von Kieselfluorwasser-
stoffsäure präparirt und sodann mit eisenfreier Kaliwasser-
glaslösung zweimal gehärtet. Jetzt kann sofort mit der Be-
malung begonnen werden. Die Farben sind reine Erdfarben
oder chemische Pigmente, welche eine Verkieselung mit dem
Malputz bewirken. Die fertige Malerei wird mit einem aus
Wasserglas hergestellten Fixativ festgemacht. Es dringt in
die Poren des noch aufsaugungsfähigen Malputzes und ver-
KLEINE MITTEILUNGEN.
femer zwei Gefäße mit sog. Schildpattglasur, die aus Eisen
gewonnen wird. Endlieh ist noch die Erweiterung der Skala
der Seharffeuerfarben, d. h. solcher Farben, die mehr als
1500 ° C. Hitze vertragen, zu erwähnen. Hier ist das bisher
fehlende Gelb, das nun die Farbenreihe vervollständigt, ge-
funden; es findet sich u. a. auf einigen Tellern als zartes
Citronengelb in Verbindung mit Päte-sur-Päte. Besonders
bemerkenswert ist eine große Tischplatte (1,50 m lang, 1 m
breit), die aus sechs Stücken besteht, zwei Kronleuchter mit
hängenden, naturalistisch gebildeten Bouquets und vier große
blumenbemalte Platten, die die vier Jahreszeiten darstellen.
Von den Tafelgeschirren ist das Brühl'sche und ein zweites
mit breitem königsblauen Bande und reicher Gold- und
Blumenverzierung ausgewählt. — Wir haben diese Notizen
einem ausführlichen Aufsatze des „Sprechsaals" vom 23. Fe-
bruar entnommen, der u. a. noch mitteilt, dass seit einigen
Jahren gegen ein Viertel der Meißener Erzeugnisse nach
Amerika geht. Die Manufaktur hat einen Jahresumsatz von
etwa zwei Millionen Mark.
SCHULEN.
Mülheim a/Mh. Die höhere Webeschule zu Mülheim a/Rh.
ist eine der ältesten des Staates. Sie wurde im Jahre 1852
auf Vorsehlag des verstorbenen Kommerzienrats Christoph
Andreae gegründet und von der Stadt und verschiedenen
Bürgern unterstützt. Bald nahm auch die Regierung Ver-
anlassung, sieh von der Nützlichkeit derselben zu überzeugen,
indem sie durch den damaligen Direktor des Gewerbe-
instituts zu Berlin, Geheimrat Druckenmüller, im Jahre 1853
eine Prüfung der Schüler vornehmen ließ, die ein sehr be-
friedigendes Resultat ergab. Die Regierung trat darauf zu
der Anstalt in nähere Beziehungen, stellte sie nicht allein
der damaligen Webeschule von Elberfeld, sondern auch allen
andern gut organisirten gewerblichen Instituten gleich. Von
da wurde für die Bedürfnisse derselben die Hälfte aller jähr-
lichen Zuschüsse aus Staatsmitteln aufgebracht. Die Stadt
verpflichtete sich, die andere Hälfte zu zahlen. Staat und
Stadt zahlen zur Zeit je 4920 M. Dazu kommt dann noch
an Schulgeld und Erlös aus dem Verkauf der von den
Schülern angefertigten Gewebe 16010 M. Die Anstalt bildet
junge Leute aus zu Fabrikanten und Werkführem für jede
Art der Weberei; sie wird nicht nur aus den Städten Rhein-
lands und Westfalens, sondern auch aus Süd- und Nord-
deutschland, Österreich, aus der Schweiz, Holland, Belgien,
Frankreich, Spanien, England, Dänemark, Italien, Russland,
ja selbst aus Amerika besucht. Die Schüler werden aus-
gebildet in der Fabrikation von Buckskin, Leinengebild,
Damast, Weißwaren, Seidenwaren, Gazestoffen, in der mecha-
nischen Weberei für einfache Stoffe, Bänder, Möbelstoffe,
Teppiche, Samt und Plüsch. Die mechanischen Stühle für
Buckskin und gemischte Stoffe, 12 an der Zahl, wurden bis
zum Jahre 1862 durch die Hand getrieben, dann aber durch
Dampfkraft. Der Unterrichtspark der Handweberei umfasst
16 Handstühle mit verschiedenen Einrichtungen für Schaft-
und Jacquardweberei, 8 Stühle für Musterweberei, um das
im theoretischen Unterricht Erlernte praktisch auszuführen.
An der Schule unterrichten gegenwärtig der Direktor Rath,
durch welchen die Anstalt ins Leben gerufen wurde und
dessen tüchtiger Leitung sie sich auch bis heute unausgesetzt
zu erfreuen hatte, und außer ihm noch ein zweiter Lehrer
in der Theorie der Fabrikation. Zwei Lehrer sind angestellt
für den praktischen Teil der Handweberei, einer für die
mechanische Weberei, einer für Vorträge und Experimente
in Chemie mit Bezug auf das praktische Färben und ein
Lehrer für die praktische Färberei selbst. Die Einrichtung
der Schule ist so getroffen, dass sich jeder Schüler einem
beliebigen Fabrikationszweige widmen kann, ohne sich an
den ihn weniger interessirenden Teil des Unterrichts binden
zu müssen. Auch ist der Unterricht an keine sogenannten
Schulmuster gebunden, es steht den Schülern frei, die Muster
aus den Fabriken ihrer Eltern dem Unterricht zu übergeben.
Am 21. Oktober 1877 feierte die Schule ihr 25jähriges Jubi-
läum. Im Jahre 1860 war das jetzige große und stattliche
Schulgebäude an der Regentenstraße vollendet worden und
wurde damals unter großen Feierlichkeiten seiner Bestim-
mung übergeben.
VEREINE.
-u- Berlin, über Miner■almalereis-pi'&ch.KeriAugttstKönig
(Firma: F. Herz & Co.) in der Sitzung des Vereins für deutsches
Kunstgewerbe am 25. Januar d. J. Mit der Monumentalmalerei
beschäftigte sich schon das Altertum, das Mittelalter hatte
Fortschritte darin zu verzeichnen, und unserem Jahrhundert
war es vergönnt, die neuesten Errungenschaften für sie an-
zuwenden durch die Erfindung des Wasserglases durch
J. N. v. Fuchs im Jahre 1818. Besonders der Münchener Pro-
fessor J. Schlothauer versuchte diese, Stereochromie benannte
Technik weiter zu vervollkommnen, wenn auch mit wenig
Erfolg. Trotzdem bot seine weitere Erfindung, nur mit Wasser-
farben zu malen und mit der Staubspritze die Malerei auf
der Putzmalfläche mit Wasserglas zu fixiren, in den dreißiger
Jahren die Hoffnung auf eine siegreiche Entwickelung der
Technik. In Berlin und München ist diese Technik bei einer
Reihe von Bauten zur Anwendung gekommen. So im Neuen
Museum zu Berlin. Jedoch war diese Technik mit großen
Mühen verbunden, da man bei ihrer Anwendung mit vielen
Feinden zu kämpfen hatte, z. B. mit feuchten und salpeter-
geschwängerten Mauern, schlechtem Kalkputz, nicht genügend
ausgeprobten Farben. Und doch sprachen sich viele Fach-
leute mit Begeisterung zu Gunsten der neuen Sache aus.
Dahin gehört auch ein Gutachten der unter Maximilian II.
zur Prüfung eingesetzten Kommission. Die von Adolf Wilh.
Keim in München in den siebziger Jahren erfundene Mineral-
malerei ist eine ganz wesentlich verbesserte Stereochromie,
die in Berlin besonders bei der Fassade des Sedelmayr'schen
Bierhauses und der Fassade und den großen Wandmalereien
im Innern des Tucher'schen Bierhauses zur Anwendung kam.
Zur Mineralmalerei werden nur reinste, mit peinlichster Sorg-
falt ausgewählte Rohmaterialien verwendet. Der Untergrund-
putz besteht aus vier Teilen reinen grobkörnigen Quarzsandes
und einem Teil dicken Marmorkalkes, der frei von ungelösch-
ten Kalkstückchen sein muss. Das Auftragen dieses Mörtels
erfolgt als Spritzwurf, welcher nach dem Anziehen mit dem
Reibebrett geglättet wird. Dieser Verputz muss vollständig
trocknen, bis die eigentliche Malputzschicht aufgebracht
wird. Zu dieser wird außer dem Kalk ein Gemisch von
Mineralien, der sogen. Malgrundsand, der aus jenem eisen-
freien Quarzsand besteht, welcher zur Herstellung des feinen
Krystallglases verwendet wird, genommen. Das Mischungs-
verhältnis ist acht. Teile Malgrundsandmischung und ein Teil
dicker Kalk. Diese Schicht wird in einer Dicke von 2 bis 3 cm
auf den Untergrundputz aufgetragen, und wird, wenn sie
genügend trocken ist, mit einer Lösung von Kieselfluorwasser-
stoffsäure präparirt und sodann mit eisenfreier Kaliwasser-
glaslösung zweimal gehärtet. Jetzt kann sofort mit der Be-
malung begonnen werden. Die Farben sind reine Erdfarben
oder chemische Pigmente, welche eine Verkieselung mit dem
Malputz bewirken. Die fertige Malerei wird mit einem aus
Wasserglas hergestellten Fixativ festgemacht. Es dringt in
die Poren des noch aufsaugungsfähigen Malputzes und ver-