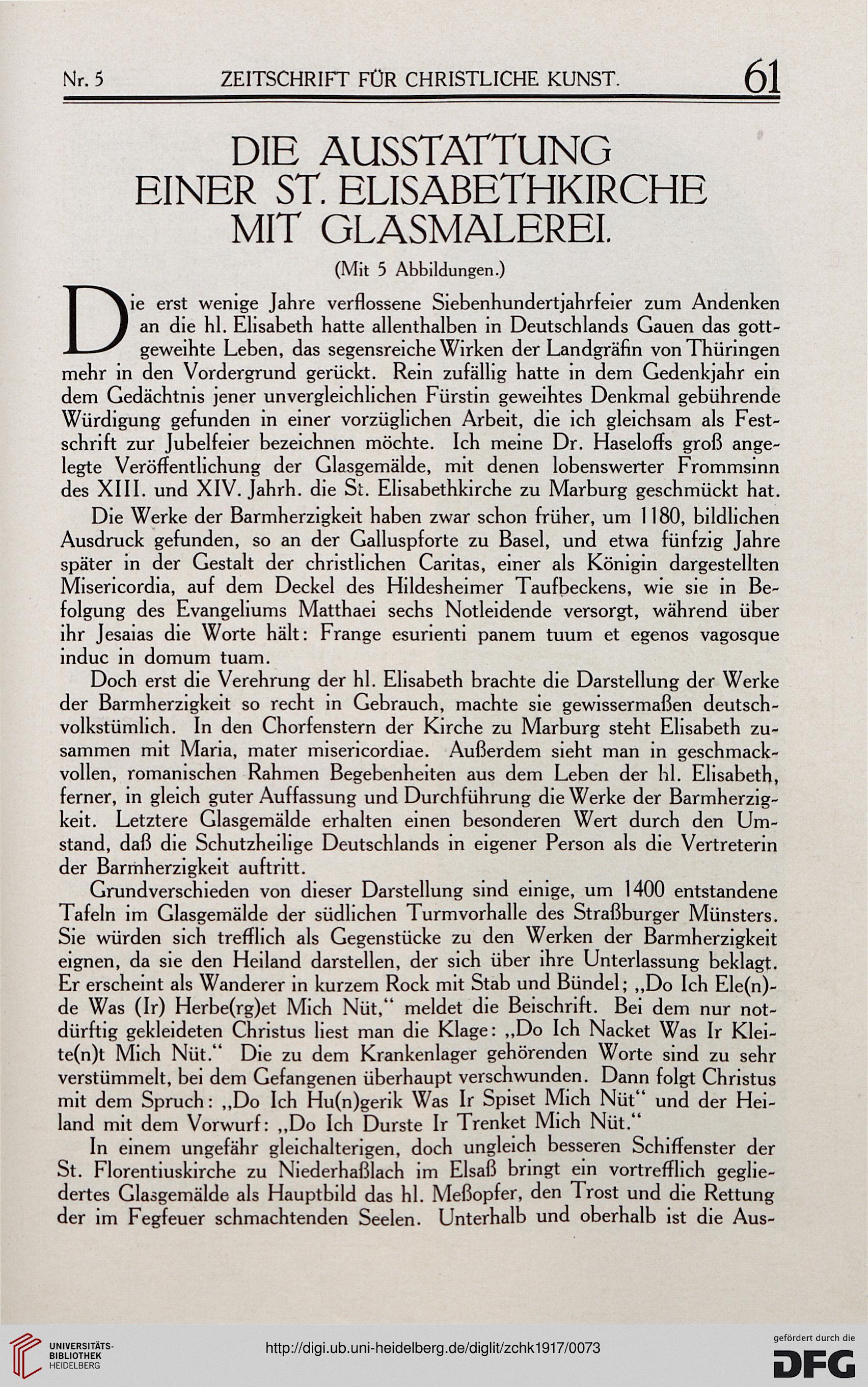Nr. 5___________ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.____________()\
DIE AUSSTATTUNG
EINER ST. ELISABETHKIRCHE
MIT GLASMALEREI.
(Mit 5 Abbildungen.)
Die erst wenige Jahre verflossene Siebenhundertjahrfeier zum Andenken
an die hl. Elisabeth hatte allenthalben in Deutschlands Gauen das gott-
geweihte Leben, das segensreiche Wirken der Landgräfin von Thüringen
mehr in den Vordergrund gerückt. Rein zufällig hatte in dem Gedenkjahr ein
dem Gedächtnis jener unvergleichlichen Fürstin geweihtes Denkmal gebührende
Würdigung gefunden in einer vorzüglichen Arbeit, die ich gleichsam als Fest-
schrift zur Jubelfeier bezeichnen möchte. Ich meine Dr. Haseloffs groß ange-
legte Veröffentlichung der Glasgemälde, mit denen lobenswerter Frommsinn
des XIII. und XIV. Jahrh. die St. Ehsabethkirche zu Marburg geschmückt hat.
Die Werke der Barmherzigkeit haben zwar schon früher, um 1180, bildlichen
Ausdruck gefunden, so an der Galluspforte zu Basel, und etwa fünfzig Jahre
später in der Gestalt der christlichen Caritas, einer als Königin dargestellten
Misericordia, auf dem Deckel des Hildesheimer Taufbeckens, wie sie in Be-
folgung des Evangeliums Matthaei sechs Notleidende versorgt, während über
ihr Jesaias die Worte hält: Frange esunenti panem tuum et egenos vagosque
induc in domum tuam.
Doch erst die Verehrung der hl. Elisabeth brachte die Darstellung der Werke
der Barmherzigkeit so recht in Gebrauch, machte sie gewissermaßen deutsch-
volkstümlich. In den Chorfenstern der Kirche zu Marburg steht Elisabeth zu-
sammen mit Maria, mater misericordiae. Außerdem sieht man in geschmack-
vollen, romanischen Rahmen Begebenheiten aus dem Leben der hl. Elisabeth,
ferner, in gleich guter Auffassung und Durchführung die Werke der Barmherzig-
keit. Letztere Glasgemälde erhalten einen besonderen Wert durch den Um-
stand, daß die Schutzheilige Deutschlands in eigener Person als die Vertreterin
der Barmherzigkeit auftritt.
Grundverschieden von dieser Darstellung sind einige, um 1400 entstandene
Tafeln im Glasgemälde der südlichen Turmvorhalle des Straßburger Münsters.
Sie würden sich trefflich als Gegenstücke zu den Werken der Barmherzigkeit
eignen, da sie den Heiland darstellen, der sich über ihre Unterlassung beklagt.
Er erscheint als Wanderer in kurzem Rock mit Stab und Bündel; „Do Ich Ele(n)-
de Was (Ir) Herbe(rg)et Mich Nüt," meldet die Beischrift. Bei dem nur not-
dürftig gekleideten Christus liest man die Klage: „Do Ich Nacket Was Ir Klei-
te(n)t Mich Nüt." Die zu dem Krankenlager gehörenden Worte sind zu sehr
verstümmelt, bei dem Gefangenen überhaupt verschwunden. Dann folgt Christus
mit dem Spruch: „Do Ich Hu(n)gerik Was Ir Spiset Mich Nüt" und der Hei-
land mit dem Vorwurf: „Do Ich Durste Ir Trenket Mich Nüt."
In einem ungefähr gleichalterigen, doch ungleich besseren Schiffenster der
St. Florentiuskirche zu Niederhaßlach im Elsaß bringt ein vortrefflich geglie-
dertes Glasgemälde als Hauptbild das hl. Meßopfer, den Trost und die Rettung
der im Fegfeuer schmachtenden Seelen. Unterhalb und oberhalb ist die Aus-
DIE AUSSTATTUNG
EINER ST. ELISABETHKIRCHE
MIT GLASMALEREI.
(Mit 5 Abbildungen.)
Die erst wenige Jahre verflossene Siebenhundertjahrfeier zum Andenken
an die hl. Elisabeth hatte allenthalben in Deutschlands Gauen das gott-
geweihte Leben, das segensreiche Wirken der Landgräfin von Thüringen
mehr in den Vordergrund gerückt. Rein zufällig hatte in dem Gedenkjahr ein
dem Gedächtnis jener unvergleichlichen Fürstin geweihtes Denkmal gebührende
Würdigung gefunden in einer vorzüglichen Arbeit, die ich gleichsam als Fest-
schrift zur Jubelfeier bezeichnen möchte. Ich meine Dr. Haseloffs groß ange-
legte Veröffentlichung der Glasgemälde, mit denen lobenswerter Frommsinn
des XIII. und XIV. Jahrh. die St. Ehsabethkirche zu Marburg geschmückt hat.
Die Werke der Barmherzigkeit haben zwar schon früher, um 1180, bildlichen
Ausdruck gefunden, so an der Galluspforte zu Basel, und etwa fünfzig Jahre
später in der Gestalt der christlichen Caritas, einer als Königin dargestellten
Misericordia, auf dem Deckel des Hildesheimer Taufbeckens, wie sie in Be-
folgung des Evangeliums Matthaei sechs Notleidende versorgt, während über
ihr Jesaias die Worte hält: Frange esunenti panem tuum et egenos vagosque
induc in domum tuam.
Doch erst die Verehrung der hl. Elisabeth brachte die Darstellung der Werke
der Barmherzigkeit so recht in Gebrauch, machte sie gewissermaßen deutsch-
volkstümlich. In den Chorfenstern der Kirche zu Marburg steht Elisabeth zu-
sammen mit Maria, mater misericordiae. Außerdem sieht man in geschmack-
vollen, romanischen Rahmen Begebenheiten aus dem Leben der hl. Elisabeth,
ferner, in gleich guter Auffassung und Durchführung die Werke der Barmherzig-
keit. Letztere Glasgemälde erhalten einen besonderen Wert durch den Um-
stand, daß die Schutzheilige Deutschlands in eigener Person als die Vertreterin
der Barmherzigkeit auftritt.
Grundverschieden von dieser Darstellung sind einige, um 1400 entstandene
Tafeln im Glasgemälde der südlichen Turmvorhalle des Straßburger Münsters.
Sie würden sich trefflich als Gegenstücke zu den Werken der Barmherzigkeit
eignen, da sie den Heiland darstellen, der sich über ihre Unterlassung beklagt.
Er erscheint als Wanderer in kurzem Rock mit Stab und Bündel; „Do Ich Ele(n)-
de Was (Ir) Herbe(rg)et Mich Nüt," meldet die Beischrift. Bei dem nur not-
dürftig gekleideten Christus liest man die Klage: „Do Ich Nacket Was Ir Klei-
te(n)t Mich Nüt." Die zu dem Krankenlager gehörenden Worte sind zu sehr
verstümmelt, bei dem Gefangenen überhaupt verschwunden. Dann folgt Christus
mit dem Spruch: „Do Ich Hu(n)gerik Was Ir Spiset Mich Nüt" und der Hei-
land mit dem Vorwurf: „Do Ich Durste Ir Trenket Mich Nüt."
In einem ungefähr gleichalterigen, doch ungleich besseren Schiffenster der
St. Florentiuskirche zu Niederhaßlach im Elsaß bringt ein vortrefflich geglie-
dertes Glasgemälde als Hauptbild das hl. Meßopfer, den Trost und die Rettung
der im Fegfeuer schmachtenden Seelen. Unterhalb und oberhalb ist die Aus-