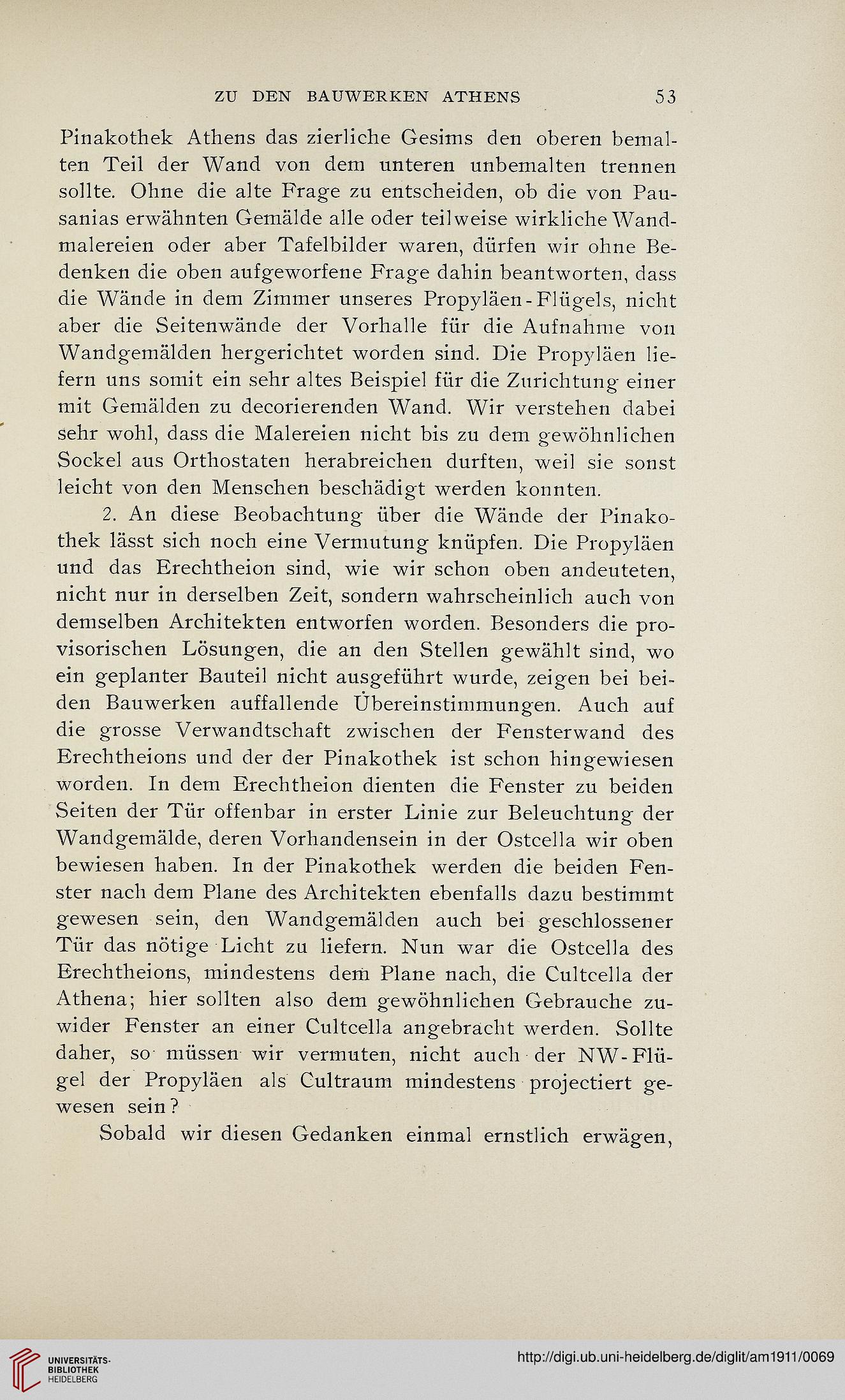ZU DEN BAUWERKEN ATHENS
53
Pinakothek Athens das zierliche Gesims den oberen bemal-
ten Teil der Wand von dem unteren unbemalten trennen
sollte. Ohne die alte Frage zu entscheiden, ob die von Pau-
sanias erwähnten Gemälde alle oder teilweise wirkliche Wand-
malereien oder aber Tafelbilder waren, dürfen wir ohne Be-
denken die oben aufgeworfene Frage dahin beantworten, dass
die Wände in dem Zimmer unseres Propyläen-Flügels, nicht
aber die Seitenwände der Vorhalle für die Aufnahme von
Wandgemälden hergerichtet worden sind. Die Propyläen lie-
fern uns somit ein sehr altes Beispiel für die Zurichtung einer
mit Gemälden zu decorierenden Wand. Wir verstehen dabei
sehr wohl, dass die Malereien nicht bis zu dem gewöhnlichen
Sockel aus Orthostaten herabreichen durften, weil sie sonst
leicht von den Menschen beschädigt werden konnten.
2. An diese Beobachtung über die Wände der Pinako-
thek lässt sich noch eine Vermutung knüpfen. Die Propyläen
und das Erechtheion sind, wie wir schon oben andeuteten,
nicht nur in derselben Zeit, sondern wahrscheinlich auch von
demselben Architekten entworfen worden. Besonders die pro-
visorischen Lösungen, die an den Stellen gewählt sind, wo
ein geplanter Bauteil nicht ausgeführt wurde, zeigen bei bei-
den Bauwerken auffallende Übereinstimmungen. Auch auf
die grosse Verwandtschaft zwischen der Fensterwand des
Erechtheions und der der Pinakothek ist schon hingewiesen
worden. In dem Erechtheion dienten die Fenster zu beiden
Seiten der Tür offenbar in erster Linie zur Beleuchtung der
Wandgemälde, deren Vorhandensein in der Ostcella wir oben
bewiesen haben. In der Pinakothek werden die beiden Fen-
ster nach dem Plane des Architekten ebenfalls dazu bestimmt
gewesen sein, den Wandgemälden auch bei geschlossener
Tür das nötige Licht zu liefern. Nun war die Ostcella des
Erechtheions, mindestens dem Plane nach, die Cultcella der
Athena; hier sollten also dem gewöhnlichen Gebrauche zu-
wider Fenster an einer Cultcella angebracht werden. Sollte
daher, so müssen wir vermuten, nicht auch der NW-Flü-
gel der Propyläen als Cultraum mindestens projectiert ge-
wesen sein?
Sobald wir diesen Gedanken einmal ernstlich erwägen,
53
Pinakothek Athens das zierliche Gesims den oberen bemal-
ten Teil der Wand von dem unteren unbemalten trennen
sollte. Ohne die alte Frage zu entscheiden, ob die von Pau-
sanias erwähnten Gemälde alle oder teilweise wirkliche Wand-
malereien oder aber Tafelbilder waren, dürfen wir ohne Be-
denken die oben aufgeworfene Frage dahin beantworten, dass
die Wände in dem Zimmer unseres Propyläen-Flügels, nicht
aber die Seitenwände der Vorhalle für die Aufnahme von
Wandgemälden hergerichtet worden sind. Die Propyläen lie-
fern uns somit ein sehr altes Beispiel für die Zurichtung einer
mit Gemälden zu decorierenden Wand. Wir verstehen dabei
sehr wohl, dass die Malereien nicht bis zu dem gewöhnlichen
Sockel aus Orthostaten herabreichen durften, weil sie sonst
leicht von den Menschen beschädigt werden konnten.
2. An diese Beobachtung über die Wände der Pinako-
thek lässt sich noch eine Vermutung knüpfen. Die Propyläen
und das Erechtheion sind, wie wir schon oben andeuteten,
nicht nur in derselben Zeit, sondern wahrscheinlich auch von
demselben Architekten entworfen worden. Besonders die pro-
visorischen Lösungen, die an den Stellen gewählt sind, wo
ein geplanter Bauteil nicht ausgeführt wurde, zeigen bei bei-
den Bauwerken auffallende Übereinstimmungen. Auch auf
die grosse Verwandtschaft zwischen der Fensterwand des
Erechtheions und der der Pinakothek ist schon hingewiesen
worden. In dem Erechtheion dienten die Fenster zu beiden
Seiten der Tür offenbar in erster Linie zur Beleuchtung der
Wandgemälde, deren Vorhandensein in der Ostcella wir oben
bewiesen haben. In der Pinakothek werden die beiden Fen-
ster nach dem Plane des Architekten ebenfalls dazu bestimmt
gewesen sein, den Wandgemälden auch bei geschlossener
Tür das nötige Licht zu liefern. Nun war die Ostcella des
Erechtheions, mindestens dem Plane nach, die Cultcella der
Athena; hier sollten also dem gewöhnlichen Gebrauche zu-
wider Fenster an einer Cultcella angebracht werden. Sollte
daher, so müssen wir vermuten, nicht auch der NW-Flü-
gel der Propyläen als Cultraum mindestens projectiert ge-
wesen sein?
Sobald wir diesen Gedanken einmal ernstlich erwägen,