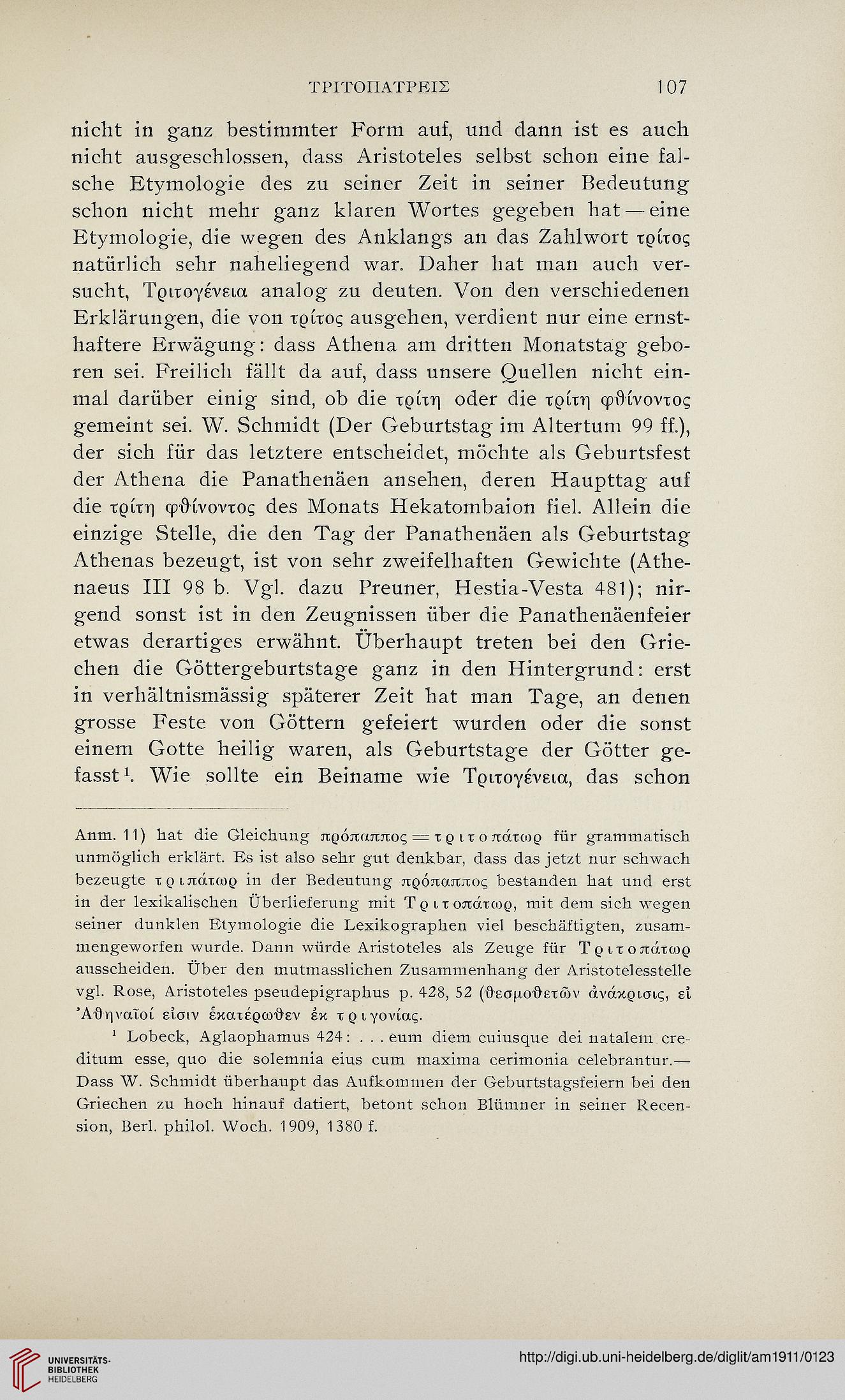TPITOIIATPEIE
107
nicht in ganz bestimmter Form auf, und dann ist es auch
nicht ausgeschlossen, dass Aristoteles selbst schon eine fal-
sche Etymologie des zu seiner Zeit in seiner Bedeutung
schon nicht mehr ganz klaren Wortes gegeben hat — eine
Etymologie, die wegen des Anklangs an das Zahlwort Tpho$
natürlich sehr naheliegend war. Daher hat man auch ver-
sucht, TpnoyeveKx analog zu deuten. Von den verschiedenen
Erklärungen, die von rphog ausgehen, verdient nur eine ernst-
haftere Erwägung: dass Athena am dritten Monatstag gebo-
ren sei. Freilich fällt da auf, dass unsere Quellen nicht ein-
mal darüber einig sind, ob die rplrq oder die iphij (pßrvoviog
gemeint sei. W. Schmidt (Der Geburtstag im Altertum 99 ff.),
der sich für das letztere entscheidet, möchte als Geburtsfest
der Athena die Panathenäen ansehen, deren Haupttag* auf
die rphr) (pßivovrog des Monats Hekatombaion fiel. Allein die
einzige Stelle, die den Tag der Panathenäen als Geburtstag
Athenas bezeugt, ist von sehr zweifelhaften Gewichte (Athe-
naeus III 98 b. Vgl. dazu Preuner, Hestia-Vesta 481); nir-
gend sonst ist in den Zeugnissen über die Panathenäenfeier
etwas derartiges erwähnt. Überhaupt treten bei den Grie-
chen die Göttergeburtstage ganz in den Hintergrund: erst
in verhältnismässig späterer Zeit hat man Tage, an denen
grosse Feste von Göttern gefeiert wurden oder die sonst
einem Gotte heilig waren, als Geburtstage der Götter ge-
fasste Wie sollte ein Beiname wie Tpnoyeveux, das schon
Anm. 11) hat die Gleichung jtQOJtMTtTtog —rpmojidrmp für grammatisch
unmöglich erklärt. Es ist also sehr gut denkbar, dass das jetzt nur schwach
bezeugte rpLjidiMp in der Bedeutung Jipon:o.3in:o$ bestanden hat und erst
in der lexikalischen Überlieferung mit T p L r ondrmp, mit dem sich wegen
seiner dunklen Etymologie die Lexikographen viel beschäftigten, zusam-
mengeworfen wurde. Dann würde Aristoteles als Zeuge für Tpt,TOTtdiop
ausscheiden. Über den mutmasslichen Zusammenhang der Aristotelesstelle
vgl. Rose, Aristoteles pseudepigraphus p. 428, 52 (üeopoüer<hv dvdxpmn, et
'Aüqvalot etotv exaiepoüev ex rpLyovtag.
' Lobeck, Aglaophamus 424: . . . eum diem cuiusque dei natalem cre-
ditum esse, quo die solemnia eius cum maxima cerimonia celebrantur.—
Dass W. Schmidt überhaupt das Aufkommen der Geburtstagsfeiern bei den
Griechen zu hoch hinauf datiert, betont schon Blümner in seiner Recen-
sion, Berl. philol. Woch. 1909, 1380 f.
107
nicht in ganz bestimmter Form auf, und dann ist es auch
nicht ausgeschlossen, dass Aristoteles selbst schon eine fal-
sche Etymologie des zu seiner Zeit in seiner Bedeutung
schon nicht mehr ganz klaren Wortes gegeben hat — eine
Etymologie, die wegen des Anklangs an das Zahlwort Tpho$
natürlich sehr naheliegend war. Daher hat man auch ver-
sucht, TpnoyeveKx analog zu deuten. Von den verschiedenen
Erklärungen, die von rphog ausgehen, verdient nur eine ernst-
haftere Erwägung: dass Athena am dritten Monatstag gebo-
ren sei. Freilich fällt da auf, dass unsere Quellen nicht ein-
mal darüber einig sind, ob die rplrq oder die iphij (pßrvoviog
gemeint sei. W. Schmidt (Der Geburtstag im Altertum 99 ff.),
der sich für das letztere entscheidet, möchte als Geburtsfest
der Athena die Panathenäen ansehen, deren Haupttag* auf
die rphr) (pßivovrog des Monats Hekatombaion fiel. Allein die
einzige Stelle, die den Tag der Panathenäen als Geburtstag
Athenas bezeugt, ist von sehr zweifelhaften Gewichte (Athe-
naeus III 98 b. Vgl. dazu Preuner, Hestia-Vesta 481); nir-
gend sonst ist in den Zeugnissen über die Panathenäenfeier
etwas derartiges erwähnt. Überhaupt treten bei den Grie-
chen die Göttergeburtstage ganz in den Hintergrund: erst
in verhältnismässig späterer Zeit hat man Tage, an denen
grosse Feste von Göttern gefeiert wurden oder die sonst
einem Gotte heilig waren, als Geburtstage der Götter ge-
fasste Wie sollte ein Beiname wie Tpnoyeveux, das schon
Anm. 11) hat die Gleichung jtQOJtMTtTtog —rpmojidrmp für grammatisch
unmöglich erklärt. Es ist also sehr gut denkbar, dass das jetzt nur schwach
bezeugte rpLjidiMp in der Bedeutung Jipon:o.3in:o$ bestanden hat und erst
in der lexikalischen Überlieferung mit T p L r ondrmp, mit dem sich wegen
seiner dunklen Etymologie die Lexikographen viel beschäftigten, zusam-
mengeworfen wurde. Dann würde Aristoteles als Zeuge für Tpt,TOTtdiop
ausscheiden. Über den mutmasslichen Zusammenhang der Aristotelesstelle
vgl. Rose, Aristoteles pseudepigraphus p. 428, 52 (üeopoüer<hv dvdxpmn, et
'Aüqvalot etotv exaiepoüev ex rpLyovtag.
' Lobeck, Aglaophamus 424: . . . eum diem cuiusque dei natalem cre-
ditum esse, quo die solemnia eius cum maxima cerimonia celebrantur.—
Dass W. Schmidt überhaupt das Aufkommen der Geburtstagsfeiern bei den
Griechen zu hoch hinauf datiert, betont schon Blümner in seiner Recen-
sion, Berl. philol. Woch. 1909, 1380 f.