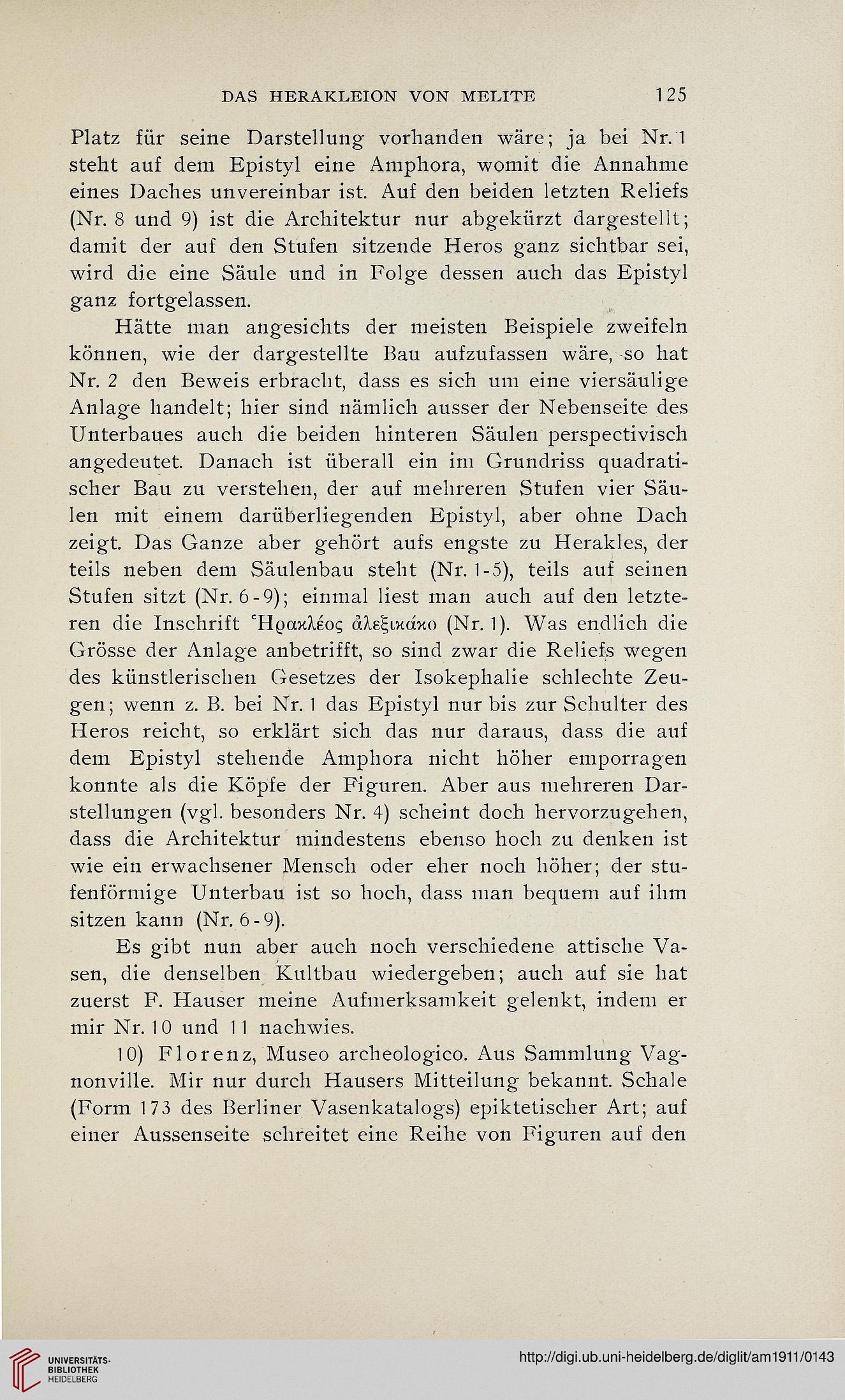DAS HERAKLEION VON MELITE
125
Platz für seine Darstellung vorhanden wäre; ja bei Nr. 1
steht auf dem Epistyl eine Amphora, womit die Annahme
eines Daches unvereinbar ist. Auf den beiden letzten Reliefs
(Nr. 8 und 9) ist die Architektur nur abgekürzt dargestellt;
damit der auf den Stufen sitzende Heros ganz sichtbar sei,
wird die eine Säule und in Folge dessen auch das Epistyl
ganz fortgelassen.
Hätte man angesichts der meisten Beispiele zweifeln
können, wie der dargestellte Bau aufzufassen wäre, so hat
Nr. 2 den Beweis erbracht, dass es sich um eine viersäulige
Anlage handelt; hier sind nämlich ausser der Nebenseite des
Unterbaues auch die beiden hinteren Säulen perspectivisch
angedeutet. Danach ist überall ein im Grundriss quadrati-
scher Bau zu verstehen, der auf mehreren Stufen vier Säu-
len mit einem darüberliegenden Epistyl, aber ohne Dach
zeigt. Das Ganze aber gehört aufs engste zu Herakles, der
teils neben dem Säulenbau steht (Nr. 1-5), teils auf seinen
Stufen sitzt (Nr. 6-9); einmal liest man auch auf den letzte-
ren die Inschrift 'Hpax^eog d^otaxo (Nr. 1). Was endlich die
Grösse der Anlage anbetrifft, so sind zwar die Reliefs wegen
des künstlerischen Gesetzes der Isokephalie schlechte Zeu-
gen; wenn z. B. bei Nr. 1 das Epistyl nur bis zur Schulter des
Heros reicht, so erklärt sich das nur daraus, dass die auf
dem Epistyl stehende Amphora nicht höher emporragen
konnte als die Köpfe der Figuren. Aber aus mehreren Dar-
stellungen (vgl. besonders Nr. 4) scheint doch hervorzugehen,
dass die Architektur mindestens ebenso hoch zu denken ist
wie ein erwachsener Mensch oder eher noch höher; der stu-
fenförmige Unterbau ist so hoch, dass man bequem auf ihm
sitzen kann (Nr. 6-9).
Es gibt nun aber auch noch verschiedene attische Va-
sen, die denselben Kultbau wiedergeben; auch auf sie hat
zuerst F. Hauser meine Aufmerksamkeit gelenkt, indem er
mir Nr. 10 und 1 1 nachwies.
10) Florenz, Museo archeologico. Aus Sammlung Vag-
nonville. Mir nur durch Hausers Mitteilung bekannt. Schale
(Form 173 des Berliner Vasenkatalogs) epiktetischer Art; auf
einer Aussenseite schreitet eine Reihe von Figuren auf den
125
Platz für seine Darstellung vorhanden wäre; ja bei Nr. 1
steht auf dem Epistyl eine Amphora, womit die Annahme
eines Daches unvereinbar ist. Auf den beiden letzten Reliefs
(Nr. 8 und 9) ist die Architektur nur abgekürzt dargestellt;
damit der auf den Stufen sitzende Heros ganz sichtbar sei,
wird die eine Säule und in Folge dessen auch das Epistyl
ganz fortgelassen.
Hätte man angesichts der meisten Beispiele zweifeln
können, wie der dargestellte Bau aufzufassen wäre, so hat
Nr. 2 den Beweis erbracht, dass es sich um eine viersäulige
Anlage handelt; hier sind nämlich ausser der Nebenseite des
Unterbaues auch die beiden hinteren Säulen perspectivisch
angedeutet. Danach ist überall ein im Grundriss quadrati-
scher Bau zu verstehen, der auf mehreren Stufen vier Säu-
len mit einem darüberliegenden Epistyl, aber ohne Dach
zeigt. Das Ganze aber gehört aufs engste zu Herakles, der
teils neben dem Säulenbau steht (Nr. 1-5), teils auf seinen
Stufen sitzt (Nr. 6-9); einmal liest man auch auf den letzte-
ren die Inschrift 'Hpax^eog d^otaxo (Nr. 1). Was endlich die
Grösse der Anlage anbetrifft, so sind zwar die Reliefs wegen
des künstlerischen Gesetzes der Isokephalie schlechte Zeu-
gen; wenn z. B. bei Nr. 1 das Epistyl nur bis zur Schulter des
Heros reicht, so erklärt sich das nur daraus, dass die auf
dem Epistyl stehende Amphora nicht höher emporragen
konnte als die Köpfe der Figuren. Aber aus mehreren Dar-
stellungen (vgl. besonders Nr. 4) scheint doch hervorzugehen,
dass die Architektur mindestens ebenso hoch zu denken ist
wie ein erwachsener Mensch oder eher noch höher; der stu-
fenförmige Unterbau ist so hoch, dass man bequem auf ihm
sitzen kann (Nr. 6-9).
Es gibt nun aber auch noch verschiedene attische Va-
sen, die denselben Kultbau wiedergeben; auch auf sie hat
zuerst F. Hauser meine Aufmerksamkeit gelenkt, indem er
mir Nr. 10 und 1 1 nachwies.
10) Florenz, Museo archeologico. Aus Sammlung Vag-
nonville. Mir nur durch Hausers Mitteilung bekannt. Schale
(Form 173 des Berliner Vasenkatalogs) epiktetischer Art; auf
einer Aussenseite schreitet eine Reihe von Figuren auf den