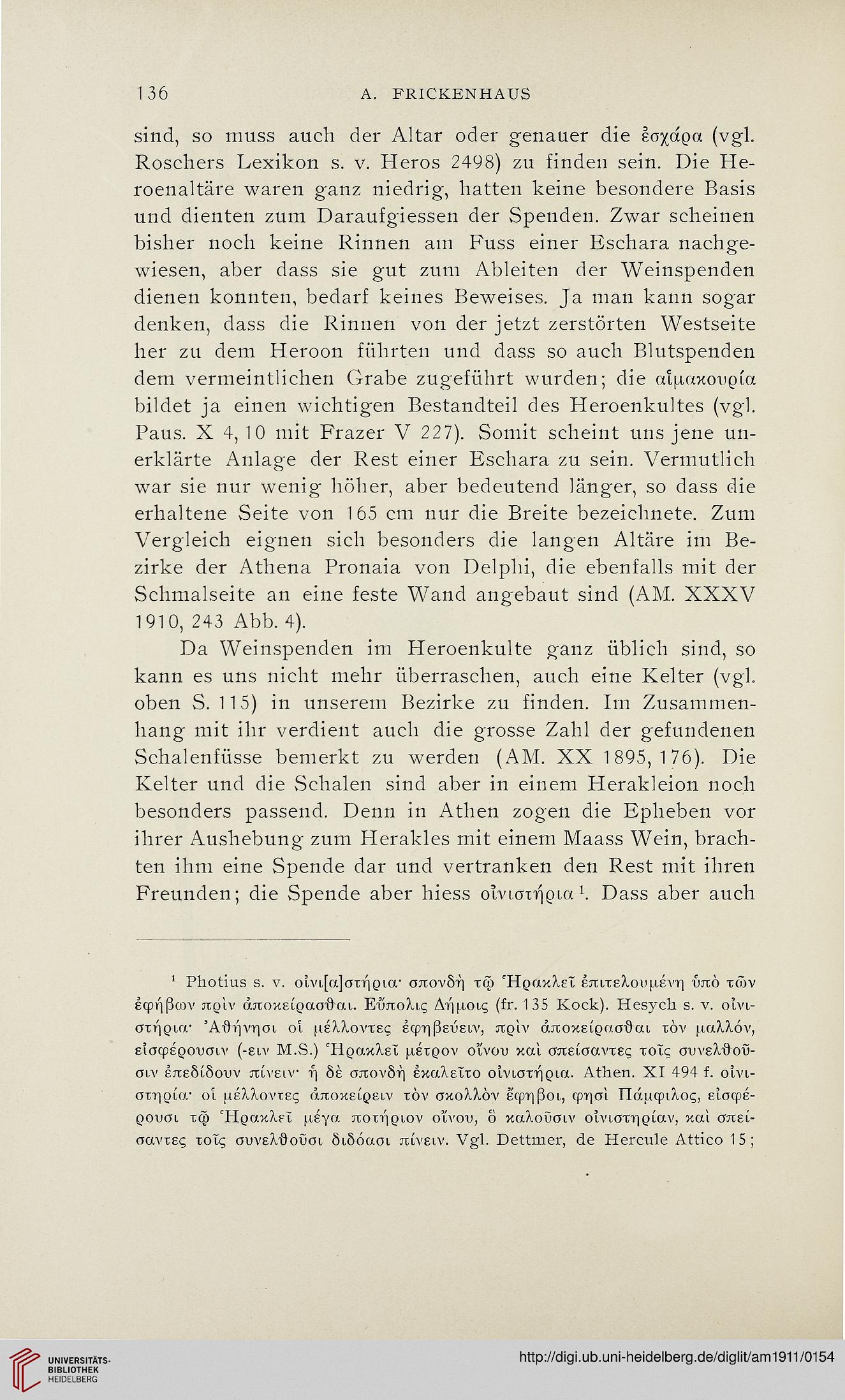136
A. FRICKENHAUS
sind, so muss auch der Altar oder genauer die eo/apa (vgl.
Roschers Lexikon s. v. Heros 2498) zu finden sein. Die He-
roenaltäre waren ganz niedrig, hatten keine besondere Basis
und dienten zum Daraufgiessen der Spenden. Zwar scheinen
bisher noch keine Rinnen am Fuss einer Eschara nachge-
wiesen, aber dass sie gut zum Ableiten der Weinspenden
dienen konnten, bedarf keines Beweises. Ja man kann sogar
denken, dass die Rinnen von der jetzt zerstörten Westseite
her zu dem Heroon führten und dass so auch Blutspenden
dem vermeintlichen Grabe zugeführt wurden; die atpaxonpax
bildet ja einen wichtigen Bestandteil des Heroenkultes (vgl.
Baus. X 4, 10 mit Frazer V 227). Somit scheint uns jene un-
erklärte Anlage der Rest einer Eschara zu sein. Vermutlich
war sie nur wenig höher, aber bedeutend länger, so dass die
erhaltene Seite von 165 cm nur die Breite bezeichnete. Zum
Vergleich eignen sich besonders die langen Altäre im Be-
zirke der Athena Pronaia von Delphi, die ebenfalls mit der
Schmalseite an eine feste Wand angebaut sind (AM. XXXV
1910, 243 Abb. 4).
Da Weinspenden im Heroenkulte ganz üblich sind, so
kann es uns nicht mehr überraschen, auch eine Kelter (vgl.
oben S. 115) in unserem Bezirke zu finden. Im Zusammen-
hang mit ihr verdient auch die grosse Zahl der gefundenen
Schalenfüsse bemerkt zu werden (AM. XX 1 895,1 76). Die
Kelter und die Schalen sind aber in einem Herakleion noch
besonders passend. Denn in Athen zogen die Epheben vor
ihrer Aushebung zum Herakles mit einem Maass Wein, brach-
ten ihm eine Spende dar und vertranken den Rest mit ihren
Freunden; die Spende aber hiess OLvtonjpta! Dass aber auch
' Photius s. v. otvt{a]oT;Vipar crcovSr] TM 'HpaxAt EJtLTEXoupEYY] 1A6 TMv
EtppßMv Jtph' djioxsLpaoHaL. ErAoXn; Ai)pon (fr. 135 Kock). Hesych s. v. ohn-
aTpptrr 'Afbh'Yiat ot ps^XovTEC E(p*pßEUELV, Jtplv djioxELpaaHüL töv paAAov,
ELOfpEpOUOLV (-ELV M.S.) 'Hpax7.BL pETpOV OLVOU XCO OJTELOaVTEg rote (TUVEMIon-
arv EnsSlöouv Jtü'ELV f) Ss ojrovSf] ExoAstTO ob'LOTf)pLa. Athen. XI 494 f. ohn-
GTTjQLa' OL psDoVTEq dltOXELQELV tOV CXoTAdv E<p*pßOL, (pY]OL ndpqAoq, ELOtpE-
pOVOL TM 'HpaX?^FL psy^ JtOTppLOV OLVOU, O XtAoCOLV OLYLOTTIpLav, xtd GICEL-
navTsg iotg ouvsittfohoL SLÖoaoL JLLVELV. Vgl. Dettmer, de Hercule Attico 1 5 ;
A. FRICKENHAUS
sind, so muss auch der Altar oder genauer die eo/apa (vgl.
Roschers Lexikon s. v. Heros 2498) zu finden sein. Die He-
roenaltäre waren ganz niedrig, hatten keine besondere Basis
und dienten zum Daraufgiessen der Spenden. Zwar scheinen
bisher noch keine Rinnen am Fuss einer Eschara nachge-
wiesen, aber dass sie gut zum Ableiten der Weinspenden
dienen konnten, bedarf keines Beweises. Ja man kann sogar
denken, dass die Rinnen von der jetzt zerstörten Westseite
her zu dem Heroon führten und dass so auch Blutspenden
dem vermeintlichen Grabe zugeführt wurden; die atpaxonpax
bildet ja einen wichtigen Bestandteil des Heroenkultes (vgl.
Baus. X 4, 10 mit Frazer V 227). Somit scheint uns jene un-
erklärte Anlage der Rest einer Eschara zu sein. Vermutlich
war sie nur wenig höher, aber bedeutend länger, so dass die
erhaltene Seite von 165 cm nur die Breite bezeichnete. Zum
Vergleich eignen sich besonders die langen Altäre im Be-
zirke der Athena Pronaia von Delphi, die ebenfalls mit der
Schmalseite an eine feste Wand angebaut sind (AM. XXXV
1910, 243 Abb. 4).
Da Weinspenden im Heroenkulte ganz üblich sind, so
kann es uns nicht mehr überraschen, auch eine Kelter (vgl.
oben S. 115) in unserem Bezirke zu finden. Im Zusammen-
hang mit ihr verdient auch die grosse Zahl der gefundenen
Schalenfüsse bemerkt zu werden (AM. XX 1 895,1 76). Die
Kelter und die Schalen sind aber in einem Herakleion noch
besonders passend. Denn in Athen zogen die Epheben vor
ihrer Aushebung zum Herakles mit einem Maass Wein, brach-
ten ihm eine Spende dar und vertranken den Rest mit ihren
Freunden; die Spende aber hiess OLvtonjpta! Dass aber auch
' Photius s. v. otvt{a]oT;Vipar crcovSr] TM 'HpaxAt EJtLTEXoupEYY] 1A6 TMv
EtppßMv Jtph' djioxsLpaoHaL. ErAoXn; Ai)pon (fr. 135 Kock). Hesych s. v. ohn-
aTpptrr 'Afbh'Yiat ot ps^XovTEC E(p*pßEUELV, Jtplv djioxELpaaHüL töv paAAov,
ELOfpEpOUOLV (-ELV M.S.) 'Hpax7.BL pETpOV OLVOU XCO OJTELOaVTEg rote (TUVEMIon-
arv EnsSlöouv Jtü'ELV f) Ss ojrovSf] ExoAstTO ob'LOTf)pLa. Athen. XI 494 f. ohn-
GTTjQLa' OL psDoVTEq dltOXELQELV tOV CXoTAdv E<p*pßOL, (pY]OL ndpqAoq, ELOtpE-
pOVOL TM 'HpaX?^FL psy^ JtOTppLOV OLVOU, O XtAoCOLV OLYLOTTIpLav, xtd GICEL-
navTsg iotg ouvsittfohoL SLÖoaoL JLLVELV. Vgl. Dettmer, de Hercule Attico 1 5 ;