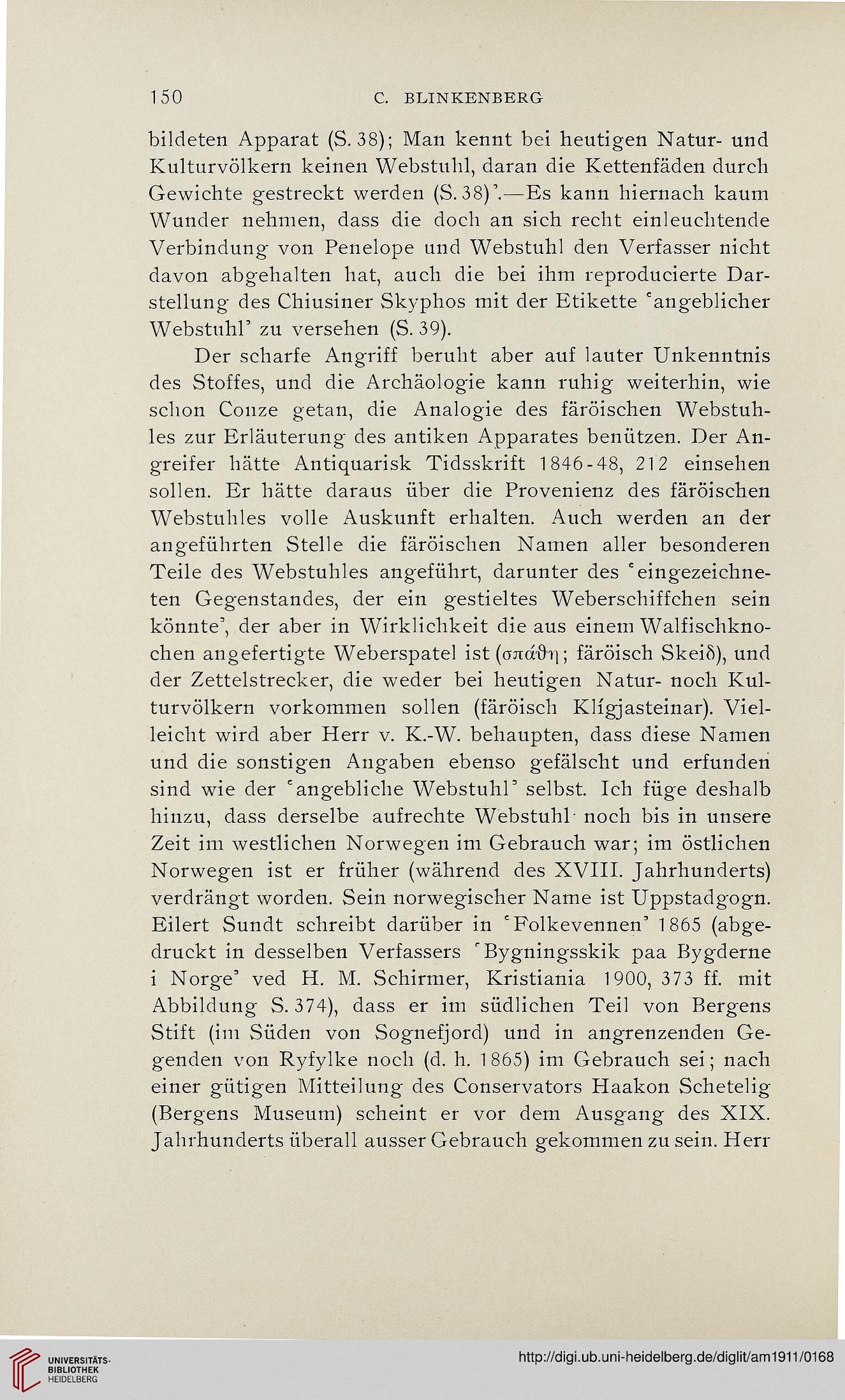150
C. BLINKENBERG
bildeten Apparat (S. 38); Man kennt bei heutigen Natur- und
Kulturvölkern keinen Webstuhl, daran die Kettenfäden durch
Gewichte gestreckt werden (S. 38)'.—Es kann hiernach kaum
Wunder nehmen, dass die doch an sich recht einleuchtende
Verbindung von Penelope und Webstuhl den Verfasser nicht
davon abgehalten hat, auch die bei ihm reproducierte Dar-
stellung des Chiusiner Skyphos mit der Etikette 'angeblicher
WebstuhP zu versehen (S. 39).
Der scharfe Angriff beruht aber auf lauter Unkenntnis
des Stoffes, und die Archäologie kann ruhig weiterhin, wie
schon Couze getan, die Analogie des färöischen Webstuh-
les zur Erläuterung des antiken Apparates benützen. Der An-
greifer hätte Antiquarisk Tidsskrift 1 846-48, 212 einsehen
sollen. Er hätte daraus über die Provenienz des färöischen
Webstuhles volle Auskunft erhalten. Auch werden an der
angeführten Stelle die färöischen Namen aller besonderen
Teile des Webstuhles angeführt, darunter des 'eingezeichne-
ten Gegenstandes, der ein gestieltes Weberschiffchen sein
könnte', der aber in Wirklichkeit die aus einem Walfischkno-
chen angefertigte Weberspatel ist(oadüq; färöisch Skei§), und
der Zettelstrecker, die weder bei heutigen Natur- noch Kul-
turvölkern Vorkommen sollen (färöisch Klfgjasteinar). Viel-
leicht wird aber Herr v. K.-W. behaupten, dass diese Namen
und die sonstigen Angaben ebenso gefälscht und erfunden
sind wie der 'angebliche Webstuhl' selbst. Ich füge deshalb
hinzu, dass derselbe aufrechte Webstuhl noch bis in unsere
Zeit im westlichen Norwegen im Gebrauch war; im östlichen
Norwegen ist er früher (während des XVIII. Jahrhunderts)
verdrängt worden. Sein norwegischer Name ist Uppstadgogn.
Eilert Sundt schreibt darüber in 'Folkevennen' 1 865 (abge-
druckt in desselben Verfassers 'Bygningsskik paa Bygderne
i Norge' ved H. M. Schirmer, Kristiania 1900, 373 ff. mit
Abbildung S. 374), dass er im südlichen Teil von Bergens
Stift (im Süden von Sognefjord) und in angrenzenden Ge-
genden von Ryfylke noch (d. h. 1865) im Gebrauch sei; nach
einer gütigen Mitteilung des (Konservators Haakon Schetelig
(Bergens Museum) scheint er vor dem Ausgang des XIX.
Jahrhunderts überall ausser Gebrauch gekommen zu sein. Herr
C. BLINKENBERG
bildeten Apparat (S. 38); Man kennt bei heutigen Natur- und
Kulturvölkern keinen Webstuhl, daran die Kettenfäden durch
Gewichte gestreckt werden (S. 38)'.—Es kann hiernach kaum
Wunder nehmen, dass die doch an sich recht einleuchtende
Verbindung von Penelope und Webstuhl den Verfasser nicht
davon abgehalten hat, auch die bei ihm reproducierte Dar-
stellung des Chiusiner Skyphos mit der Etikette 'angeblicher
WebstuhP zu versehen (S. 39).
Der scharfe Angriff beruht aber auf lauter Unkenntnis
des Stoffes, und die Archäologie kann ruhig weiterhin, wie
schon Couze getan, die Analogie des färöischen Webstuh-
les zur Erläuterung des antiken Apparates benützen. Der An-
greifer hätte Antiquarisk Tidsskrift 1 846-48, 212 einsehen
sollen. Er hätte daraus über die Provenienz des färöischen
Webstuhles volle Auskunft erhalten. Auch werden an der
angeführten Stelle die färöischen Namen aller besonderen
Teile des Webstuhles angeführt, darunter des 'eingezeichne-
ten Gegenstandes, der ein gestieltes Weberschiffchen sein
könnte', der aber in Wirklichkeit die aus einem Walfischkno-
chen angefertigte Weberspatel ist(oadüq; färöisch Skei§), und
der Zettelstrecker, die weder bei heutigen Natur- noch Kul-
turvölkern Vorkommen sollen (färöisch Klfgjasteinar). Viel-
leicht wird aber Herr v. K.-W. behaupten, dass diese Namen
und die sonstigen Angaben ebenso gefälscht und erfunden
sind wie der 'angebliche Webstuhl' selbst. Ich füge deshalb
hinzu, dass derselbe aufrechte Webstuhl noch bis in unsere
Zeit im westlichen Norwegen im Gebrauch war; im östlichen
Norwegen ist er früher (während des XVIII. Jahrhunderts)
verdrängt worden. Sein norwegischer Name ist Uppstadgogn.
Eilert Sundt schreibt darüber in 'Folkevennen' 1 865 (abge-
druckt in desselben Verfassers 'Bygningsskik paa Bygderne
i Norge' ved H. M. Schirmer, Kristiania 1900, 373 ff. mit
Abbildung S. 374), dass er im südlichen Teil von Bergens
Stift (im Süden von Sognefjord) und in angrenzenden Ge-
genden von Ryfylke noch (d. h. 1865) im Gebrauch sei; nach
einer gütigen Mitteilung des (Konservators Haakon Schetelig
(Bergens Museum) scheint er vor dem Ausgang des XIX.
Jahrhunderts überall ausser Gebrauch gekommen zu sein. Herr