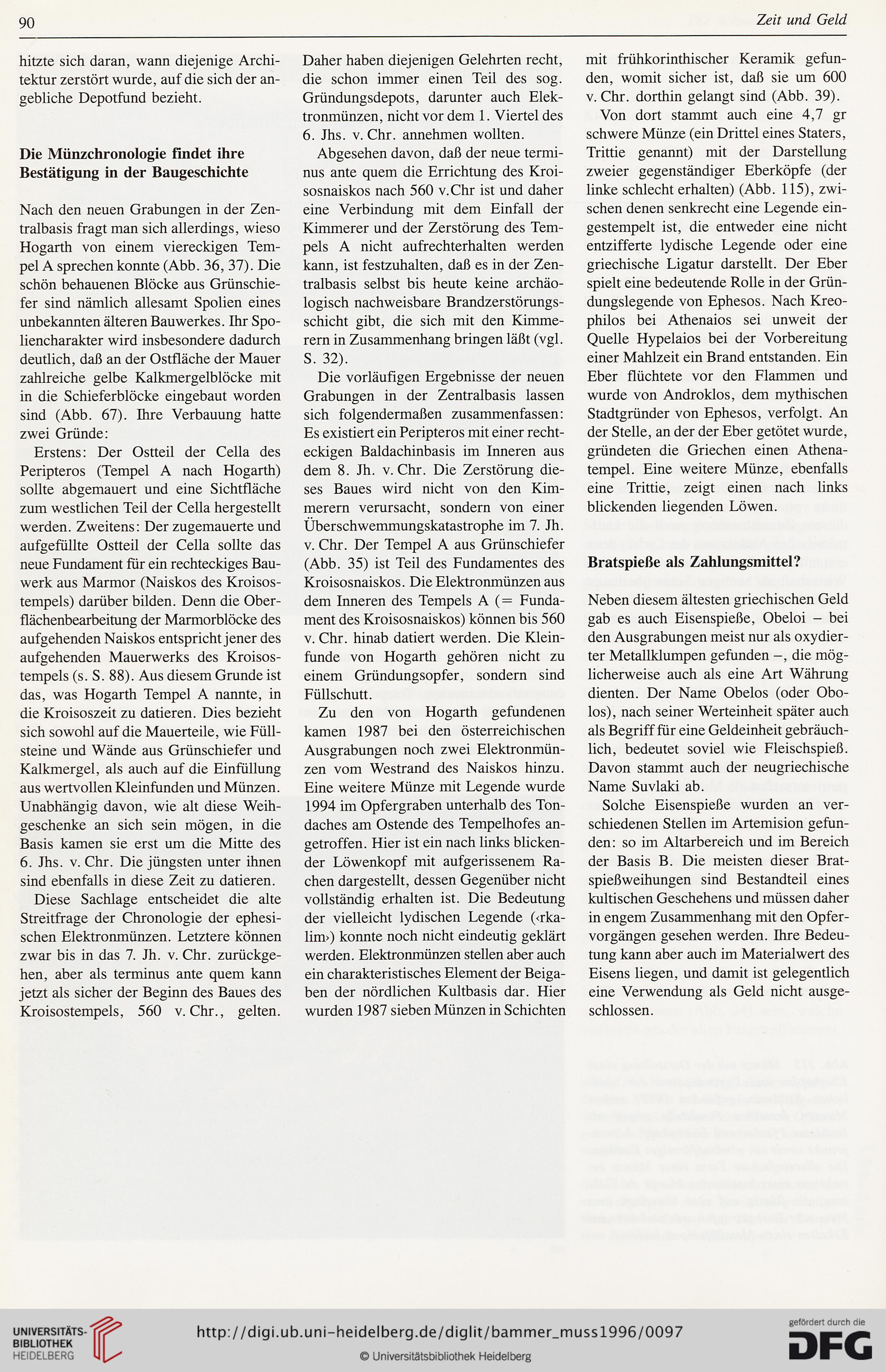90
Zeit und Geld
hitzte sich daran, wann diejenige Archi-
tektur zerstört wurde, auf die sich der an-
gebliche Depotfund bezieht.
Die Münzchronologie findet ihre
Bestätigung in der Baugeschichte
Nach den neuen Grabungen in der Zen-
tralbasis fragt man sich allerdings, wieso
Hogarth von einem viereckigen Tem-
pel A sprechen konnte (Abb. 36, 37). Die
schön behauenen Blöcke aus Grünschie-
fer sind nämlich allesamt Spolien eines
unbekannten älteren Bauwerkes. Ihr Spo-
liencharakter wird insbesondere dadurch
deutlich, daß an der Ostfläche der Mauer
zahlreiche gelbe Kalkmergelblöcke mit
in die Schieferblöcke eingebaut worden
sind (Abb. 67). Ihre Verbauung hatte
zwei Gründe:
Erstens: Der Ostteil der Cella des
Peripteros (Tempel A nach Hogarth)
sollte abgemauert und eine Sichtfläche
zum westlichen Teil der Cella hergestellt
werden. Zweitens: Der zugemauerte und
aufgefüllte Ostteil der Cella sollte das
neue Fundament für ein rechteckiges Bau-
werk aus Marmor (Naiskos des Kroisos-
tempels) darüber bilden. Denn die Ober-
flächenbearbeitung der Marmorblöcke des
aufgehenden Naiskos entspricht jener des
aufgehenden Mauerwerks des Kroisos-
tempels (s. S. 88). Aus diesem Grunde ist
das, was Hogarth Tempel A nannte, in
die Kroisoszeit zu datieren. Dies bezieht
sich sowohl auf die Mauerteile, wie Füll-
steine und Wände aus Grünschiefer und
Kalkmergel, als auch auf die Einfüllung
aus wertvollen Kleinfunden und Münzen.
Unabhängig davon, wie alt diese Weih-
geschenke an sich sein mögen, in die
Basis kamen sie erst um die Mitte des
6. Jhs. v. Chr. Die jüngsten unter ihnen
sind ebenfalls in diese Zeit zu datieren.
Diese Sachlage entscheidet die alte
Streitfrage der Chronologie der ephesi-
schen Elektronmünzen. Letztere können
zwar bis in das 7. Jh. v. Chr. zurückge-
hen, aber als terminus ante quem kann
jetzt als sicher der Beginn des Baues des
Kroisostempels, 560 v. Chr., gelten.
Daher haben diejenigen Gelehrten recht,
die schon immer einen Teil des sog.
Gründungsdepots, darunter auch Elek-
tronmünzen, nicht vordem 1. Viertel des
6. Jhs. v. Chr. annehmen wollten.
Abgesehen davon, daß der neue termi-
nus ante quem die Errichtung des Kroi-
sosnaiskos nach 560 v.Chr ist und daher
eine Verbindung mit dem Einfall der
Kimmerer und der Zerstörung des Tem-
pels A nicht aufrechterhalten werden
kann, ist festzuhalten, daß es in der Zen-
tralbasis selbst bis heute keine archäo-
logisch nachweisbare Brandzerstörungs-
schicht gibt, die sich mit den Kimme-
rern in Zusammenhang bringen läßt (vgl.
S. 32).
Die vorläufigen Ergebnisse der neuen
Grabungen in der Zentralbasis lassen
sich folgendermaßen zusammenfassen:
Es existiert ein Peripteros mit einer recht-
eckigen Baldachinbasis im Inneren aus
dem 8. Jh. v. Chr. Die Zerstörung die-
ses Baues wird nicht von den Kim-
merern verursacht, sondern von einer
Überschwemmungskatastrophe im 7. Jh.
v. Chr. Der Tempel A aus Grünschiefer
(Abb. 35) ist Teil des Fundamentes des
Kroisosnaiskos. Die Elektronmünzen aus
dem Inneren des Tempels A (= Funda-
ment des Kroisosnaiskos) können bis 560
v. Chr. hinab datiert werden. Die Klein-
funde von Hogarth gehören nicht zu
einem Gründungsopfer, sondern sind
Füllschutt.
Zu den von Hogarth gefundenen
kamen 1987 bei den österreichischen
Ausgrabungen noch zwei Elektronmün-
zen vom Westrand des Naiskos hinzu.
Eine weitere Münze mit Legende wurde
1994 im Opfergraben unterhalb des Ton-
daches am Ostende des Tempelhofes an-
getroffen. Hier ist ein nach links blicken-
der Löwenkopf mit aufgerissenem Ra-
chen dargestellt, dessen Gegenüber nicht
vollständig erhalten ist. Die Bedeutung
der vielleicht lydischen Legende (<rka-
lim>) konnte noch nicht eindeutig geklärt
werden. Elektronmünzen stellen aber auch
ein charakteristisches Element der Beiga-
ben der nördlichen Kultbasis dar. Hier
wurden 1987 sieben Münzen in Schichten
mit frühkorinthischer Keramik gefun-
den, womit sicher ist, daß sie um 600
v. Chr. dorthin gelangt sind (Abb. 39).
Von dort stammt auch eine 4,7 gr
schwere Münze (ein Drittel eines Staters,
Trittie genannt) mit der Darstellung
zweier gegenständiger Eberköpfe (der
linke schlecht erhalten) (Abb. 115), zwi-
schen denen senkrecht eine Legende ein-
gestempelt ist, die entweder eine nicht
entzifferte lydische Legende oder eine
griechische Ligatur darstellt. Der Eber
spielt eine bedeutende Rolle in der Grün-
dungslegende von Ephesos. Nach Kreo-
philos bei Athenaios sei unweit der
Quelle Hypelaios bei der Vorbereitung
einer Mahlzeit ein Brand entstanden. Ein
Eber flüchtete vor den Flammen und
wurde von Androklos, dem mythischen
Stadtgründer von Ephesos, verfolgt. An
der Stelle, an der der Eber getötet wurde,
gründeten die Griechen einen Athena-
tempel. Eine weitere Münze, ebenfalls
eine Trittie, zeigt einen nach links
blickenden liegenden Löwen.
Bratspieße als Zahlungsmittel?
Neben diesem ältesten griechischen Geld
gab es auch Eisenspieße, Obeloi - bei
den Ausgrabungen meist nur als oxydier-
ter Metallklumpen gefunden -, die mög-
licherweise auch als eine Art Währung
dienten. Der Name Obelos (oder Obo-
los), nach seiner Werteinheit später auch
als Begriff für eine Geldeinheit gebräuch-
lich, bedeutet soviel wie Fleischspieß.
Davon stammt auch der neugriechische
Name Suvlaki ab.
Solche Eisenspieße wurden an ver-
schiedenen Stellen im Artemision gefun-
den: so im Altarbereich und im Bereich
der Basis B. Die meisten dieser Brat-
spießweihungen sind Bestandteil eines
kultischen Geschehens und müssen daher
in engem Zusammenhang mit den Opfer-
vorgängen gesehen werden. Ihre Bedeu-
tung kann aber auch im Materialwert des
Eisens liegen, und damit ist gelegentlich
eine Verwendung als Geld nicht ausge-
schlossen.
Zeit und Geld
hitzte sich daran, wann diejenige Archi-
tektur zerstört wurde, auf die sich der an-
gebliche Depotfund bezieht.
Die Münzchronologie findet ihre
Bestätigung in der Baugeschichte
Nach den neuen Grabungen in der Zen-
tralbasis fragt man sich allerdings, wieso
Hogarth von einem viereckigen Tem-
pel A sprechen konnte (Abb. 36, 37). Die
schön behauenen Blöcke aus Grünschie-
fer sind nämlich allesamt Spolien eines
unbekannten älteren Bauwerkes. Ihr Spo-
liencharakter wird insbesondere dadurch
deutlich, daß an der Ostfläche der Mauer
zahlreiche gelbe Kalkmergelblöcke mit
in die Schieferblöcke eingebaut worden
sind (Abb. 67). Ihre Verbauung hatte
zwei Gründe:
Erstens: Der Ostteil der Cella des
Peripteros (Tempel A nach Hogarth)
sollte abgemauert und eine Sichtfläche
zum westlichen Teil der Cella hergestellt
werden. Zweitens: Der zugemauerte und
aufgefüllte Ostteil der Cella sollte das
neue Fundament für ein rechteckiges Bau-
werk aus Marmor (Naiskos des Kroisos-
tempels) darüber bilden. Denn die Ober-
flächenbearbeitung der Marmorblöcke des
aufgehenden Naiskos entspricht jener des
aufgehenden Mauerwerks des Kroisos-
tempels (s. S. 88). Aus diesem Grunde ist
das, was Hogarth Tempel A nannte, in
die Kroisoszeit zu datieren. Dies bezieht
sich sowohl auf die Mauerteile, wie Füll-
steine und Wände aus Grünschiefer und
Kalkmergel, als auch auf die Einfüllung
aus wertvollen Kleinfunden und Münzen.
Unabhängig davon, wie alt diese Weih-
geschenke an sich sein mögen, in die
Basis kamen sie erst um die Mitte des
6. Jhs. v. Chr. Die jüngsten unter ihnen
sind ebenfalls in diese Zeit zu datieren.
Diese Sachlage entscheidet die alte
Streitfrage der Chronologie der ephesi-
schen Elektronmünzen. Letztere können
zwar bis in das 7. Jh. v. Chr. zurückge-
hen, aber als terminus ante quem kann
jetzt als sicher der Beginn des Baues des
Kroisostempels, 560 v. Chr., gelten.
Daher haben diejenigen Gelehrten recht,
die schon immer einen Teil des sog.
Gründungsdepots, darunter auch Elek-
tronmünzen, nicht vordem 1. Viertel des
6. Jhs. v. Chr. annehmen wollten.
Abgesehen davon, daß der neue termi-
nus ante quem die Errichtung des Kroi-
sosnaiskos nach 560 v.Chr ist und daher
eine Verbindung mit dem Einfall der
Kimmerer und der Zerstörung des Tem-
pels A nicht aufrechterhalten werden
kann, ist festzuhalten, daß es in der Zen-
tralbasis selbst bis heute keine archäo-
logisch nachweisbare Brandzerstörungs-
schicht gibt, die sich mit den Kimme-
rern in Zusammenhang bringen läßt (vgl.
S. 32).
Die vorläufigen Ergebnisse der neuen
Grabungen in der Zentralbasis lassen
sich folgendermaßen zusammenfassen:
Es existiert ein Peripteros mit einer recht-
eckigen Baldachinbasis im Inneren aus
dem 8. Jh. v. Chr. Die Zerstörung die-
ses Baues wird nicht von den Kim-
merern verursacht, sondern von einer
Überschwemmungskatastrophe im 7. Jh.
v. Chr. Der Tempel A aus Grünschiefer
(Abb. 35) ist Teil des Fundamentes des
Kroisosnaiskos. Die Elektronmünzen aus
dem Inneren des Tempels A (= Funda-
ment des Kroisosnaiskos) können bis 560
v. Chr. hinab datiert werden. Die Klein-
funde von Hogarth gehören nicht zu
einem Gründungsopfer, sondern sind
Füllschutt.
Zu den von Hogarth gefundenen
kamen 1987 bei den österreichischen
Ausgrabungen noch zwei Elektronmün-
zen vom Westrand des Naiskos hinzu.
Eine weitere Münze mit Legende wurde
1994 im Opfergraben unterhalb des Ton-
daches am Ostende des Tempelhofes an-
getroffen. Hier ist ein nach links blicken-
der Löwenkopf mit aufgerissenem Ra-
chen dargestellt, dessen Gegenüber nicht
vollständig erhalten ist. Die Bedeutung
der vielleicht lydischen Legende (<rka-
lim>) konnte noch nicht eindeutig geklärt
werden. Elektronmünzen stellen aber auch
ein charakteristisches Element der Beiga-
ben der nördlichen Kultbasis dar. Hier
wurden 1987 sieben Münzen in Schichten
mit frühkorinthischer Keramik gefun-
den, womit sicher ist, daß sie um 600
v. Chr. dorthin gelangt sind (Abb. 39).
Von dort stammt auch eine 4,7 gr
schwere Münze (ein Drittel eines Staters,
Trittie genannt) mit der Darstellung
zweier gegenständiger Eberköpfe (der
linke schlecht erhalten) (Abb. 115), zwi-
schen denen senkrecht eine Legende ein-
gestempelt ist, die entweder eine nicht
entzifferte lydische Legende oder eine
griechische Ligatur darstellt. Der Eber
spielt eine bedeutende Rolle in der Grün-
dungslegende von Ephesos. Nach Kreo-
philos bei Athenaios sei unweit der
Quelle Hypelaios bei der Vorbereitung
einer Mahlzeit ein Brand entstanden. Ein
Eber flüchtete vor den Flammen und
wurde von Androklos, dem mythischen
Stadtgründer von Ephesos, verfolgt. An
der Stelle, an der der Eber getötet wurde,
gründeten die Griechen einen Athena-
tempel. Eine weitere Münze, ebenfalls
eine Trittie, zeigt einen nach links
blickenden liegenden Löwen.
Bratspieße als Zahlungsmittel?
Neben diesem ältesten griechischen Geld
gab es auch Eisenspieße, Obeloi - bei
den Ausgrabungen meist nur als oxydier-
ter Metallklumpen gefunden -, die mög-
licherweise auch als eine Art Währung
dienten. Der Name Obelos (oder Obo-
los), nach seiner Werteinheit später auch
als Begriff für eine Geldeinheit gebräuch-
lich, bedeutet soviel wie Fleischspieß.
Davon stammt auch der neugriechische
Name Suvlaki ab.
Solche Eisenspieße wurden an ver-
schiedenen Stellen im Artemision gefun-
den: so im Altarbereich und im Bereich
der Basis B. Die meisten dieser Brat-
spießweihungen sind Bestandteil eines
kultischen Geschehens und müssen daher
in engem Zusammenhang mit den Opfer-
vorgängen gesehen werden. Ihre Bedeu-
tung kann aber auch im Materialwert des
Eisens liegen, und damit ist gelegentlich
eine Verwendung als Geld nicht ausge-
schlossen.