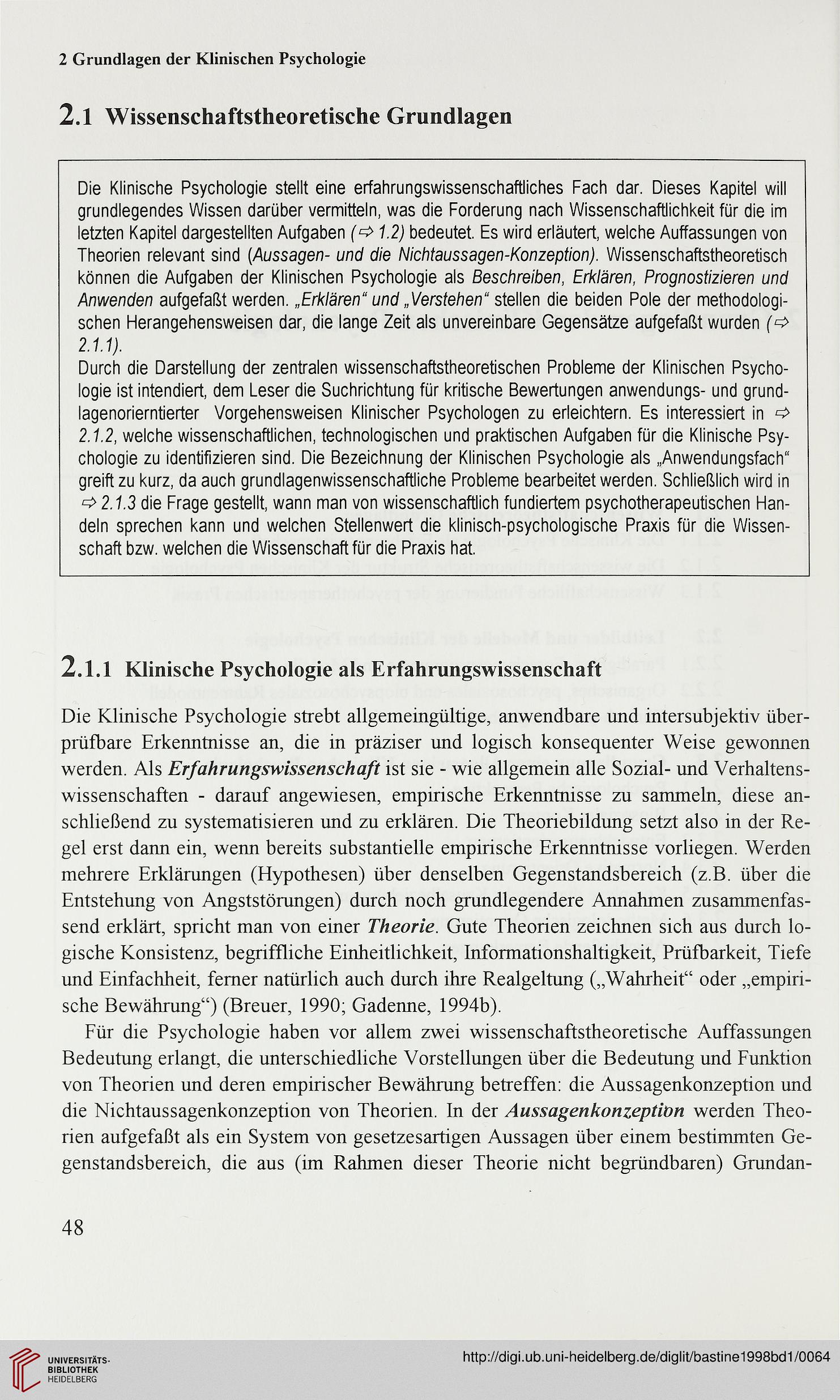2 Grundlagen der Klinischen Psychologie
2.1 Wissenschaftstheoretische Grundlagen
Die Klinische Psychologie stellt eine erfahrungswissenschaftliches Fach dar. Dieses Kapitel will
grundlegendes Wissen darüber vermitteln, was die Forderung nach Wissenschaftlichkeit für die im
letzten Kapitel dargestellten Aufgaben (^1.2) bedeutet. Es wird erläutert, welche Auffassungen von
Theorien relevant sind (Aussagen- und die Nichtaussagen-Konzeption). Wissenschaftstheoretisch
können die Aufgaben der Klinischen Psychologie als Beschreiben, Erklären, Prognostizieren und
Anwenden aufgefaßt werden. „Erklären" und „Verstehen" stellen die beiden Pole der methodologi-
schen Herangehensweisen dar, die lange Zeit als unvereinbare Gegensätze aufgefaßt wurden {<=>
2.1.1).
Durch die Darstellung der zentralen wissenschaftstheoretischen Probleme der Klinischen Psycho-
logie ist intendiert, dem Leser die Suchrichtung für kritische Bewertungen anwendungs- und grund-
lagenorierntierter Vorgehensweisen Klinischer Psychologen zu erleichtern. Es interessiert in <=>
2.1.2, welche wissenschaftlichen, technologischen und praktischen Aufgaben für die Klinische Psy-
chologie zu identifizieren sind. Die Bezeichnung der Klinischen Psychologie als „Anwendungsfach"
greift zu kurz, da auch grundlagenwissenschaftliche Probleme bearbeitet werden. Schließlich wird in
•=> 2.1.3 die Frage gestellt, wann man von wissenschaftlich fundiertem psychotherapeutischen Han-
deln sprechen kann und welchen Stellenwert die klinisch-psychologische Praxis für die Wissen-
schaft bzw. welchen die Wissenschaft für die Praxis hat.
2.1.1 Klinische Psychologie als Erfahrungswissenschaft
Die Klinische Psychologie strebt allgemeingültige, anwendbare und intersubjektiv über-
prüfbare Erkenntnisse an, die in präziser und logisch konsequenter Weise gewonnen
werden. Als Erfahrungswissenschaft ist sie - wie allgemein alle Sozial- und Verhaltens-
wissenschaften - darauf angewiesen, empirische Erkenntnisse zu sammeln, diese an-
schließend zu systematisieren und zu erklären. Die Theoriebildung setzt also in der Re-
gel erst dann ein, wenn bereits substantielle empirische Erkenntnisse vorliegen. Werden
mehrere Erklärungen (Hypothesen) über denselben Gegenstandsbereich (z.B. über die
Entstehung von Angststörungen) durch noch grundlegendere Annahmen zusammenfas-
send erklärt, spricht man von einer Theorie. Gute Theorien zeichnen sich aus durch lo-
gische Konsistenz, begriffliche Einheitlichkeit, Informationshaltigkeit, Prüfbarkeit, Tiefe
und Einfachheit, ferner natürlich auch durch ihre Realgeltung („Wahrheit" oder „empiri-
sche Bewährung") (Breuer, 1990; Gadenne, 1994b).
Für die Psychologie haben vor allem zwei wissenschaftstheoretische Auffassungen
Bedeutung erlangt, die unterschiedliche Vorstellungen über die Bedeutung und Funktion
von Theorien und deren empirischer Bewährung betreffen: die Aussagenkonzeption und
die Nichtaussagenkonzeption von Theorien. In der Aussagenkonzeption werden Theo-
rien aufgefaßt als ein System von gesetzesartigen Aussagen über einem bestimmten Ge-
genstandsbereich, die aus (im Rahmen dieser Theorie nicht begründbaren) Grundan-
48
2.1 Wissenschaftstheoretische Grundlagen
Die Klinische Psychologie stellt eine erfahrungswissenschaftliches Fach dar. Dieses Kapitel will
grundlegendes Wissen darüber vermitteln, was die Forderung nach Wissenschaftlichkeit für die im
letzten Kapitel dargestellten Aufgaben (^1.2) bedeutet. Es wird erläutert, welche Auffassungen von
Theorien relevant sind (Aussagen- und die Nichtaussagen-Konzeption). Wissenschaftstheoretisch
können die Aufgaben der Klinischen Psychologie als Beschreiben, Erklären, Prognostizieren und
Anwenden aufgefaßt werden. „Erklären" und „Verstehen" stellen die beiden Pole der methodologi-
schen Herangehensweisen dar, die lange Zeit als unvereinbare Gegensätze aufgefaßt wurden {<=>
2.1.1).
Durch die Darstellung der zentralen wissenschaftstheoretischen Probleme der Klinischen Psycho-
logie ist intendiert, dem Leser die Suchrichtung für kritische Bewertungen anwendungs- und grund-
lagenorierntierter Vorgehensweisen Klinischer Psychologen zu erleichtern. Es interessiert in <=>
2.1.2, welche wissenschaftlichen, technologischen und praktischen Aufgaben für die Klinische Psy-
chologie zu identifizieren sind. Die Bezeichnung der Klinischen Psychologie als „Anwendungsfach"
greift zu kurz, da auch grundlagenwissenschaftliche Probleme bearbeitet werden. Schließlich wird in
•=> 2.1.3 die Frage gestellt, wann man von wissenschaftlich fundiertem psychotherapeutischen Han-
deln sprechen kann und welchen Stellenwert die klinisch-psychologische Praxis für die Wissen-
schaft bzw. welchen die Wissenschaft für die Praxis hat.
2.1.1 Klinische Psychologie als Erfahrungswissenschaft
Die Klinische Psychologie strebt allgemeingültige, anwendbare und intersubjektiv über-
prüfbare Erkenntnisse an, die in präziser und logisch konsequenter Weise gewonnen
werden. Als Erfahrungswissenschaft ist sie - wie allgemein alle Sozial- und Verhaltens-
wissenschaften - darauf angewiesen, empirische Erkenntnisse zu sammeln, diese an-
schließend zu systematisieren und zu erklären. Die Theoriebildung setzt also in der Re-
gel erst dann ein, wenn bereits substantielle empirische Erkenntnisse vorliegen. Werden
mehrere Erklärungen (Hypothesen) über denselben Gegenstandsbereich (z.B. über die
Entstehung von Angststörungen) durch noch grundlegendere Annahmen zusammenfas-
send erklärt, spricht man von einer Theorie. Gute Theorien zeichnen sich aus durch lo-
gische Konsistenz, begriffliche Einheitlichkeit, Informationshaltigkeit, Prüfbarkeit, Tiefe
und Einfachheit, ferner natürlich auch durch ihre Realgeltung („Wahrheit" oder „empiri-
sche Bewährung") (Breuer, 1990; Gadenne, 1994b).
Für die Psychologie haben vor allem zwei wissenschaftstheoretische Auffassungen
Bedeutung erlangt, die unterschiedliche Vorstellungen über die Bedeutung und Funktion
von Theorien und deren empirischer Bewährung betreffen: die Aussagenkonzeption und
die Nichtaussagenkonzeption von Theorien. In der Aussagenkonzeption werden Theo-
rien aufgefaßt als ein System von gesetzesartigen Aussagen über einem bestimmten Ge-
genstandsbereich, die aus (im Rahmen dieser Theorie nicht begründbaren) Grundan-
48