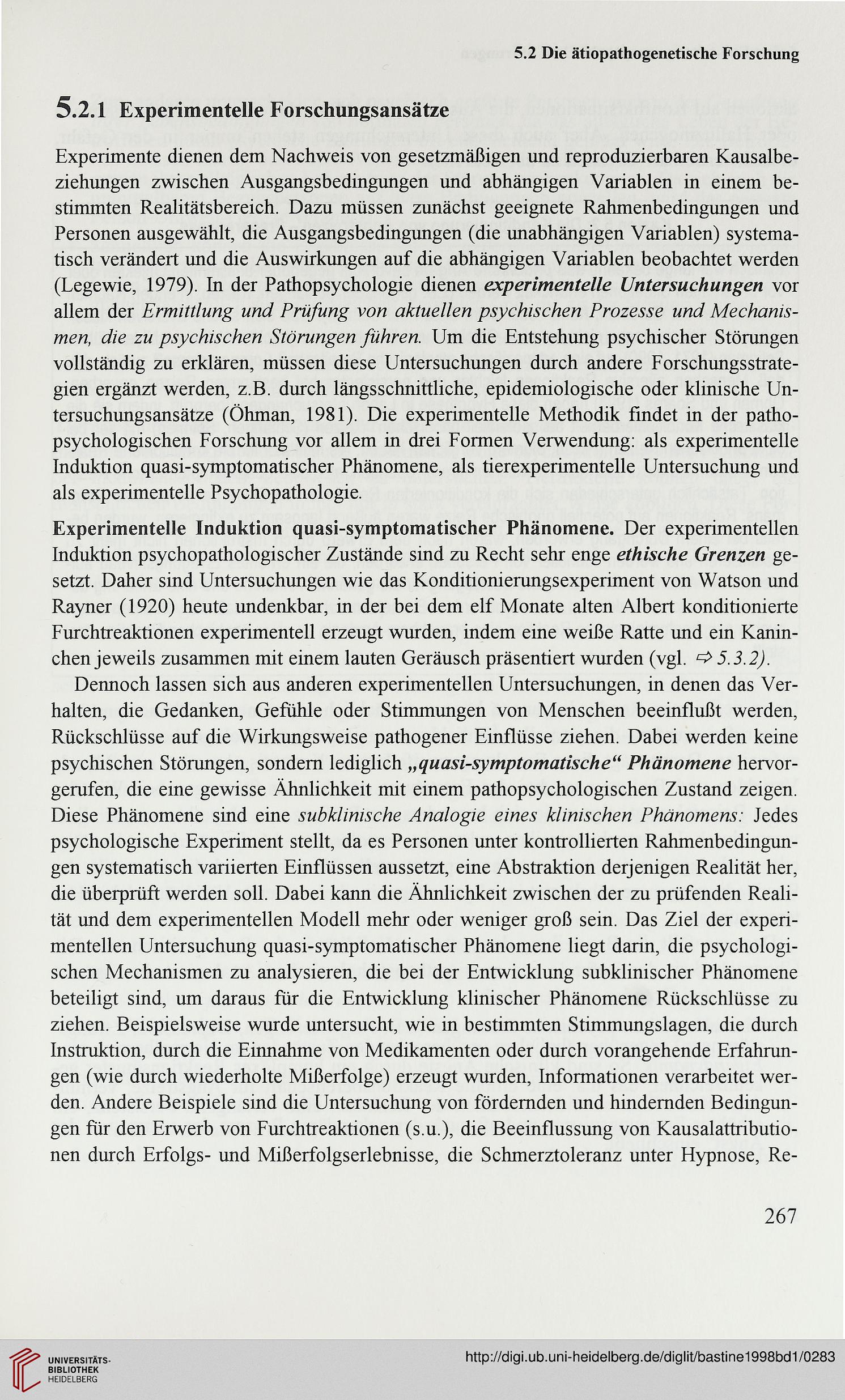5.2 Die ätiopathogenetische Forschung
5.2.1 Experimentelle Forschungsansätze
Experimente dienen dem Nachweis von gesetzmäßigen und reproduzierbaren Kausalbe-
ziehungen zwischen Ausgangsbedingungen und abhängigen Variablen in einem be-
stimmten Realitätsbereich. Dazu müssen zunächst geeignete Rahmenbedingungen und
Personen ausgewählt, die Ausgangsbedingungen (die unabhängigen Variablen) systema-
tisch verändert und die Auswirkungen auf die abhängigen Variablen beobachtet werden
(Legewie, 1979). In der Pathopsychologie dienen experimentelle Untersuchungen vor
allem der Ermittlung und Prüfung von aktuellen psychischen Prozesse und Mechanis-
men, die zu psychischen Störungen führen. Um die Entstehung psychischer Störungen
vollständig zu erklären, müssen diese Untersuchungen durch andere Forschungsstrate-
gien ergänzt werden, z.B. durch längsschnittliche, epidemiologische oder klinische Un-
tersuchungsansätze (Öhman, 1981). Die experimentelle Methodik findet in der patho-
psychologischen Forschung vor allem in drei Formen Verwendung: als experimentelle
Induktion quasi-symptomatischer Phänomene, als tierexperimentelle Untersuchung und
als experimentelle Psychopathologie.
Experimentelle Induktion quasi-symptomatischer Phänomene. Der experimentellen
Induktion psychopathologischer Zustände sind zu Recht sehr enge ethische Grenzen ge-
setzt. Daher sind Untersuchungen wie das Konditionierungsexperiment von Watson und
Rayner (1920) heute undenkbar, in der bei dem elf Monate alten Albert konditionierte
Furchtreaktionen experimentell erzeugt wurden, indem eine weiße Ratte und ein Kanin-
chen jeweils zusammen mit einem lauten Geräusch präsentiert wurden (vgl. <=> 5.3.2).
Dennoch lassen sich aus anderen experimentellen Untersuchungen, in denen das Ver-
halten, die Gedanken, Gefühle oder Stimmungen von Menschen beeinflußt werden,
Rückschlüsse auf die Wirkungsweise pathogener Einflüsse ziehen. Dabei werden keine
psychischen Störungen, sondern lediglich „quasi-symptomatische" Phänomene hervor-
gerufen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit einem pathopsychologischen Zustand zeigen.
Diese Phänomene sind eine subklinische Analogie eines klinischen Phänomens: Jedes
psychologische Experiment stellt, da es Personen unter kontrollierten Rahmenbedingun-
gen systematisch variierten Einflüssen aussetzt, eine Abstraktion derjenigen Realität her,
die überprüft werden soll. Dabei kann die Ähnlichkeit zwischen der zu prüfenden Reali-
tät und dem experimentellen Modell mehr oder weniger groß sein. Das Ziel der experi-
mentellen Untersuchung quasi-symptomatischer Phänomene liegt darin, die psychologi-
schen Mechanismen zu analysieren, die bei der Entwicklung subklinischer Phänomene
beteiligt sind, um daraus für die Entwicklung klinischer Phänomene Rückschlüsse zu
ziehen. Beispielsweise wurde untersucht, wie in bestimmten Stimmungslagen, die durch
Instruktion, durch die Einnahme von Medikamenten oder durch vorangehende Erfahrun-
gen (wie durch wiederholte Mißerfolge) erzeugt wurden, Informationen verarbeitet wer-
den. Andere Beispiele sind die Untersuchung von fördernden und hindernden Bedingun-
gen für den Erwerb von Furchtreaktionen (s.u.), die Beeinflussung von Kausalattributio-
nen durch Erfolgs- und Mißerfolgserlebnisse, die Schmerztoleranz unter Hypnose, Re-
267
5.2.1 Experimentelle Forschungsansätze
Experimente dienen dem Nachweis von gesetzmäßigen und reproduzierbaren Kausalbe-
ziehungen zwischen Ausgangsbedingungen und abhängigen Variablen in einem be-
stimmten Realitätsbereich. Dazu müssen zunächst geeignete Rahmenbedingungen und
Personen ausgewählt, die Ausgangsbedingungen (die unabhängigen Variablen) systema-
tisch verändert und die Auswirkungen auf die abhängigen Variablen beobachtet werden
(Legewie, 1979). In der Pathopsychologie dienen experimentelle Untersuchungen vor
allem der Ermittlung und Prüfung von aktuellen psychischen Prozesse und Mechanis-
men, die zu psychischen Störungen führen. Um die Entstehung psychischer Störungen
vollständig zu erklären, müssen diese Untersuchungen durch andere Forschungsstrate-
gien ergänzt werden, z.B. durch längsschnittliche, epidemiologische oder klinische Un-
tersuchungsansätze (Öhman, 1981). Die experimentelle Methodik findet in der patho-
psychologischen Forschung vor allem in drei Formen Verwendung: als experimentelle
Induktion quasi-symptomatischer Phänomene, als tierexperimentelle Untersuchung und
als experimentelle Psychopathologie.
Experimentelle Induktion quasi-symptomatischer Phänomene. Der experimentellen
Induktion psychopathologischer Zustände sind zu Recht sehr enge ethische Grenzen ge-
setzt. Daher sind Untersuchungen wie das Konditionierungsexperiment von Watson und
Rayner (1920) heute undenkbar, in der bei dem elf Monate alten Albert konditionierte
Furchtreaktionen experimentell erzeugt wurden, indem eine weiße Ratte und ein Kanin-
chen jeweils zusammen mit einem lauten Geräusch präsentiert wurden (vgl. <=> 5.3.2).
Dennoch lassen sich aus anderen experimentellen Untersuchungen, in denen das Ver-
halten, die Gedanken, Gefühle oder Stimmungen von Menschen beeinflußt werden,
Rückschlüsse auf die Wirkungsweise pathogener Einflüsse ziehen. Dabei werden keine
psychischen Störungen, sondern lediglich „quasi-symptomatische" Phänomene hervor-
gerufen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit einem pathopsychologischen Zustand zeigen.
Diese Phänomene sind eine subklinische Analogie eines klinischen Phänomens: Jedes
psychologische Experiment stellt, da es Personen unter kontrollierten Rahmenbedingun-
gen systematisch variierten Einflüssen aussetzt, eine Abstraktion derjenigen Realität her,
die überprüft werden soll. Dabei kann die Ähnlichkeit zwischen der zu prüfenden Reali-
tät und dem experimentellen Modell mehr oder weniger groß sein. Das Ziel der experi-
mentellen Untersuchung quasi-symptomatischer Phänomene liegt darin, die psychologi-
schen Mechanismen zu analysieren, die bei der Entwicklung subklinischer Phänomene
beteiligt sind, um daraus für die Entwicklung klinischer Phänomene Rückschlüsse zu
ziehen. Beispielsweise wurde untersucht, wie in bestimmten Stimmungslagen, die durch
Instruktion, durch die Einnahme von Medikamenten oder durch vorangehende Erfahrun-
gen (wie durch wiederholte Mißerfolge) erzeugt wurden, Informationen verarbeitet wer-
den. Andere Beispiele sind die Untersuchung von fördernden und hindernden Bedingun-
gen für den Erwerb von Furchtreaktionen (s.u.), die Beeinflussung von Kausalattributio-
nen durch Erfolgs- und Mißerfolgserlebnisse, die Schmerztoleranz unter Hypnose, Re-
267